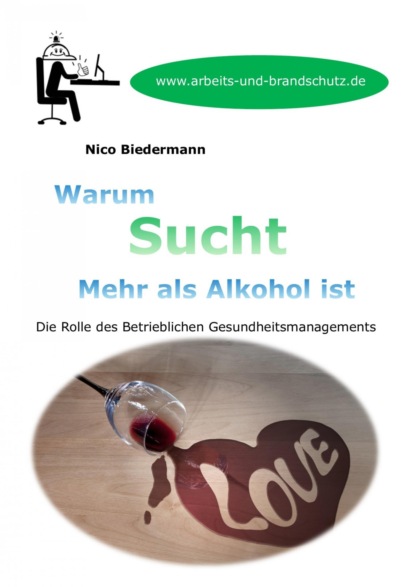- -
- 100%
- +

Liebe Leser,
Sucht wird nicht gern thematisiert. Das mag daran liegen, dass es viele Mythen gibt - aber auch, weil sich die Betroffenen schämen. Dabei gibt es nicht nur eine Abhängigkeit nach Alkohol oder Drogen, sondern auch nach Anerkennung und den neuen internetbasierten Medien.
Interessant ist dabei, welche Probleme die Sucht am Arbeitsplatz bringt und in welches Dilemma die Führungskräfte kommen. Durch ihre Fürsorgepflicht sind sie dazu verpflichtet, den Betroffenen zu helfen, aber wissen oft nicht, wie sie das anstellen sollen.
In diesem Buch soll ein Verständnis der verschiedenen Formen der Sucht für Beschäftigte, Kollegen und Vorgesetzte geschaffen werden. Es wird auf die unterschiedlichen Ausprägungen eingegangen und die Wirkung von Hormonen und Botenstoffen wird thematisiert. Jedoch bleibt das Buch ein Überblick. Vielmehr wird der Fokus auf die Möglichkeiten im Betrieblichen Gesundheitsmanagement gelegt, die Handlungspflicht der Vorgesetzten wird beleuchtet und es kann auch Angehörigen helfen, die Ursachen der Sucht zu erkennen.
Herzliche Grüße
Ihr Nico Biedermann
Süchte als Übersicht
Sucht - Was ist das eigentlich und welche Probleme gibt es?
Um über Sucht am Arbeitsplatz zu sprechen, stellt sich zuerst die Frage, um was es eigentlich geht.
Was ist Sucht?
Der Begriff umfasst verschiedene Facetten der Sucht, z. B. Alkoholsucht, Drogensucht und die Abhängigkeit von Medikamenten. Dabei handelt es sich jeweils um Stoffabhängigkeiten. Aber es gibt auch seelische Abhängigkeiten. Zu nennen sind dabei die Spielsucht, die Essstörungen (Ess- und Brechsucht, Fresssucht) und es wird auch von süchtigem Verhalten bzgl. Handy und Internet gesprochen. Das unter dem Namen FOMO bekannte Phänomen, stellt einen nicht gerade kleinen Anteil des Problems dar.
Süchte als Übersicht
Alkohol- und Drogenkonsum sind die ersten Gedanken zum Thema Sucht. Aber es gibt weitere Ausprägungen. Hinzu kommen:
Tabak
Medikamente
Glücksspiel
Magersucht (Anorexia Nervosa)
Bulimia Nervosa (Ess-Brech-Sucht)
Fettsucht (Adipositas) und auch
Zucker
Die Schwierigkeiten durch Sucht
Die Probleme, die durch eine Sucht entstehen, liegen oft in erhöhten Unfallgefährdungen oder auch in der sozialen Isolation. Die Abhängigen bewegen sich zunehmend in einem sozialen Umfeld, in dem Sucht und Chaos öfter vorkommen. Dadurch fällt es schwer aus dem Hamsterrad auszubrechen und in ein normales Leben zurückzufinden. In der Deutschen Hauptstelle für Suchtfragen (DHS) geht man davon aus, dass 10 % - 30 % der Arbeits- und Wegeunfälle durch Alkoholeinwirkung verursacht werden.
Suchtprävention am Arbeitsplatz und Unterstützung
Im Sinne eines betrieblichen Gesundheitsmanagements ist die Suchtprophylaxe bzw. gezielte Unterstützung bzgl. der Therapie wichtig. Klare Absprachen machen es dem Arbeitgeber leichter in den Arbeitnehmer zu vertrauen. Wenn gegenseitige Vereinbarungen eingehalten werden, dann sieht der Arbeitgeber den Willen und gleichzeitig stärkt der Betroffene mit zunehmendem Therapieerfolg seinen Stand im Unternehmen. Abrutschen kann im Prinzip jeder, aber wieder aufstehen zeigt Stärke, Willen und schafft Vertrauen.
Zahlen und Fakten
Im Normalfall, also bei einer gesunden Leber, wird eine Blutalkoholkonzentration von 1,3 Promille frühestens nach 8 Stunden vollständig abgebaut sein. Das Problem ist, dass sich die Betroffenen schon vor Ablauf der 8 Stunden fitter fühlen und dadurch der Alkoholspiegel falsch wahrgenommen wird. Weitere Zahlen:
Der volkswirtschaftliche Schaden durch Alkohol wird auf 57 Milliarden Euro pro Jahr geschätzt
jährlich sterben ca. 74.000 Menschen in Deutschland im Zusammenhang mit Alkohol
1,6 Mio. Deutsche sind alkoholabhängig
jährlich konsumiert jeder Deutsche ca. 10 Liter reinen Alkohol
Was ist eine Co-Abhängigkeit?
Neben einer direkten Suchterkrankung spielt die Co-Abhängigkeit eine entscheidende Rolle im Krankheitsgeschehen. Denn die Probleme am Arbeitsplatz zeigen sich ebenfalls am Arbeitsplatz.
Co-Abhängigkeit heißt, dass Menschen aus dem Umfeld ebenfalls krank werden. Familie, Partner und Freunde von einem Suchtkranken wollen helfen. Sie beschützen und verteidigen die Betroffenen. Die Fassade darf nach außen hin nicht bröckeln. Es dreht sich alles nur um den Abhängigen. Der Versuch zu helfen scheitert. Der Strudel dreht sich schneller.
Das eigene Leben schwindet
Die Angehörigen haben kein eigenes Leben mehr. Soziale Kontakte werden gemieden: „dem Erkrankten muss doch geholfen werden“. Tätigkeiten werden übernommen, Aufgaben erledigt. Alles mit den besten Absichten. Doch wer ist nun krank?
Co-Abhängigkeit: Abhängig vom Abhängigen
Wenn der Teufelskreis geschlossen ist, so brauchen die Helfer ebenfalls Hilfe. Sie sind co-abhängig. Abhängig von der Sucht des Betroffenen. Gut gemeinte Hilfe, unter Aufgabe des eigenen Lebens, verschlimmert die Situation und macht krank. Psychosomatische Beschwerden, Gedankenkreisen, Wut, Hilflosigkeit und Depressionen. Hilfe von außen ist nun wichtig!
Co-Abhängig am Arbeitsplatz
Was das bedeutet, kann sich ganz individuell zeigen. Stellen sich psychische Erkrankungen ein, kann auch hier Handlungsbedarf im Sinne der Arbeitssicherheit bzw. der betrieblichen Maßnahmen zum Gesundheitsmanagement gegeben sein. Jede Abhängigkeit sollte ernst genommen werden. Konzentrationsprobleme und Kontrollverlust sind erste Stichworte in dem Zusammenhang. Die Co-Abhängigen können die gleichen Symptome zeigen: Sie können übermüdet zur Arbeit erscheinen und eine eingeschränkte Konzentration an den Tag legen. Die Gedanken kreisen immer um die Fragen: „Wie kann ich helfen? Wieso bin ich so machtlos?“
Vorgesetzte, Betriebsärzte und Fachkräfte für Arbeitssicherheit sind gefordert.
Serotonin
Botenstoffe im Gehirn - Was macht uns glücklich und was krank?
Wohlbefinden, gute Laune, Glücksgefühl und Motivation! Unter anderem werden diese Gefühle durch Botenstoffe und elektrische Impulse unserer Milliarden von Nervenzellen gesteuert. Die Motivation zur Arbeit zu gehen, oder als Chef etwas Gutes für die Mitarbeiter zu tun, kommt also von Nervenzellen und Botenstoffen. Allerdings sind diese Botenstoffe nicht nur für die positiven Effekte verantwortlich, sondern auch bei der Entstehung der Suchtkrankheiten von Bedeutung. Süchte, Depression und mangelnder Antrieb gehen auf ein Ungleichgewicht unseres Cocktails von elektrischen und chemischen Signalen zurück. Denn die Botenstoffe (auch Neurotransmitter genannt) stehen in unmittelbarem Zusammenhang zu unserem Belohnungssystem. Schöne aber auch schlimme Erlebnisse bringen diesen Mix der vielen Stoffe kurz- oder auch langfristig durcheinander. Vier der im Volksmund bekanntesten Stoffe sollen nun vorgestellt werden.
Serotonin
Das Serotonin gibt uns Gelassenheit, das Bedürfnis nach Harmonie und Zufriedenheit. Ebenso steuert es unser Sättigungsgefühl und dämpft unangenehme Gefühle wie Angst, Kummer, Sorgen und Aggressionen. Ein Mangel zeigt sich unter anderem in Angststörungen, Depressionen und Zwangsstörungen. Wie auch beim Dopamin wirkt sich ein Zuviel an Serotonin überhaupt nicht gut für uns aus. In dem Fall leiden wir unter Unruhe, Angst, Erregtheit, Zittern und Muskelzucken. Unseren eigenen Serotoninspiegel können wir ankurbeln, indem wir uns ausreichend bewegen. Aber auch ein Stück Schokolade hebt die Stimmung, denn durch die Kohlenhydrate wird die Serotoninbildung im Gehirn beflügelt. Das ist ja das Problem bei den Süßigkeiten, denn auch von dem tollen Gefühl wollen wir viel haben. Also aufpassen, dass es nicht ausartet.
Noradrenalin
Es besteht eine enge Verwandtschaft zum Adrenalin, wodurch wir wach und aufmerksam werden. So ist nur logisch, dass bei einem Aufmerksamkeitsdefizitsyndrom oder auch einer Hyperaktivität Medikamente verabreicht werden, die den Dopamin- bzw. Noradrenalinspiegel anheben. Auch bei gefährlich niedrigem Blutdruck wird Noradrenalin verabreicht. Um Noradrenalin im Kleinhirn und dem Nebennierenmark herzustellen, braucht unser Körper Dopamin und Enzyme.
Endorphine, die körpereigenen Drogen als Botenstoffe
Endorphine werden in der Hirnanhangsdrüse, der Hypophyse, produziert und sind die körpereigenen Schmerzkiller. Denn die Endorphine sind ein körpereigenes Morphin. Größere Mengen an Endorphinen schüttet unser Körper in Extremsituationen aus, z. B. bei einer schweren Verletzung oder während der Geburt. Sportarten wie Bungee-Jumping oder Drachenfliegen geben einen Nervenkitzel, der durch eine erhöhte Produktion von Endorphinen hervorgerufen wird. Die körpereigenen Morphine haben noch mehr nützliche Funktionen, denn sie beruhigen, stärken die Abwehr und regulieren unseren Schlaf. Das Gemüt wird heiter und das Stressempfinden reduziert.
Wie können Endorphine erzeugt werden
Ganz einfach: Ganz viel lachen! Endorphine werden ständig produziert, wenn wir Sport machen. Die Kehrseite: es ist ein Morphin! Demzufolge lässt die Wirkung irgendwann nach und wir müssen immer mehr Sport machen, um die Menge an Endorphinen zu produzieren, die uns so guttun. Das mag alles noch funktionieren! Allerdings wird es für viele Spitzensportler kompliziert, wenn sie aus irgendeinem Grund den Sport aufgeben müssen. Denn die Stimmung rauscht rapide in den Keller! „Such Dir ein anderes Hobby!“ ist eben nicht immer so einfach.
Dopamin: Moleküle sind Botenstoffe und Hormone
Dopamin ist ein wichtiger Botenstoff unseres Gehirns und gleichzeitig ein Hormon. Es gehört zum komplexen Spiel unseres Belohnungssystems und dient auch als „Messhormon“ für den Appetit. Eine Ausschüttung erfolgt, wenn wir lang ersehnte Ziele erreichen konnten oder ein schönes Erlebnis haben. Das Hormon selbst wird unter anderem im Hypothalamus gebildet und ist bei der Synthese von Adrenalin und Noradrenalin eher ein Zwischenprodukt. Gleichzeitig dient Dopamin als Botenstoff, genau wie Serotonin. Insgesamt ein vielseitiger Stoff, der genau dosiert im Körper produziert werden muss. Konzentrationsschwierigkeiten sind eine durchaus häufige Wirkung bei einem Mangel dieses Hormons.
Dopamin ist für unseren Antrieb verantwortlich, steuert unsere Interessen und unseren Tatendrang. Er verschafft uns Energie unsere Ziele anzugehen, und damit legt diese Wundersubstanz den Grundstein, unsere Ziele zu erreichen. Allerdings ist ein Zuviel an Dopamin auch nicht gut, denn Menschen mit einem erhöhten Dopaminspiegel neigen zu Drogenkonsum, unkontrollierten sexuellen Spielen mit mehreren Personen und erhöhter Impulsivität. Um noch einen oben drauf zu setzen, ist eine zu hohe Konzentration an Dopamin auch für die Entstehung von Schizophrenie und Psychosen verantwortlich. Mit dem körpereigenen Antriebsstoff lässt sich auch die erregende Wirkung verschiedener Drogen wie Kokain oder Amphetamin erklären, denn diese Stoffe sorgen für eine Erhöhung des Dopaminspiegels. In der Konsequenz, zeigt sich ein Mangel an Dopamin durch Antriebsschwäche, Interessenslosigkeit und Lustlosigkeit. All diese Symptome gehören übrigens auch zu einer Depression und die damit einhergehende Missstimmung. Die Krankheit Parkinson rührt auf einen verringerten Dopaminspiegel, denn der Botenstoff lässt uns flüssige Bewegungen ausführen. Ein Zuwenig blockiert die Bewegungsimpulse, wodurch sie nicht mehr weitergeleitet werden können. Es zeigen sich die krankheitstypischen Bewegungsstörungen.
Zusammengefasst ist Dopamin der Powerriegel für uns, der uns mit Energie nur so überziehen kann. Da das nicht immer gesund ist, braucht der Körper einen Gegenspieler, das bereits erwähnte Serotonin.
Die negative Kehrseite unseres chemischen Belohnungssystems
Unser Belohnungssystem und die Chemie, die süchtig macht
Unser Belohnungssystem ist äußerst komplex. Viele Hormone und Botenstoffe spielen eine Rolle, wenn es um gute Gefühle und Tatendrang geht. Darunter sind die bekannten Beteiligten: Serotonin, Noradrenalin, Dopamin und Endorphine. Natürlich ist das alles ein wenig komplizierter als nur das Zusammenspiel von 4 Stoffen. Deshalb spricht man in der Psychologie von einem Belohnungssystem. Das ist das ständige Streben nach Belohnung, welche uns einen chemischen Cocktail beschert. Entweder in uns selbst, oder durch die Zuführung von Stoffen. Ein selbsterlegtes Stück Fleisch, aufregende sexuelle Erlebnisse oder das Lob vom Chef erzeugen in uns ein gutes Gefühl. Das Streben danach ist durchaus positiv, denn es erhält uns am Leben (Nahrung besorgen), es sichert unseren Fortbestand (die Sache mit dem Storch) und sichert unsere Existenz. Denn ein zufriedener Chef schmeißt uns nicht raus. Demzufolge sind das Verlangen und die Aussicht auf Belohnung unser Motivator.
Die negative Kehrseite unseres chemischen Belohnungssystems
Sind wir glücklich, dann hat unser Gehirn folgenden Auftrag zu erfüllen: „Schütte Endorphine aus und mach, dass ich mich gut fühle!“. Nun haben Forscher aber herausgefunden, dass genau diese Stoffe, die uns so ein schönes Gefühl machen, auch dann ausgeschüttet werden, wenn wir Drogen konsumieren oder am Glücksspiel teilnehmen. In dem Moment ist unsere Motivation zum Handeln bei Weitem nicht mehr so positiv und wir bekommen ein Problem.
Die Entdeckung des Belohnungssystems war ein Fehler im System
Alles begann damit, dass Elektroden in ein bestimmtes Areal im Gehirn von Ratten eingesetzt wurden. Bei einer Ratte wurde die Elektrode allerdings in ein falsches Areal eingesetzt, weswegen die Forscher das Belohnungssystem entdeckten.
In einer sogenannten Skinner-Box befand sich ein kleiner Hebel, den eine Ratte drücken konnte, um einen elektrischen Reiz durch die Elektrode in das Gehirn zu erhalten. Aufgrund der Häufigkeit der Hebelbetätigung kann davon ausgegangen werden, dass es sich um ein angenehmes Gefühl handelt, welches durch die Elektrode erzeugt wurde. Die Forscher staunten nicht schlecht, denn die Ratten waren die ganze Zeit damit beschäftigt den Hebel zu drücken und damit einen elektrischen Reiz zu erhalten. Dadurch vergaßen die Tiere sogar das Futter, welches ihnen ebenso im Käfig angeboten wurde. Das ging so weit, dass die Tiere zusammenbrachen, weil sie das Trinken vergaßen.
Das limbische System und der Nucleus accumbens
Unser Belohnungssystem steckt im sogenannten limbischen System. Um das limbische System zu aktivieren, braucht es einen Reiz von außen. Dieser kann z. B. ein Stück Schokolade sein. Sobald der Reiz (Anblick des Stücks Schokolade) auf das limbische System wirkt, wird daraufhin ein Drang generiert, sodass die Großhirnrinde das Verlangen erfasst. Erst wenn dem Verlangen nachgegeben wird, gibt es ein komplexes Zusammenspiel in unserem Hirn. Zusammen mit dem Neurotransmitter Dopamin wird das Hirnareal Nucleus accumbens stimuliert. In diesem Areal sitzt unser Belohnungssystem. Die stimulierte Hirnregion nucleus accumbens sendet nun einen Cocktail von Botenstoffen aus, der in anderen Arealen des Gehirns die Empfindung von Freude und Zufriedenheit auslöst. Insgesamt lässt sich sagen, dass das gesamte Belohnungssystem ein sehr komplexes Gefüge ist, welches hier nur in groben Ausschnitten wiedergegeben wird.
Dopamin allein macht nicht glücklich - Belohnungssystem heißt mehr
Die Forscher machten eine weitere interessante Entdeckung: Das Dopamin selbst ist nicht der Stoff, der das freudige Glückserlebnis im Gehirn auslöst. Es ist lediglich Teil des Systems. Demzufolge ist nicht die Schokolade selbst der Auslöser für die Glücksgefühle, sondern die Erwartung, dass die Befriedigung des Verlangens nach der Süßigkeit die Freude auslöst. Das bedeutet, dass das Glücksgefühl bei der Befriedigung des Verlangens nicht durch Dopamin ausgelöst wird, sondern von verschiedenen Endorphinen und anderen Botenstoffen. Zu nennen ist dabei das Oxytocin. Dieses Hormon wird auch Kuschelhormon genannt und wird überwiegend bei Berührung ausgeschüttet. Es fördert so die zwischenmenschlichen Bindungen. Allerdings ist der gesamte Wirkmechanismus derzeit noch nicht vollständig erforscht.
Das Belohnungssystem in unserem Gehirn kann durch viele verschiedene Reize stimuliert werden. In der Regel ist zwischen Anblick, Verlangen und Befriedigung des Verlangens ein weiter, langer und komplizierter Weg von chemischen und elektrischen Signalen. Allerdings lässt sich diese Kette auch abkürzen. Drogen greifen viel eher ein und aktivieren die Zellen im Nucleus accumbens länger und intensiver. Aus diesem Grund sind Drogen oder auch Glücksspiele ein sehr, sehr starker Motivator.
Dopamin spielt eine Rolle bei Suchterkrankungen
Dopamin selbst löst keine Suchtprobleme aus. Allerdings spielt es im Wirkprofil von Drogen wie Kokain eine Rolle. Denn diese Drogen unterbinden die Wiederaufnahme des Botenstoffs in die Nervenzelle und fungieren damit als Dopamin-Wiederaufnahmehemmer. Problematisch wird es nach dem Konsum, denn dann wird das angesammelte Dopamin in größerer Menge aufgenommen, womit die Wirkung wesentlich größer ist. Man kann sich gut vorstellen was passiert, wenn ein Stoff, der direkt das Belohnungssystem aktiviert in höherer Menge wirkt. Das ist ein intensives Glücksgefühl. Klar, dass sich dieser Zustand wiederholen soll. Besonders die Tatsache, dass die heftige und positive Wirkung schnell wieder vorbei ist, lässt die nächste Stufe klarer werden: der Rutsch in die Psychose. „Wenn doch Drogen helfen das Belohnungssystem zu aktivieren, dann her damit! Das war doch so schön!"... Und genau ab diesem Zeitpunkt kommt der Teufelskreislauf in Gang.
Experimente zum Belohnungssystem zur Erklären der Suchtentstehung
Um die Suchtentstehung zu ergründen, führten Forscher in den 50er Jahren ebenfalls Experimente mit Ratten durch. Die Ratten konnten sich in einer Skinner-Box allein durch die Betätigung eines Hebels verschiedene Drogen wie Heroin, Kokain oder Amphetamin ins Blut spritzen. Ein anderer Hebel enthielt lediglich Salzlösung und ein dritter Hebel gab den Ratten das Futter. Relativ schnell legten sich die Ratten auf einen Hebel fest und ließen die beiden anderen außer Acht. Genutzt wurde der Hebel, der die Drogen injiziert. Es wurde gezeigt, dass die Tiere schnell ein süchtiges Verhalten entwickelt hatten. Denn sie verabreichten sich nur noch die Drogen und nahmen keine Nahrung und keine Flüssigkeit zu sich. Die Tiere starben an Unterernährung. In den folgenden Experimenten wurde der Nucleus accumbens der Versuchstiere beschädigt. Demzufolge konnten die Tiere während des Experiments auch keine Sucht entwickeln. In weiteren Experimenten wurden die Zellen der Tiere beschädigt, die sowieso nicht auf Dopamin reagierten. Auch diese Tiere wurden süchtig. So konnte nachgewiesen werden, dass der Botenstoff Dopamin maßgeblich an der Entwicklung von Süchten beteiligt ist.
Mit Dopamin-Neuronen die Entzugsproblematik erklären
Zusammen mit dem Leibniz-Instituts für Neurobiologie (LIN) haben Forscher herausgefunden, dass sowohl Beginn und Ende einer „Belohnungssituation“ durch ein und dasselbe Dopamin-Neuron vermittelt werden kann. Dieses Prinzip wurde in einem Kooperationsprojekt mit der Universität Konstanz, der Universität Leipzig und dem Janelia Research Campus aus den USA entdeckt. Wenn die selben Dopamin-Neuronen für das tolle Glücksgefühl am Anfang des Drogenkonsums und dem Tief danach verantwortlich sind, kann dies bedeutende Fortschritte in der Suchtforschung bedeuten. Damit könnte das schwierig zu lösende Problem der Entzugssymptomatik näher erforscht werden.
Im Hirnscanner leuchtet der Nucleus accumbens eines Kokainsüchtigen auf, wenn ihm ein Bild von Kokain gezeigt wird. Bei einem Spielsüchtigen ist dies der Fall, wenn ihm ein Bild eines Spielautomaten auch nur gezeigt wird. Dies zeigt, dass unser Belohnungssystem schon aktiv ist, wenn lediglich der Reiz (also ein Bild) auf das Gehirn einwirkt.
Beim Belohnungssystem dient das Dopamin als Kontrollinstanz beim Sattmachen
Forscher der Max-Planck-Gesellschaft haben nun untersucht, wie Dopamin unser Essverhalten reguliert. Studienteilnehmern wurden Milchshakes angeboten und die jeweilige Dopaminmenge bei der Aufnahme des Shakes und bei Erreichen des Magens ermittelt. So konnte gezeigt werden, dass Dopaminmoleküle schon dann ausgeschüttet werden, wenn der Milchshake im Mund der Teilnehmer war. Eine weitere Dopaminmenge wurde ausgeschüttet, sobald der Milchshake den Magen erreichte. Dabei stellte das Forscherteam den folgenden direkten Zusammenhang her:
Teilnehmer, die ein hohes Verlangen nach einem Milchshake hatten, produzierten eine höhere Menge an Dopamin, als diejenigen mit einem normalen Verlangen. Die Forscher fanden auch heraus, dass bei den Personen mit einem großen Verlangen nach einem Milchshake weniger Dopamin beim Erreichen des Magens ausgeschüttet wurde und damit die Rückmeldung „ich bin satt“ zu spät einsetzt oder gar nicht. In der Folge wird so lange weiter gegessen oder getrunken, bis die entsprechende Dopaminmenge endlich freigesetzt wird. Anzumerken ist, dass das Dopamin nicht im Magen entsteht, sondern im Belohnungssystem des Gehirns. Allerdings erfolgt eine Meldung vom Magen an das Gehirn: „Bitte liebes Hirn, schütte Dopamin aus!“ Weitere Informationen dazu, finden Sie auf den Seiten der Max-Planck-Gesellschaft.
Unser Belohnungssystem in der modernen Welt
In der heutigen, modernen Welt sind billiger Alkohol, preiswerte Zuckerprodukte und andere auf das Belohnungssystem wirkende Reize nicht mehr wegzudenken. Wenn es um das Glücksgefühl nach einer Belohnung geht, so ist dabei fast immer der Botenstoff Dopamin beteiligt. Es ist doch toll, wenn ein Kommentar auf Facebook ”geliked“ wird. Wenn jemand den Spruch oder das Bild im WhatsApp-Status gut findet... wenn eine neue Nachricht eintrifft und wildfremde Facebook-Freunde sich für den Online-Kumpel interessieren. Darüber freuen wir uns. Während virtuelle Kontakte das Belohnungssystem ankurbeln, kann die reale Welt dagegen sehr einsam sein. Zucker in Form von Chips und Schokolade ist ebenfalls nicht sehr kommunikativ. Alkohol und Drogen verschaffen also kurzzeitig ein tolles Gefühl, dieses flacht aber schnell sehr heftig wieder ab.
Spaß und Heiterkeit mit echten, realen Freunden sind anhaltend - Zucker und der WhatsApp-Status verschwinden!
Nachfolgend werden einige bekannte Vertreter der abhängig machenden Substanzen näher vorgestellt.
Конец ознакомительного фрагмента.
Текст предоставлен ООО «ЛитРес».
Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на ЛитРес.