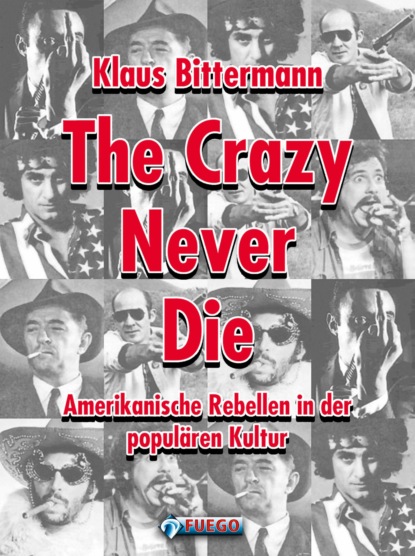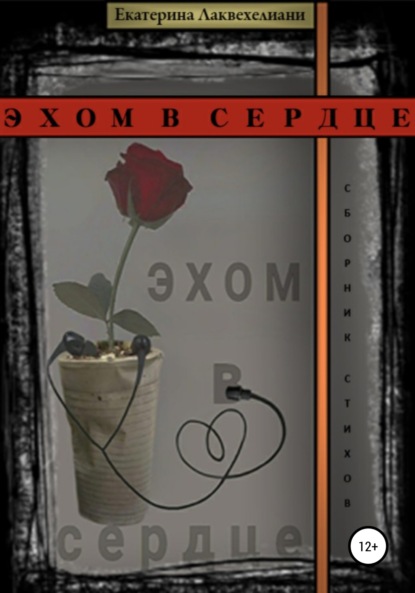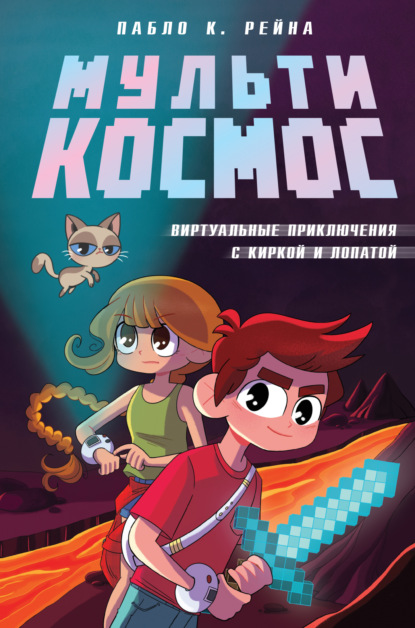- -
- 100%
- +
Das alte Amerika jedoch gab sich so einfach nicht geschlagen, auch wenn Lenny Bruce nach langen enervierenden Gerichtsverfahren einige Prozesse sogar gewann. Die Sache war sehr aufreibend, und »während die neue Bewegung blüht, wurde Lenny Bruce von den Cops zu Tode gehetzt. Wegen Obszönität«, schrieb Hunter S. Thompson in einem Brief. Das Problem dabei: Die Freiheit der Rede ist zwar im ersten Verfassungszusatz verankert. Aber wie immer gibt es Ausnahmen, und zwar Obszönität, Kinderpornographie, Aufruf zum Rassismus und zum Umsturz der Gesellschaft, und wie immer sind diese Einschränkungen zwar auf den ersten Blick vernünftig, aber auch eine Sache der Interpretation, und für den prüden J. Edgar Hoover, der als oberster Sittenwächter über Amerikas öffentliche Moral wachte, war wahrscheinlich schon Händchenhalten eine anstößige Sache, weshalb er unter Obszönität etwas ganz anderes verstanden haben dürfte als Allen Ginsberg, und vermutlich war für J. Edgar Hoover, bei dem sich später herausstellte, daß er einen ziemlichen Dachschaden hatte, alles obszön und pervers, was lange Haare hatte und männlichen Geschlechts war.
Zwar war in Amerika der gesetzliche Schutz des ersten Verfassungszusatzes von allen Industrienationen am größten, aber wer, wie es hieß, »sexuelle Verhaltensweisen in offenkundig offensiver Weise beschreibt und darstellt ohne seriösen literarischen, künstlerischen, politischen oder wissenschaftlichen Wert«, der sollte sich nicht so ohne weiteres auf das Recht für freie Meinungsäußerung berufen können. Und natürlich war es für die Konservativen überhaupt keine Frage, daß Lenny Bruces Performance irgendetwas mit ernsthafter Kunst zu tun hatte, worin er ihnen mit Sicherheit recht gegeben hätte. Aber es kam ihm nicht auf formale Dinge an, nicht auf die Spitzfindigkeit bei der Definition von Begriffen und ihren Bedeutungen, sondern auf die Doppelmoral von Leuten wie Richard J. Daley, dem Bürgermeister von Chicago, der jedem, der ihm dumm kam, ein »Fuck you, you son of a bitch« an den Kopf warf. Solange er es nicht von der Bühne aus tat, war alles in Butter, während sich Lenny Bruce vor Gericht in Chicago für »Titten« verantworten mußte, in San Francisco für »cocksucker«, in New York für »fucking« und in Los Angeles für »schmuck«, eigentlich Schmock, was ursprünglich extra für den deutsch-stämmigen jüdischen Immigranten erfunden wurde und Idiot bedeutete.
Der dreckige kleine Bastard
Ich glaube, Lenny Bruce war weniger ein Verfechter der freien Meinungsäußerung, als der er später immer hingestellt wurde, auch wenn er seine Sache bis hinauf zum Obersten Gerichtshof verfocht, sondern einer, der ganz eigensinnig darauf beharrte, das zu tun, was sein Beruf war, und seine Show bestand nun mal im wesentlichen in der Vorführung der amerikanischen Schizophrenie, der sexuellen Verklemmtheit, der Bigotterie, und das war ja auch sein Markenzeichen, deshalb wurde er ja auch von Abbie Hoffman so geliebt. Vermutlich hätte er der Darling des New Yorker Kulturestablishments werden können, stattdessen führte er einen ausufernden Kleinkrieg gegen die Justiz, den er nicht gewinnen konnte und der ihn aufrieb. In etlichen Staaten hatte er Auftrittsverbot, dem sich auch England und Australien anschlossen. Australien? Nobody knows why.
Im Grunde blieb Lenny Bruce ein kleiner Bastard, eine Art Medium, durch das der sich um Assimilation an das normale und schreckliche Amerika bemühte Jude sich seine Träume, Wünsche und seinen heimlichen Größenwahn offenbaren ließ, die er sich nicht eingestand, Lenny Bruce lag stellvertretend für ihn auf der Couch des Psychiaters und ließ für alle die Sau raus, wie es Philip Roth getan hat, der sich in »Portnoys Beschwerden« von den Nachtclubauftritten Lennys inspirieren ließ: »Was ich sagen will, Doktor, ist, daß ich anscheinend meinen Schwanz weniger in diese Mädchen als in ihren Background stecke – als ob ich durchs Ficken Amerika entdecken werde. Amerika erobern werde – das trifft es vielleicht besser. Kolumbus, Kapitän Smith, Gouverneur Winthorp, General Washington – und jetzt Portnoy.«
Was die Sache auch nicht einfacher machte, war seine Heroin-Sucht und die damit einhergehenden depressiven Schübe. Er machte den Eindruck eines Mannes, dem man ziemlich übel mitgespielt hat, was ja auch tatsächlich der Fall war, aber er zeigte es auch dem Publikum. Sein Sketche verloren den Witz, die Originalität, die Spontaneität und die Energie, er las aus Gerichtsakten vor, er verstümmelte alte erfolgreiche Sketche, brach sie vorzeitig ab und war aufdringlich zum Publikum, das er in seine Show zu locken versuchte: »Dirty Lenny in here. Dirty Lenny is going on soon.« Und wenn er seine Show beendete, hörte sich das so an: »And so, because I love you, fuck you and good night.«
Im Juni 1966, wenige Wochen vor seinem Tod durch eine Überdosis, hatte ihn Bill Graham ins Fillmore nach San Francisco eingeladen. »Ich kannte zwar alle seine Platten, aber ich war nicht gerade ein Fan von ihm. Obwohl seine Sachen ziemlich hintergründig und scharfsinnig waren, fand ich, daß er einfach zu lange brauchte, um auf den Punkt zu kommen. Er hat seine Storys regelrecht gemolken. Zuviel Vorspiel. Allerdings fand ich, daß man ihm unrecht tat.« Lenny Bruce erwies sich als ziemlich eigenwillig und sprunghaft, er kam nicht mit dem Flugzeug, mit dem er hätte kommen sollen, und als sie sich dann trafen, war es Feindschaft auf den ersten Blick, denn Lenny brabbelte ständig über das verfickte Auto und den verfickten Verstand Grahams, der ihn wohl verlassen hätte, um sich schließlich an einem Zeitungskiosk absetzen zu lassen, wo noch Licht brannte.
Jim Haynie, der im Fillmore arbeitete, hatte Lenny Bruce schon früher gesehen auf einer Sylvester-Show in Los Angeles, und da »war er nicht nur unglaublich komisch, sondern auch noch beleidigend und witzig – einfach brillant.« Im Fillmore hingegen war es vorbei. »Die Gesellschaft hatte ihn goutiert, verdaut und wieder ausgekotzt. Es war nicht komisch, es war nicht unterhaltsam, es war einfach nur traurig.« Und Peter Berg konnte sich an das panische Gesicht von Bill Graham erinnern, denn Lenny Bruce »war bis obenhin voll mit Amphetaminen. Total fertig. Eine Ruine.«
Frank Zappa und die Mothers of Invention waren als seine Vorgruppe aufgetreten. Zappa war ein großer Bewunderer von Lenny Bruce und bezeichnete ihn sogar als seinen Freund, obwohl er ihn nur an diesem katastrophalen Abend gesehen hat. Er wollte sich seinen Einberufungsbescheid signieren lassen, doch Lenny Bruce lehnte ab. Er hatte keinen Draht zu den Leuten aus der Gegenkultur und den Freaks, die ihn bewunderten, dazu war er nicht nur zu egomanisch, auch das Heroin hatte seinen Anteil daran, daß er sich für wenig mehr als für den weißen Stoff interessierte.
In »The Trials of Lenny Bruce« schreiben Ronald K.L. Collins und David M. Skover, daß Lenny Bruce Zeit seines Lebens »antiestablishment« gewesen sei, ein Außenseiter und Outlaw, und erst seit seinem Tod zum Establishment wurde. Lennys Erfolg war nicht wirklich groß, durch die Prozesse jedoch war mehr aus ihm geworden als ein Geheimtip, mehr als ein verrückter und ordinärer kleiner Itzig, der sich öffentlich über alles und jeden lustig machte, und die an ihn gestellten Erwartungen gerne enttäuschte: »Ich war heute abend nicht sehr lustig. Manchmal bin ich das nicht. Ich bin kein Comedian, ich bin Lenny Bruce.«
Lenny Bruce is dead but he didn’t commit any crime
Nach seinem Tod am 3. August 1966 in Hollywood Hills führte er sein Leben in der populären Kultur fort, er tauchte mit seinen Sketchen in der großen Literatur auf wie bei Don DeLillo und Philip Roth, Bob Dylan widmete ihm die Zeilen, »Lenny Bruce is dead but he didn’t commit any crime / He just had the insight to rip off the lid before its time. / I rode with him in a taxi once, only for a mile and a half, / Seemed like it took a couple of months. / Lenny Bruce moved on and like the ones that killed him, gone.« Er wurde auf dem St. Peppers-Plattencover der Beatles verewigt, wo er hinter Ringo Starr wie ein Geist aufsteigt, und John Lennon, Nico, R.E.M., Chumbawamba, Nuclear Valdez und Grace Slick ließen sich von ihm zu Songs inspirieren. Lenny Bruce hatte großen Einfluß auf Michael O’Donoghue, der beeindruckt davon war, daß er als erster »die Drogen in seine Arbeitsroutine einbezog«, Frank Zappa wollte ein Broadway-Musical über Lenny Bruce machen, und natürlich Abbie Hoffman, der Lenny Bruce sein Buch »Woodstock Nation« widmete.
Abbie erzählt in dieser Widmung eine kleine Geschichte, in der er einen ehemaligen Kommilitonen trifft, der inzwischen Leichenbestatter ist und Abbie fragt, warum die Leute, die Selbstmord begangen haben, immer so ein gewisses Grinsen im Gesicht hätten, das als »THE SHIT-EATIN GRIN« bezeichnet wird, so daß das Bestattungsunternehmen alles mögliche tun müßte, um den Gesichtsausdruck der Leichen seriöser und dem Anlaß der Beerdigung angemessener aussehen zu lassen. »Diese Geschichte«, schreibt Abbie Hoffman, »ist für dich, Lenny, von allen Yippies.«
Nur Hunter S. Thompson mochte Lenny Bruce nicht, was vermutlich daher kam, daß Thompson auf Lenny Bruce vermutlich erst stieß, als der schon abgebaut hatte, falls er überhaupt jemals eine Show von ihm gesehen hat, denn in seiner rücksichtsvollen und charmanten Art fand er, Lenny Bruce hätte festgebunden werden müssen, »und zwar aus keinem anderen Grund als ihn aus dem Weg zu räumen, damit ein Besserer den Ball übernehmen kann«. Und: »Bruce ist ein Schwindler, aber sogar das könnte ich ihm verzeihen, wenn er lustig wäre.« Aber auch Thompson war nicht immer lustig, er vertrug nur die Drogen besser und war so schlau, mit Heroin erst gar nicht anzufangen. Vielleicht wußte er Lenny Bruce auch deshalb nicht sonderlich zu schätzen, weil er die spezifisch jüdische Sozialisation und Atmosphäre innerhalb der jüdischen Gemeinde nicht nachvollziehen konnte und sie ihn auch nie interessiert hat, anders als bei Abbie Hoffman, der in der Lenny-Bruce-Show wahrscheinlich jede Menge Déjà-vus erlebte und genau wußte, wovon Lenny Bruce sprach.
Der von Hunter S. Thompson sehr geschätzte Lionel Olay bezeichnete Lenny Bruce als »unpolitischen Revolutionär«, aber abgesehen von der bewußt gewählten Contradictio in adjecto, es stimmt nicht, denn so wenig er Revolutionär war, so sehr war er politisch, nur nicht in einem vordergründigen Sinn, er war nicht politisch wie es ein Politiker ist, vielmehr transformierte er wie in dem Sketch über die Marines in Norfolk während der Kuba-Krise Politik in Psychologie, d.h. er zeigte, was die Krise im einfachen Mann auslöst und was der tun würde, wenn ihm die Entscheidung überlassen werden würde, nämlich gegen seine eigene Obsession vorgehen, gegen die »Nigger«, die doch nur das eine wollten, während ihm die Kubaner ziemlich egal waren.
In seinem vorletzten Auftritt, von dem ein paar Minuten im Internet zu sehen sind und bei dem er ziemlich sympathisch und verschmitzt dreinguckt, also gar nicht so aufgedunsen, wie von vielen Leuten beschrieben, und in dem er einen sehr souveränen und lockeren Eindruck macht, betritt er die Bühne und schwenkt das Mikro wie ein Weihwasserzepter, um die Gläubigen zu segnen, und dann erzählt er von den Nachstellungen durch die Polizei und wie die Cops quasi die Rolle von Lenny Bruce übernehmen und vor Gericht aufführen, was Lenny Bruce nur in Nachtclubs tut. In gewisser Weise war ihm an dieser Art der Verbreitung seiner »Ideen« mehr gelegen als an der Anerkennung seiner Kollegen, die ihm zu seinem Recht verhelfen wollten, sie ungestört vortragen zu dürfen, womit Lenny Bruce jedoch die Geschäftsgrundlage entzogen worden wäre.
Bei der Lektüre des letzten Absatzes von »Portnoys Beschwerden« wußte ich sofort, das ist auch ein gutes Ende für einen Aufsatz über Lenny Bruce, dem das Buch wie ein Maßanzug paßt, weil in diesem Ende auf eine Weise, für die man keinen Literaturnobelpreis bekommt, die Renitenz und die Kamikazehaltung Lennys zur Welt beschrieben ist, die eben so gar nicht zu seinem nachträglichen Ruf als Streiter für die Freiheit der Rede passen, und wer weiß, vielleicht stammt diese Passage sogar aus einem Sketch von Lenny Bruce: »›Hier spricht die Polizei. Sie sind umstellt, Portnoy. Wir raten Ihnen herauszutreten und ihrer Pflicht gegenüber der Gesellschaft nachzukommen.‹ – ›Die Gesellschaft soll mich am Arsch lecken, du Polyp!‹ – ›Ich zähle bis drei. Sie kommen jetzt raus, und zwar mit erhobenen Händen, oder wir kommen rein und knallen Sie ab wie’n tollwütigen Hund. Eins.‹ – ›Schieß doch, du Scheißbulle, ist mir scheißegal. Ich habe den Rasen betreten ...‹ – ›Zwei.‹ – ›... so lange ich lebte, habe ich wenigstens gelebt!‹«
Die Schönheit der Melancholie
Eine Liebeserklärung an den Mann mit dem schläfrigen Blick Robert Mitchum
»Ich habe ein Schild an meiner Tür: Vertreter, Schauspieler und Agenten unerwünscht. Ich gehe nicht auf Parties, weil mir das Hinkommen oder Weggehen zu anstrengend ist.« Robert Mitchum
Der romantische Verlierer
»In diesem Frühjahr fühlte ich mich zum ersten Mal müde. Daran merkte ich, daß ich alt wurde. Vielleicht lag es an dem miesen Wetter, das wir in Los Angeles hatten, oder an den lausigen Fällen, die ich zu bearbeiten hatte. Meistens jagte ich getürmten Ehemännern hinterher und anschließend hinter ihren Frauen, weil sie nicht zahlen wollten. Vielleicht war ich doch deswegen müde, weil ich wirklich alt wurde. Das einzige, was mir Spaß machte, war Joe DiMaggio zuzusehen, wenn er für die New York Yankees Baseball spielte«, sagt die Stimme Philip Marlowes aus dem Off in der Eröffnungsszene von »Farewell My Lovely«. Robert Mitchum blickt müde aus dem Fenster einer Absteige auf eine Straße in Los Angeles, eine Zigarette qualmt in seinem Mundwinkel, Neonlicht flackert, während sein altes, schlecht rasiertes Gesicht auftaucht und lapidar von der Katastrophe eines Lebens Zeugnis ablegt.
Bevor es den Film überhaupt gab, hat Eric Burdon die trostlose und verzweifelte Atmosphäre dieser Szene in »Hotel Hell« eingefangen, einem intensiven Song mit einer traurigen spanischen Trompete, der von der Einsamkeit eines Mannes handelt, »far away from home«, ein ganz wesentliches mythisches Element in der populären Kriminalliteratur, die Metapher für ein verpfuschtes Leben, weil man aus guten Gründen nie etwas von Familie und Eigenheim hören wollte, aber manchmal eben etwas schwach und sentimental wird. »Alles, was ich anfasse, wird zu Scheiße. Ich habe einen Hut, einen Mantel und eine Kanone. Das ist alles. Ich brauche dringend eine Lebensversicherung und ein Häuschen auf dem Land«, sagt Mitchum später zu Lt. Nulty, aber er weiß, daß dieser Zug für ihn längst abgefahren ist.
Mitchum strahlt eine unendliche Melancholie aus, von der ich sofort ergriffen war, als ich den Film zum ersten Mal sah, denn die Desillusionierung und die Vergeblichkeit, die sich in Mitchums Gesicht widerspiegeln, sind Zustände, von denen ich glaubte, niemand könne sie besser verstehen als ich. Und ich schätze, es gab eine Menge Leute, die das ebenso sahen, jedenfalls Mitte/Ende der Siebziger (der Film kam 1975 in die Kinos), als bereits absehbar war, daß der Aufbruch einer rebellischen Jugend in eine neue Zeit immer mehr unter die Räder des Imperiums geriet, weil diese Jugend sehr deutlich spürte, daß sie keine Chance hatte, nicht mal wenn sie sie nutzte, jedenfalls galt das für diejenigen, die keine Lust hatten, sich auf den langen Marsch durch die Institutionen zu begeben. Das Gefühl, einem repressiven gesellschaftlichen Monolith gegenüberzustehen, der sich keinen Millimeter bewegte und der keine Konzessionen machte, gegen den man dennoch möglichst heroisch bestehen wollte, war der Grund, weshalb die film noirs von Melville oder eben auch »Farewell My Lovely« gerne geguckt wurden, und sie wurden nicht geguckt von Leuten, die Vergnügen dabei fanden, auf den RAF-Fahndungsfotos die Gesichter der Gesuchten durchzustreichen, wenn sie verhaftet oder erschossen worden waren. In diesen Filmen entdeckte man instinktiv eine innere Verwandtschaft zu den Protagonisten, zu den Gaunern, Profis, Private Eyes, zu den Losern, die aus unterschiedlichen Gründen gegen alles waren, was das System repräsentierte, und die aus innerer Überzeugung taten, was getan werden mußte, auch wenn sie dabei Kopf und Kragen riskierten. Wir hatten keine Ahnung, was das wirklich bedeutete, aber es war völlig klar, das waren die coolen Jungs, mit denen man sich identifizieren konnte.
»Farewell My Lovely« war nicht der erste Film, in dem ich Mitchum sah, aber der erste, in dem mir klar wurde, daß ich seinen Namen nie wieder vergessen würde, denn er war die perfekte Verkörperung von Philip Marlowe, besser als ihn sich sogar Raymond Chandler hätte vorstellen können, der sich Cary Grant in der Hauptrolle gewünscht hatte. Aber Grant hätte vielleicht den schnoddrigen Witz Marlowes gut rübergebracht, nicht aber die desillusionierte Müdigkeit, die der für die Rolle eigentlich schon 25 Jahre zu alte Mitchum nicht einmal los wurde, wenn er lachte. Und selbst als er den vertrackten Fall gelöst hatte, ist das kein Anlaß zu triumphalen Gefühlen. Müde winkt er ab und überläßt es Nulty, die Lorbeeren einzuheimsen. Sein Motiv, die Sache zu Ende zu bringen, ist auch nicht der Erfolg, sondern die Rache für einen Toten, weil er weiß, daß er dem Kind des Ermordeten nie wieder würde in die Augen sehen können, wenn er den Mörder laufen ließe. (Ein klassisches Motiv, aber da Marlowe sowohl gegen eine korrupte Polizei als auch gegen verschiedene Gangsterbanden und Politiker, die die Stadt verwalten, zu kämpfen hat, hat er als lonesome hero jedes moralische Recht auf seiner Seite.)
An Mitchum reichte nicht einmal Humphrey Bogart heran, der bis dahin als der beste Marlowe-Darsteller galt. Dessen Rolle war zu eindimensional angelegt. Bogart war noch zu sehr der tough guy aus den Pulp-Heften, und man sah ihm deutlich das schwarz-weiße Weltbild Hollywoods in den vierziger Jahren an, in dem diese Filme entstanden. Bogart war ein Getriebener, der die Ordnung der Welt wieder herstellen wollte, ihm fehlte völlig die Dimension der Verzweiflung und die im Whiskeynebel einer verrauchten Bar aufsteigende Melancholie. Bei Mitchums schläfrigen Augen wußte man, daß sie alles schon einmal gesehen hatten, eher sogar zweimal. Aber er war deshalb noch lange nicht abgestumpft. Wenn er sich jedoch gegen das Verbrechen stemmte, dann schon lange nicht mehr, um die Welt zu verbessern, sondern um vor sich selber zu bestehen.
Mitchum spielte nicht anders als in anderen Filmen, aber hier hatte er vielleicht zum ersten Mal seine Rolle gefunden, hier war er zum ersten Mal identisch mit ihr. Er mußte Marlowe nicht spielen. Er war Marlowe. Es war die Rolle, die ihm wie ein Maßanzug paßte. Wo Bogart schauspielerisch alle Hebel in Bewegung setzte, reichte die Bühnenpräsenz Mitchums, um die Rolle auszufüllen. »Mitchum war ein Außenseiter, der die Pose des Rebellen einnahm« (Michael Althen), d.h. er brauchte diese Haltung nicht spielen, es war sowieso seine Haltung, die er Zeit seines Lebens eingenommen hat.
Als wild boy unterwegs
Für diese rebellische Haltung gab es jede Menge gute Gründe. Seinen Vater hat der am 6. August 1917 geborene Robert Mitchum nie kennengelernt. Als er 18 Monate alt war, wurde der von schottisch-irischen Einwanderern und Indianern abstammende James Mitchum, der als Bremser bei der Eisenbahngesellschaft arbeitete, in Charleston/South Carolina von zwei riesigen Puffern zerquetscht. Sein Stiefvater, den seine Mutter zehn Jahre nach dem Unfall heiratete, war ein ehemaliger Abenteurer, und Onkel Willi, sein Vaterersatz, war früher mal Profi-Catcher gewesen. Und dann kamen die Jahre der Depression. Bob war schon viel herumgekommen als er in New York City auf die Schule kam. »Immer wieder neue Umgebung, neue Jungs, gegenüber denen man sich als Neuankömmling behaupten mußte. Seine Methode war: Nicht mehr als nötig reden, allenfalls fluchen, ansonsten überraschend zuschlagen und keiner Keilerei aus dem Weg gehen.« (Michael Althen) Mitchum war damals schon der »Loner mit dem Tough-Guy-Gehabe«.
Mit 14 bereits heuerte er auf einem Bergungsschiff der Fall-River-Linie an und die folgenden Jahre durchquerte er mit dem Zug mehrmals den Kontinent, eine Landschaft der Verzweiflung und der Gewalt. Er war als Hobo unterwegs, der gerne als letzter großer Abenteurer und als Ritter der Straße gefeiert wurde. In Wirklichkeit war Mitchum Teil einer ziellosen Migration verarmter Jugendlicher, von denen schätzungsweise eine Viertel Million auf Achse war, die sogenannten »wild boys«, die immer auf der Hut vor den sogenannten »Shagmen« sein mußten, die im Auftrag der Eisenbahngesellschaft die Züge von Schwarzfahrern säuberten und dabei nicht zimperlich vorgingen. Nicht selten blieb ein armes Schwein tot auf den Schienen liegen. Der junge Mitchum lernte schnell, worauf es ankam, aber irgendwann verließ ihn das Glück und er wurde in Savannah/Georgia festgenommen. Man wollte ihm einen Raubüberfall anhängen, und als das nicht klappte, verurteilte man ihn wegen Landstreicherei zur Zwangsarbeit in einer »chain gang«, d.h. er wurde nachts und während des Transports am Fuß angekettet und zu Straßenausbesserungsarbeiten eingesetzt. Nach einer Woche gelang es ihm, in den nahe gelegenen Wald zu flüchten. »Damals hätte keiner auch nur 50 Cents ausgegeben, um dich zu fangen, wenn sie dich mit dem Gewehr verpaßt hatten. Sie zogen lediglich aus und fingen sich irgendeinen anderen ein, der deinen Platz in der chain gang einnahm.«
Als Bob zwischendrin mal wieder zu Hause auftauchte, lernte er Dorothy Spence kennen, die er später heiratete und mit der er sein ganzes Leben zusammen war. Eine Zeitlang schlug er sich als Preisboxer durch, aber als er an einen erfahrenen Gegner geriet, der ihn übel zurichtete, hörte er wieder auf.
Über seine Schwester Julie, die eine Schauspielerausbildung machte und als Sängerin arbeitete, ergaben sich die ersten Kontakte zur Bühne. Bei Victor’s, einem Laden auf dem Sunset Boulevard, hielt er Hof. »The clientele was a mixture of fallen stars, extras, party girls, stuntmen, starlets, hookers, hustlers, johns and dealers. It was said to be a place where anything could be had for a price.« (George Eells)
Mitchum schrieb auch: kleine Stücke und Stories, von denen eine sogar in einer literarischen Vierteljahreszeitschrift veröffentlicht wurde. Worauf andere möglicherweise in ihrer Biographie stolz hingewiesen hätten, kommentierte Mitchum gnadenlos abfällig: »Ein Stück Scheiße mit ein oder zwei guten Stellen. Ich dachte vermutlich, ich würde der Liebling der literarischen Frauenzirkel werden, und sie würden mir auf den Hintern klopfen und meine Texte mit tiefsinnigen Bedeutungen versehen, die sie nie hatten und von denen ich nichts wußte.« Vom Astrologen Carroll Righter wurde er als Fahrer und Hilfskraft auf einer kleinen Ostküstentournee angestellt. Er verscherbelte nach den Auftritten seines Chefs alten Damen ihre persönlichen Horoskope. Von Florida aus fuhr er nach Delaware, wo ihm Dorothy Spence vorschlug: »Ich glaube, du bist nicht in der Lage, weiterhin allein gelassen zu werden. Ich schlage vor, wir heiraten.« Und das taten sie dann auch. Er versuchte über die Runden zu kommen, indem er ein paar kleinere Engagements annahm, aber als das nicht ausreichte, arbeitete er an einer Stanzmaschine in der Lockheed-Flugzeugfabrik. Der Job bekam ihm nicht. Er litt an starken Schlaf- und Sehstörungen und mußte trotz dringender Geldsorgen hinschmeißen. Obwohl er nur Verachtung für die Schauspielerei übrig hatte, versuchte er sein Glück beim Film.
Ein Nichtschauspieler in Hollywood
Das war 1943, und in diesem Jahr spielte er bereits in 19 Western, Kriegsfilmen und Serien mit. Er mußte einfach nur durch das Bild gehen und ab und zu mal ein paar Sätze sagen. Und er sah verdammt gut aus. Vielleicht blieb er aus diesem Grund nicht unbemerkt, jedenfalls nicht für MGM, Universal und 20th Century-Fox, für die er arbeitete. Mitchum witzelte: »Ich war nun ein Charakterdarsteller, und ich spielte fast alles – chinesische Wäschereibesitzer, Zwerge, irische Waschweiber, Schwuchteln. Ich spielte sogar einmal einen Journalisten.« Das »sogar einmal« ist sehr lustig, und Mitchum fügte hinzu: »Ich weiß nicht, wie’s war, ich hab den Film nie gesehen.« Und dabei blieb er nach eigenen Aussagen bis zum Schluß.
»RKO machte mit mir zehn Jahre lang den gleichen Film. Sie waren sich so ähnlich, daß ich in sechs von ihnen denselben Anzug und denselben Burberry-Trenchcoat trug. Sie machten aus mir eine männliche Jane Russell. Ich war ihr Belegschaftsheld; also wollten sie von mir, daß ich in den Filmen ein paar Kleidungsstücke ablege. Ich war dagegen und legte ein bißchen Gewicht zu, so daß ich wie ein bulgarischer Ringer aussah, wenn ich mein Hemd auszog. Ich beschwerte mich, und sie gaben unverhohlen zu, daß sie eine bestimmte Menge Schrott zu verkaufen hätten und ich ihr Mann dafür sei.« Und tatsächlich ragen nur wenige Filme aus der Flut von B-Movies heraus, die der Rede wert sind. Das lag nicht an Mitchum, da Mitchum in jedem Film einfach er selbst war, und ansonsten die Sätze sprach, die im Script standen. Und wenn er sich prügeln mußte, dann prügelte er sich eben. Überhaupt gab es für Mitchum nur zwei »acting styles«: Einen mit Pferd und einen ohne. Er hatte absolut nicht den Ehrgeiz, dem Regisseur Vorschläge zu machen, wie man etwas verbessern könnte.