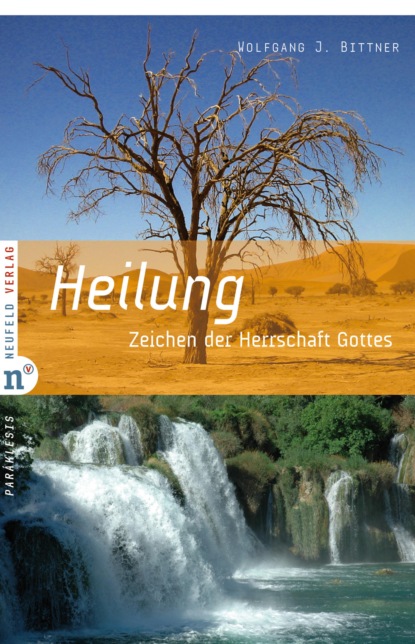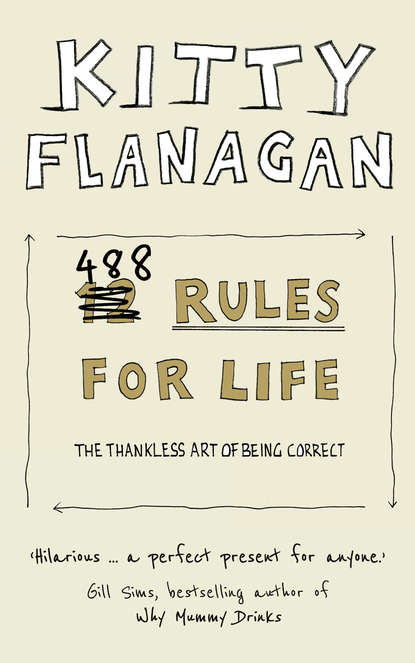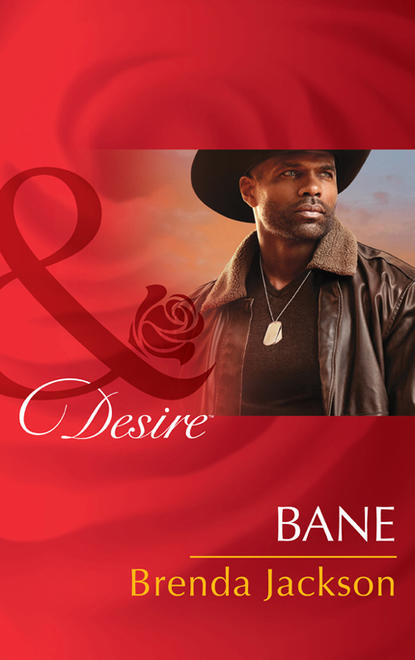- -
- 100%
- +
Jesu heilendes Handeln greift nicht bloß die Krankheit an, sondern greift hinter sie zurück und bindet die Mächte, die hinter dieser Krankheit stehen. Erst dadurch wird ein Mensch wahrhaft frei. Es zeigt sich erneut, dass die Heilungen ein Teil seines Kampfes gegen den Bösen sind, der sich aufgemacht hat, die gute Schöpfung Gottes zu zerstören. Jesus bringt die Herrschaft Gottes, die neue Schöpfung.
3.8. Warum heilte Jesus am Sabbat?
Die bisher gewonnenen Einsichten können uns zu einer Antwort hinleiten, warum Jesus ausgerechnet am Sabbat geheilt hat. Für den Sabbat galt ja, vom biblischen Gebot her, das Arbeitsverbot. Heilen aber fiel als Tätigkeit des Arztes unter die Liste der Arbeiten, die am Sabbat gemieden werden mussten. Man muss sich ja tatsächlich fragen, warum denn Jesus bei der Frau, die achtzehn Jahre vom Satan gebunden war, nicht noch einen Tag zugewartet und so das religiöse Gefühl der Menschen geschont hat. Genau so empfiehlt es ja der Synagogenvorsteher: »Sechs Tage gibt es, an denen man arbeiten soll; an diesen nun kommet und lasset euch heilen und nicht am Sabbattag!« (Lukas 13,14). Nach pharisäischer Anschauung befreite konkrete Lebensgefahr vom Arbeitsverbot. Aber das lag bei den Sabbatheilungen Jesu in keinem Fall vor. Jeder der Geheilten hätte, so denken wir, gut noch einen Tag warten können. Warum hat Jesus gerade am Sabbat geheilt?
Das rechte Verständnis scheint sich von dem alttestamentlichen Wort her zu ergeben, das wir schon betrachtet haben, von Jesaja 61,1f her. Die Botschaft, die der Gesalbte, der Messias auszurichten hat, wird dort mit dem Ausdruck »Gnadenjahr des Herrn« zusammengefasst. Was ist damit gemeint?
Israel kannte eine eigenartige soziale Vorschrift, das Sabbatjahr und das Jubel- oder Erlassjahr.41 Jedes siebte Jahr sollte der Ackerboden ruhen, also »dem Herrn einen Sabbat feiern« (Levitikus 25,2). Der hebräische Ausdruck Sabbat bedeutet ja »Ruhe«. Nach sieben Sabbatjahr-Perioden soll dann das fünfzigste Jahr als umfassendes Erlösungsjahr ausgerufen werden. Der Besitz, den die Armen hatten verkaufen müssen, wurde wieder zurückerstattet. Ja, die Israeliten, die durch Verarmung sich selbst und ihre Familien als Knechte hatten verkaufen müssen, wurden wieder frei. Der Grundgedanke war, dass damit der alte, ursprüngliche Zustand wieder hergestellt wird. »In diesem Halljahr sollt ihr ein jeder wieder zu seinem Besitz kommen« (25,13). Schulden sollen nicht endgültig sein! Verlust des Besitzes der Väter, es ging dabei vor allem um den Grundbesitz, durfte nicht die alte, von Gott gegebene Ordnung außer Kraft setzen. Es gibt ein Jahr, in dem die alte Ordnung wieder hergestellt wird. »So sollt ihr das fünfzigste Jahr weihen und Befreiung ausrufen im Lande für alle, die darin wohnen; als Halljahr soll es euch gelten. Da sollt ihr ein jeder wieder zu seinem Besitz und ein jeder wieder zu seinem Geschlecht kommen« (25,10). Das ist es, was Jesus in der Synagoge von Nazareth als Freudenbote ausruft, wenn er den Jesajatext vorliest. Nun ist »Erlassjahr«, das Gnadenjahr des Herrn. Es ist das Jahr, in dem man wieder zur Ruhe kommen soll, zum »Sabbat« findet und wo Ordnung in unsere menschlichen Verhältnisse kommen wird. Auf diesen großen »Sabbat«, diese große Ruhezeit wartete man in Israel,42 denn dann sollte auch im Verhältnis zwischen Gott und Mensch die alte Ordnung wieder einkehren. Dieses »Erlösungsjahr« war nach den Worten Jesu angebrochen: Jetzt ist es soweit (Lukas 4,21). Die Heilungen Jesu erweisen, dass nun wirklich die »Befreiung im Lande« (Levitikus 25,10) beginnt. Nun wird gelöst, was bisher gebunden war. Die alte Ordnung wird wieder hergestellt. Wahrhaftig, die Schuld erweist sich als nicht endgültig.43
Damit allein wäre aber nicht erklärt, warum Jesus gerade am Sabbat geheilt hat. Hätte er nicht erst recht am Sabbat ruhen sollen, wenn er doch den alten Zustand der Schöpfung wiederbringen wollte? Eine letzte Antwort darauf zu geben, ist wohl nicht möglich, da die Texte des Neuen Testamentes diese Frage nicht eingehend behandeln. Eine Stelle jedoch enthält zumindest einen leisen Hinweis. Bei der Heilung der Frau mit dem krummen Rücken sagt Jesus: »Musste sie nicht am Sabbattag von dieser Fessel befreit werden?« (Lukas 13,16). Ist es gerade der Sabbat, an dem geheilt werden muss? Dem, was uns die Evangelisten über die Wirksamkeit Jesu erzählen, scheint das durchaus zu entsprechen.
Liegt die Antwort auf unsere Frage in der Schöpfungsgeschichte? Bei der Erwähnung des ersten Sabbats sagt der Text etwas Merkwürdiges. »Und Gott vollendete am siebenten Tage von all seinem Werk, das er gemacht hatte … « (Genesis 2,2). Wir würden doch denken, Gott habe an sechs Tagen die Welt geschaffen, also sein Werk auch in diesen sechs Tagen vollendet. Am siebten Tag habe er sich davon nur noch ausgeruht. Aber das sagt der Text nicht. Gott hat am siebten Tag nicht einfach geruht, sondern in dieser Ruhe über seinem Werk vollendete Gott dieses sein Schöpfungswerk. Vollenden heißt nicht »fertig machen«, sondern über dem, was fertig geworden ist, »zur Ruhe kommen«. Die Vollendung der Schöpfung, die darin besteht, dass Ruhe einkehrt, ja dass Gott selbst darüber zur Ruhe findet, vollzieht sich am Sabbat. Wenn Jesus also die Schöpfung vollenden, die alte Ordnung Gottes wiederherstellen will – und gerade das geschieht ja in seinen Heilungen –, dann gibt es dafür im Grunde nur einen Tag: den Sabbat. Das würde auch erklären, wie stark Jesus in solchem Handeln den Platz Gottes für sich in Anspruch nimmt, ja das Urteil der Menschen mit Recht hervorruft, er würde sich an die Stelle Gottes setzen (vgl. Johannes 5,17f).
3.9. Wie heilte Jesus?
Die Berichte der Evangelien zeigen eine große Vielfalt der äußeren Form des Heilens. Jesus heilt durch bloßes Befehlswort (Bedrohungen!), die manchmal auch mit körperlichen Berührungen44 verbunden sind. Relativ oft kommt es zur Handauflegung. Auch andere Formen, z. B. das Berühren der Augen des Blinden45 bzw. der Ohren und der Zunge beim Taubstummen46 werden uns berichtet. Es kommt jedoch auch zu Heilungen, indem Menschen von sich aus Jesus berühren.47 Die zehn Aussätzigen dagegen werde geheilt, »indem sie hingingen«.48 Auch Fernheilungen werden berichtet, bei denen der Kranke überhaupt nicht anwesend ist. Von den Jüngern hören wir von Salbungen mit Öl,49 die zur Heilung führen. Überblickt man die verschiedenen Formen, wird deutlich, dass es keine einheitliche »Methode« Jesu gibt. Heilung ist nicht Frage einer Methodik.
Bemerkenswert bleibt jedoch, dass Jesus im Unterschied zu den Heilpraktikern seiner Zeit keine Beschwörungsformeln vollzog. Von ihm werden auch keine bindenden Austreibungs- oder gar Zauberformeln überliefert, die es sonst in seiner Umwelt in reichem Maß gegeben hat.50
3.10. Wen heilte Jesus?
Es ist auffallend, wie das Neue Testament an vielen Stellen betont, dass Jesus alle, die zu ihm kamen, geheilt hat. An keinem hat seine Macht zu heilen versagt. Und keinen, der sich um Hilfe an ihn wandte, hat er mit einem anderen Bescheid von sich gewiesen. So sagt Matthäus: »und er heilte alle Kranken« (8,16). Bei Lukas heißt es in der Parallele: »Jedem von ihnen legte er die Hände auf und heilte sie« (Lukas 4,40; vgl. Apostelgeschichte 10,38: »… und er heilte alle, die vom Teufel überwältigt waren«).50 Bemerkenswert ist auch, dass Jesus keinen der Vorbehalte je gebraucht hat, mit denen wir oft zur Frage nach Heilung Stellung nehmen. Keinen Menschen, der mit der Bitte um Heilung zu ihm kam, hat Jesus mit einem anderen Bescheid weggesandt. Er heilte alle. Er hat auch niemand ärgerlich angefahren, als ob die Bitte um Heilung irgendwie ungehörig wäre. Jesus hat auch nie gemeint, mit der Bitte um körperliche Wiederherstellung bitte man um etwas Nebensächliches, das einem den Blick auf das Erstrangige, das Heil der Seele, verstellen würde.51
Das ganze Bündel unserer »Vorbehalte«, das Jesus offensichtlich nicht gekannt hat, muss noch besonders besprochen werden. Es kommen hier Probleme zur Sprache, die zum Teil eine lange Geschichte haben und die in der Seelsorge immer wieder auftauchen.52 Halten wir aber bereits fest: Jesus hat alle Kranken geheilt, die zu ihm gebracht wurden oder selbst zu ihm kamen. Jesus hat nie eine Krankheit als von Gott zu irgendwelchen Erziehungszwecken verordnet bezeichnet. Jesus hat nie gesagt, Krankheit könne einem Menschen zum Segen werden. Jesus hat sich zwar der Krankheit direkt voll Ärger zugewandt, aber nie einem Kranken, der sich um Heilung an ihn gewandt hat. Jesus hat die Bitte um Heilung auch nie als Bitte um etwas Zweitrangiges bezeichnet.
Man könnte diese Liste weiterführen. Sie sollte uns auf jeden Fall zu denken geben. Warum äußern wir solche Vorbehalte oft so schnell? Warum sind sie uns so geläufig?
3.11. Heilung von Krankheit und das Heil Gottes53
Bedeutet die Betonung der Krankenheilung nicht ein Ablenken vom wahren Auftrag Jesu, vom eigentlichen Anliegen der Kirche, den Menschen das Heil Gottes zu bringen? Kann sich die Frage nach der Heilung, nach der körperlichen Gesundheit nicht konkurrenzierend vor die wichtigere Frage nach dem Heil schieben? Stehen wir nicht in Gefahr, aus Zweitrangigem Erstrangiges zu machen?
Auszugehen haben wir von der Feststellung, dass Gott den Menschen zu dessen Heil sucht. So einfach sich das sagen lässt, so wenig selbstverständlich ist es. Gott sucht nicht bloß die Seele des Menschen. Er hat ihn in der Ganzheit von Leib und Seele erschaffen. Dem Menschen in dieser seiner Ganzheit wendet er sein Heil zu. Wenn Gott uns Menschen in Jesus Christus, seinem Sohn, sein Heil schenkt, dann bedeutet das, dass er uns aus der Verfallenheit an all das Böse, in dem wir stehen, herauslöst. »Heil«, das ist Gottes entschlossenes Nein zum Bösen in allen seinen Erscheinungsformen und allen seinen Auswirkungen.
So zeigt es uns schon der wichtige Text Jesaja 53, der neben anderen Texten dem Selbstverständnis Jesu zugrundeliegt. Gesprochen wird vom »Knecht Gottes«, der stellvertretend für die Menschen stirbt. »Er war durchbohrt um unserer Sünden und zerschlagen um unserer Verschuldungen willen« (5 a). Das Böse wird wurzelhaft in der Schuld des Menschen vor Gott erkannt. Das ist jedoch nur eine Seite, wie der Text selbst zeigt. Einen Vers vorher lesen wir: »Doch wahrlich, unsere Krankheiten hat er getragen und unsere Schmerzen auf sich geladen …« Und einen Vers später steht: »… und durch seine Wunden sind wir geheilt«. Die Vergebung der Schuld wird von der Heilung der Krankheit gleichsam eingerahmt, so als wollte uns die Bibel zeigen, dass von Gott her die Schuldfrage völlig in die Frage nach der Heilung unseres ganzen Menschseins eingebettet ist. Dieser Zusammenhang wird von Gott in seinem Handeln für uns auch beachtet.
Die Wirksamkeit Jesu bestätigt diesen Zusammenhang. Matthäus bezeichnet ausgerechnet die Heilungen Jesu als Erfüllung dieser Jesajastelle (Matthäus 8,16–17). Heil und Heilung sind für die Bibel eine unlösbare Einheit. Weil Gott unser Heil will, weil er dabei uns Menschen als ganze meint, will er, dass wir an Geist, Seele und Leib heile Menschen werden. »Auch in Bezug auf den Leib ist nicht Sünde, sondern Erlösung und Heil das letzte Wort« (Bernhard Häring).54 Unsere Bedenken, die Frage nach der Heilung würde vom »Eigentlichen«, dem Heil der Seele, wegführen, machen eines deutlich: In unserer Auffassung vom Menschen trennen wir das, was von Gott her so unlösbar zusammengehört. Dieses Denken hat in der Geschichte der Christenheit eine lange und problembeladene Vorgeschichte.54a Wir stehen in einer Tradition, die bis heute dazu neigt, den Leib des Menschen abzuwerten, ja als »Gefängnis der Seele« aufzufassen.55 Die Rückbesinnung auf die Bibel muss uns auch hier helfen, den rechten Maßstab für unser Menschsein zu finden.
4. Krankenheilung durch Jünger und Gemeinde
4.1. Heilen als Auftrag an die Jünger
Die ersten drei Evangelien berichten von der Berufung und Aussendung der Jünger Jesu. Markus trennt zeitlich zwischen der Auswahl der Zwölf durch ihren Herrn und der späteren Aussendung. Zunächst heißt es: »Und er bestimmte die Zwölf, damit sie um ihn wären und damit er sie aussenden könnte zur Predigt (des Evangeliums) und mit der Macht, Dämonen auszutreiben« (3,13ff). Die Aussendung erfolgt erst später (6,7ff). Über die Durchführung dieses Auftrages durch die Jünger hören wir: »Da zogen sie aus und predigten, man solle Buße tun, und trieben viele Dämonen aus, salbten viele Kranke mit Öl und heilten sie« (6,12). Die Parallele dazu finden wir bei Matthäus (10,5ff). Dort heißt es: »Wenn ihr aber hingeht, so prediget: ›Das Reich der Himmel ist genaht.‹ Heilet Kranke, wecket Tote auf, machet Aussätzige rein, treibet Dämonen aus.« (17,7f). In der Lukasparallele (9,1f) wird der Auftrag in die zwei Weisungen zusammengefasst: »… und er sandte sie aus, das Reich Gottes zu predigen und zu heilen.«
Lukas ist es, der uns über die Aussendung der zwölf Jünger hinaus von der Aussendung des größeren Jüngerkreises der siebzig berichtet (10,1ff): »Und wo ihr in eine Stadt kommt und sie euch aufnehmen, da esset, was euch vorgesetzt wird, und heilet die Kranken, die darin sind und saget zu ihnen: ›Das Reich Gottes ist zu euch genaht!‹« (10,8f).
Es ist unübersehbar: Den Jüngern wird nie der Auftrag erteilt, nur zu predigen. Der Auftrag wird immer in mindestens zwei Grundelemente zerlegt. Verkündiget und heilet! Das Reich Gottes soll den Menschen in der helfenden, befreienden Tat und im verkündigten Wort nahe kommen. Dieser Auftrag wird nicht nur gegeben, sondern nach dem durchgängigen Zeugnis der Texte auch in dieser doppelten Weise ausgeführt.
Zunächst gilt dieser Auftrag nur den zwölf bzw. den siebzig Jüngern. Wir haben das sehr ernst zu nehmen. Die Texte sagen nichts davon, dass der Auftrag später einmal auf andere Personen erweitert werden soll. Auch findet sich keine Notiz, dass er irgendwie über die unmittelbare Sendung hinaus zeitlich fortdauern soll. Alle erwähnten Texte beinhalten zunächst eine personelle Eingrenzung und eine zeitliche Beschränkung.
So müssen wir danach fragen, ob es im Neuen Testament Spuren davon gibt, dass dieser Auftrag über den zunächst engen Kreis hinaus erweitert wurde. Nur dann haben wir theologisch das Recht, aber auch die Verpflichtung, in diesen Texten nach der Grundlage für den Auftrag unserer heutigen Kirche zu fragen.
4.2. Der Auftrag geht weiter
Eine Reihe wichtiger Texte sowohl aus den Evangelien, der Apostelgeschichte wie in den neutestamentlichen Briefen zeigen uns folgendes: Der zunächst auf den engen Jüngerkreis beschränkte Auftrag wurde als Auftrag des erhöhten Herrn an die ganze Gemeinde verstanden und von ihr auch ausgeführt.56
4.2.1. Der Missionsbefehl nach Matthäus (28,18–20)
Der Text setzt damit ein, dass den elf Jüngern die Rechtsstellung ihres Herrn klar gemacht wird: »Mir ist alle Vollmacht sowohl im Himmel wie über die Erde [von Gott] gegeben« (18; vgl. dazu Offenbarung 12,10). Erst darauf folgt die Aussendung der Jünger: »Gehet hin und machet alle Völker zu Jüngern …« Mission bedeutet, dass die Völker in den Jüngerkreis eingereiht werden sollen. Das bedeutet etwas anderes, als dass die Völker zu »Glaubenden« gemacht werden sollen. Dann wäre zwischen den Jüngern, denen der Auftrag zu verkünden und zu heilen gilt, und den übrigen, die durch ihren Dienst zu Glaubenden werden, eine Scheidewand aufgerichtet. Das aber soll vermieden werden: Der Glaubende soll ein Jünger, ein Schüler Jesu werden. So fährt der Text weiter: »… und lehret sie alles halten, was ich euch befohlen habe.« Was ist es denn, was Jesus seinen Jüngern befohlen hatte? Nach der herkömmlichen Auslegung sind damit die Gebote der Bergpredigt (Matthäus 5–7) gemeint. Das trifft sicher zu. Aber kann dieses Wort Jesu ausschließlich die Bergpredigt meinen? Offensichtlich verweist doch dieser Aussendungstext auf die frühere Aussendung der Jünger in Kapitel 10. »Gehet …, prediget und heilt«, so hatte Jesus zu ihnen gesprochen (10,5ff). Sicher, die anderen Anweisungen Jesu an die Jünger, die sich im Evangelium finden, sind hier nicht ausgeschlossen. Die Bezugnahme auf die erste Aussendung bleibt jedoch auffallend. Die dort gegebene Beschränkung der Sendung – »gehet hin zu den verlorenen Schafen des Hauses Israel« – wird nun bewusst aufgehoben: »Gehet hin und machet alle Völker zu Jüngern.« Der Missionsbefehl nimmt den Auftrag zu predigen und zu heilen auf und gibt ihn an die Menschen, die durch den Dienst der Jünger zu Glaubenden werden, weiter. Das Besondere ist die Erweiterung des »geographischen« Geltungsbereiches der Sendung.
Exkurs: Zum Zusammenhang von vor- und nachösterlicher Sendung
Dass zwischen den Aussendungsreden Matthäus 10 und 28 ein enger Zusammenhang besteht, ist für das Verständnis grundlegend. Nur wenn er aufzuzeigen ist, dann können Anweisungen, die mit der Sendung von Kapitel 10 gegeben waren, auch für die erneute Sendung von Kapitel 28 Geltung haben. Dieser enge Zusammenhang soll darum hier näher aufgezeigt werden. Betrachtet man die Texte, dann fällt zunächst der verschiedene geographische Horizont der Sendungen ins Auge. Beide setzen betont mit der Angabe dieses Horizontes ein: »Gehet nicht auf eine Straße der Heiden und gehet nicht in eine Stadt der Samaritaner, sondern gehet vielmehr zu den verlorenen Schafen des Hauses Israel«, lesen wir in Matthäus 10,5f. Auch im Bericht der Heilung der Tochter der kanaanäischen Frau lesen wir von einer klaren Beschränkung der Sendung Jesu, die im Sprachgebrauch eng an Matthäus 10 anschließt: »Ich bin nur zu den verlorenen Schafen des Hauses Israel gesandt« (15,24). Parallel dazu setzt 28,19 ein, erweitert aber den Horizont der Sendung: »Gehet also hin und machet zu Jüngern alle Völker.«
Wir stehen vor folgender Situation: Jesus bezeichnet für sich und seine Jünger vor Ostern ausdrücklich nur Israel als Raum seiner Sendung. Nach Ostern aber wird der Raum erweitert; allen Völkern gilt die Sendung der Jünger. Gibt es dafür eine Erklärung? Zunächst müssen wir uns klar machen, wie man diese Frage zu stellen hat. Steht hinter der klaren Abgrenzung der einen Sendung in zwei geographische Geltungsbereiche ein bewusstes Nachdenken Jesu bzw. der Gemeinde, dann muss unsere Frage eine Frage an das Alte Testament sein. Denn dort hat Jesus, dort hat die Gemeinde den Willen Gottes für ihre Sendung vernommen. Unsere Frage muss also lauten, ob es in unserem Alten Testament dafür einen Hinweis gibt, der für die Sendung Jesu und der Gemeinde wichtig war und der gleichzeitig einen Hinweis auf eine geographische »Neuordnung« bzw. »Umordnung« der Sendung geben kann. Mit dieser präzisen Fragestellung finden wir zu Jesaja und zum sogenannten zweiten Lied vom Knecht Gottes. Es scheint so zu sein, dass die Texte vom Knecht Gottes (vor allem Jesaja 42,1–4[5–9]; 49,1–6[7–9]; 50,4–9; 52,13–53,12) für das Verständnis Jesu und des Weges der frühen Christenheit von nicht zu überschätzender Bedeutung gewesen sind. Jesaja 42,1–4 spricht von der Berufung des Knechtes und nennt den Geltungsbereich seiner Sendung: »auf Erden … die fernsten Gestade …«. Jesaja 49,1–6 greift die Frage des »geographischen« Geltungsbereiches auf und führt sie weiter. Der Text betont, dass die Sendung zunächst nur Israel gegolten habe: »… um Jakob zu ihm zurückzubringen und Israel zu ihm zu sammeln … um die Stämme Jakobs aufzurichten und die Geretteten Israels zurückzubringen …« (Jesaja 49,5.6). Diesen Auftrag führt der Knecht offensichtlich aus, aber er scheitert daran: »Umsonst habe ich mich gemüht, um nichts und nutzlos meine Kraft verzehrt …« (Jesaja 49,4). Auf dieses Scheitern der Sendung des Knechtes, die betont nur Israel gilt, antwortet Gott aber damit, dass er den »geographischen« Bereich der Sendung neu ordnet: »Zuwenig ist es, dass du …; so will ich dich denn zum Lichte der Völker machen, dass mein Heil reiche bis an das Ende der Erde« (Jesaja 49,6).
Wir haben in Jesaja 49,1–6 die Sendungsstruktur vor uns, die uns im Verhältnis von Matthäus 10 und 28 ausdrücklich wieder begegnet. Am Anfang steht die Sendung, die nur Israel gilt, nicht aber über Israel hinausgeht. Sie führt jedoch zum Scheitern – und das ausgerechnet an Israel selbst. Angesichts dieses »Scheiterns« aber geschieht das Erstaunliche. Gott selbst erweitert die Sendung: »… so will ich dich denn zum Licht der Völker machen, dass mein Heil reiche bis an das Ende der Erde.«
Die Deutung der Sendung Jesu und der Gemeinde von Jesaja 49,1–6 her findet sich nicht nur bei Matthäus. Paulus spricht davon, das Evangelium gelte »den Juden zuerst und auch den Griechen« (Römer 1,16). Reflektiert wird dieser Umstand von Lukas in der Apostelgeschichte dargestellt (Apostelgeschichte 13). Der Dreiklang: Sendung an Israel, Scheitern an Israel, Sendung zu den Heiden wird ausdrücklich mit einem Zitat aus Jesaja 49,6 begründet (Apostelgeschichte 13,47). Das Wort Gottes an seinen »Knecht« wird dabei nicht auf Jesus gedeutet, sondern als Anweisung für die Mission verstanden, in der auch Paulus und Barnabas stehen. »So hat uns der Herr geboten: ›Ich habe dich zum Licht der Heiden gesetzt, damit du zum Heil gereichest bis an das Ende der Erde.‹« Breit ausgefaltet begegnet uns dieses Verständnis der Sendung des Evangeliums bei Paulus in Römer 9–11.
Für unseren Zusammenhang ist folgende Einsicht wichtig. Es handelt sich hier nicht um zwei Sendungen, die zusammenhanglos aufeinander folgen. Es ist dieselbe Sendung, die in zwei Etappen erfolgt, welche sich vor allem durch die Neuordnung des Geltungsbereiches dieser Sendung voneinander unterscheiden. Das bedeutet für die Exegese von Matthäus 28, dass die inhaltliche Füllung der Sendung aus Matthäus 10 mit zu berücksichtigen ist. Matthäus 28 erwähnt nicht alle Elemente der Sendung, sondern lediglich die, welche ausdrücklich über die erste Sendung hinausgehen.
Als Beleg dafür, dass in der urchristlichen Sendung Elemente der vorösterlichen Sendung durchgehalten wurden, mag die Diskussion in 1. Korinther 9 dienen. Paulus weist auf das anerkannte »Recht« hin, von der Verkündigung des Evangeliums zu leben, ohne nebenbei arbeiten zu müssen. Dieses Recht war in der urchristlichen Mission anerkannt und allgemein auch in Anspruch genommen worden (9,4). Paulus weist daraufhin, dass es sich dabei um eine »Verordnung« handelt, die von Jesus selbst stammt: »So hat auch der Herr denen, die das Evangelium verkündigen, verordnet, vom Evangelium zu leben« (9,14). Diese Verordnung finden wir aber gerade nicht im Missionsbefehl. Es ist ein Element der vorösterlichen Sendung, das uns in der Sendung der 12 Jünger bei Matthäus (10,10 b) und der siebzig Jünger bei Lukas (10,7) begegnet. Es hatte für die nachösterliche Sendung weiterhin und unumstritten Geltung. Paulus anerkennt dieses Recht, nimmt aber für sich eine Ausnahmeregelung in Anspruch, die ausdrücklich begründet wird (9,12 b).
4.2.2. Der Missionsbefehl nach Markus (16,15–20) 57
In anderer Weise und mit anderen Begriffen bringt Markus denselben Sachverhalt zum Ausdruck. »Gehet hin in alle Welt und prediget das Evangelium allen, die erschaffen sind!« (Vers 15). Das Ziel dieses Verkündigungsdienstes ist, dass die Menschen zum Glauben kommen.
Man könnte nun, den Matthäustext im Ohr, denken, dass hier doch eine Unterscheidung zwischen den beauftragten Jüngern und den durch die Jünger gewonnenen Glaubenden aufgerichtet wird. Dem ist aber nicht so, denn Markus fährt fort: »Denen aber, die gläubig geworden sind, werden folgende Zeichen folgen: In meinem Namen werden sie Dämonen austreiben; in neuen Sprachen werden sie reden; Schlangen werden sie aufheben, und wenn sie etwas Tödliches getrunken haben, wird es ihnen nicht schaden; Kranken werden sie die Hände auflegen und es wird gut mit ihnen werden.« Es ist geradezu merkwürdig, dass hier explizit nicht von einer Weitergabe des Verkündigungsauftrages gesprochen wird. Auch die Frage der Heilung wird nicht, wie das bei Matthäus geschieht, unter dem Gesichtspunkt des Auftrages behandelt. In der Ausführung des Heilungsdienstes aber wird ein Zeichen gesehen, das die an Jesus Glaubenden begleitet.