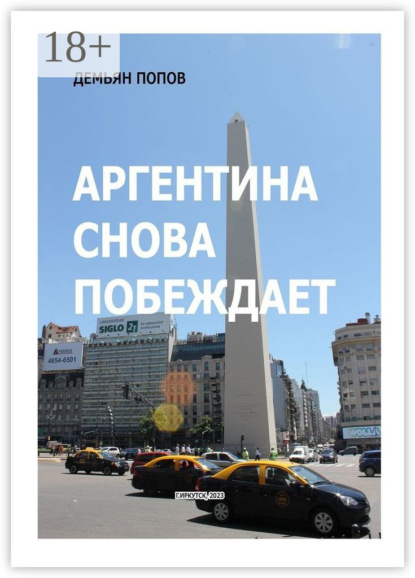Beschäftigte im Öffentlichen Dienst II
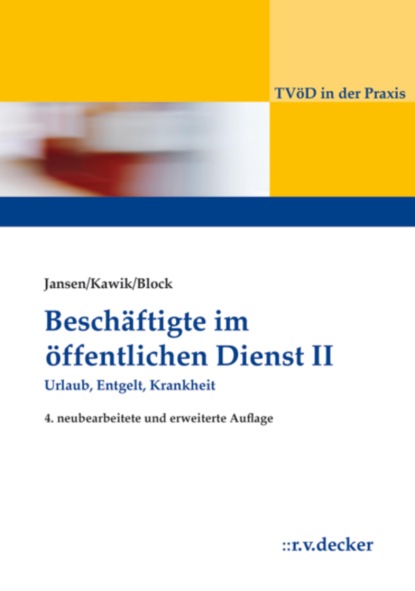
- -
- 100%
- +
Beurlaubt sich der Beschäftigte selbst, verstößt er gegen seine arbeitsvertragliche Pflicht zur Erbringung der Arbeitsleistung. Folge dessen ist zumindest, dass der Arbeitgeber berechtigt ist, den Beschäftigten abzumahnen, ggfs. kann auch im Einzelfall eine verhaltensbedingte Kündigung – zumindest im Wiederholungsfall – angemessen sein. Daneben kann sich der Beschäftigte nach § 280 Abs. 1 BGB schadensersatzpflichtig machen, wenn dem Arbeitgeber aufgrund des Ausfalls ein Schaden entsteht oder er eine zusätzliche Kraft einstellen muss. In jedem Fall kann er die Zahlung des Lohns verweigern.
Will der Beschäftigte seinen Urlaubswunsch kurzfristig trotz fehlender oder ablehnender Reaktion des Arbeitgebers durchsetzen, muss er dies im Wege des einstweiligen Rechtschutzes mittels einer einstweiligen Verfügung vor dem Arbeitsgericht ersuchen.
Der Arbeitgeber ist allerdings auch nicht frei, nach Gutdünken über den Urlaubsantrag zu entscheiden. Vielmehr hat er dem Begehren zu entsprechen, soweit keine dringenden betrieblichen Interessen entgegenstehen. Dazu zählen etwa ein außergewöhnlich hoher Krankenstand, ein unvorhergesehener Auftrag oder besonders arbeitsintensive, branchenübliche Zeiten. Nicht dazu rechnen regelmäßig wiederkehrende Organisationsstörungen, die auf eine mangelnde Planung zurückzuführen sind. Solche Phasen sind vielmehr durch entsprechenden Vorhalt an Personal aufzufangen oder aber vom Arbeitgeber hinzunehmen.
Stehen die Urlaubswünsche anderer Beschäftigter entgegen, so sind der Entscheidung des Arbeitgebers, wem er den Urlaub bewilligt, soziale Gesichtspunkte zugrunde zu legen. In Betracht kommen z.B. Urlaubsmöglichkeiten des Partners oder von schulpflichtigen Kindern, das Alter oder die Dauer der Betriebszugehörigkeit. Auch die Tatsache, ob es sich um den ersten Erholungsurlaub oder einen weiteren im Kalenderjahr handelt, ist ebenso zu berücksichtigen wie auch der Grad der Erholungsbedürftigkeit. Auch jahreszeitliche Aspekte verdienen Beachtung: Leidet der Beschäftigte oder Partner/Kinder etwa an Heuschnupfen, kann etwa ein Urlaubswunsch im Frühjahr besonders angezeigt sein, um an der Nordsee der Pollenbelastung auszuweichen.
Ausschlaggebend kann es schließlich auch sein, wie der Urlaub in den Vorjahren verteilt wurde, so dass in rotierenden Systemen alle Beschäftigten mit Familie und ggfs. auch kinderlose Beschäftigte einmal in den Sommer- oder insbesondere während der Weihnachtsferien in Urlaub fahren können.
27
Zur Vereinfachung werden bisweilen schließlich auch Urlaubslisten und Urlaubspläne erstellt.
Werden die Urlaubswünsche der einzelnen Beschäftigten abgefragt, handelt es sich zunächst einmal um eine unverbindliche Urlaubsliste.
Zu einem verbindlichen Urlaubsplan und damit einer Art Richtlinie für die Gewährung des Urlaubs kann die Liste jedoch erstarken, wenn aufgrund betrieblicher Übung der Beschäftigte davon ausgehen darf, dass der Urlaub als genehmigt gilt, wenn sich der Arbeitgeber nicht ablehnend äußert. Weicht der Arbeitgeber später hiervon ab, kann er sich schadensersatzpflichtig machen; der Beschäftigte kann dann die Kosten ersetzt verlangen, die ihm entstanden sind, weil er darauf vertrauen durfte, dass seinem Eintrag im Plan nicht widersprochen worden ist, so etwa hinsichtlich angefallener Buchungs- oder Stornierungskosten.
Die Rechtsprechung hat insoweit entschieden, dass von einem Arbeitgeber verlangt werden kann, auf die Einträge im Urlaubsplan in angemessener Zeit zu reagieren. Erfolgt kein Widerspruch, darf der Arbeitnehmer davon ausgehen, dass sein Urlaub entsprechend dem Urlaubswunsch als gewährt gilt. Als angemessene Zeitspanne ist in der Regel ein Zeitraum von einem Monat nach Vorlage des Urlaubswunsches oder Erstellung des Urlaubsplans anzusehen.[12]
Hat der Arbeitgeber dem Urlaubswunsch des Beschäftigten nicht entsprochen und stattdessen einen anderen Zeitraum bestimmt, so ist erneut auf die persönlichen Belange des Urlaubsberechtigten Rücksicht zu nehmen und ein neuer Termin für den Urlaubsantritt zu finden.
28
Der Arbeitgeber kann sich hingegen nicht einem Urlaubswunsch versperren, soweit dieser die Zeit im Anschluss an eine Kur oder Rehamaßnahme betrifft. Hier sieht das Gesetz ausdrücklich eine Pflicht des Arbeitgebers zur Urlaubsgewährung vor. Dem kann der Arbeitgeber weder Wünsche anderer Beschäftigter noch betriebliche Gründe, selbst keine bereits angeordneten Betriebsferien entgegenhalten. Denn der Erholungsbedürftigkeit des (zuvor) gesundheitlich beeinträchtigt Beschäftigten wird oberste Priorität eingeräumt.
29
Macht der Arbeitnehmer keinen Urlaub geltend, so kann der Arbeitgeber eine Freistellungserklärung vornehmen und dem Arbeitnehmer gleichwohl Urlaub erteilen. Dass der Arbeitnehmer keinen Urlaub beantragt hat, steht dem nicht entgegen.[13] Aus Fürsorgegesichtspunkten trifft den Arbeitgeber hierzu eine Pflicht. Auch das Fehlen eines Urlaubsantrags steht dem nicht entgegen.
Legt der Arbeitgeber einen Zeitraum fest, innerhalb dessen der Arbeitnehmer Urlaub zu nehmen hat, ist diese Erklärung bindend und wirksam. Allenfalls soweit der Arbeitnehmer auf die Freistellungserklärung des Arbeitgebers hin einen anderweitigen zeitlichen Urlaubswunsch äußert, ist diese Erklärung nicht bindend.[14] Der Arbeitnehmer kann sich folglich nur auf sein Leistungsverweigerungsrecht berufen, wenn er persönliche Gründe – wie eine andere Urlaubsplanung – vorbringen kann. Eine pauschale und generelle Weigerung, Urlaub in Anspruch zu nehmen, genügt hierzu nicht. Damit würde dann auch dem Sinn und Zweck des Urlaubs, der Regeneration von Körper und Geist, widersprochen werden.
8.Änderung der zeitlichen Festlegung des Erholungsurlaubs
30
Die Festlegung, wann der Erholungsurlaub genommen werden soll, entfaltet für Arbeitgeber wie auch Beschäftigte Bindungswirkung. Weder die eine noch die andere Seite kann sich von der Festlegung einfach lossagen. Der Arbeitgeber erteilt insoweit im Voraus eine unwiderrufliche Freistellungserklärung zu Erholungszwecken.
Dabei ist es unerheblich, dass die Freistellungserklärung nicht erkennen lässt, an welchen Tagen der Arbeitgeber dem Beschäftigten zum Zwecke der Gewährung von Erholungsurlaub und an welchen Tagen er zu anderen Zwecken freistellt. Denn einer nicht näher bestimmten Urlaubsfestlegung soll der Beschäftigte regelmäßig entnehmen, dass der Arbeitgeber es ihm überlässt, die zeitliche Lage seines Urlaubs innerhalb des Freistellungszeitraums festzulegen – so bei einem aus dem Betrieb ausscheidenden, freigestellten Beschäftigten.
31
Sind sich beide Vertragsparteien jedoch einig, den Urlaub auf einen anderen Zeitraum festlegen zu wollen, so ist eine solche einvernehmliche Verlegung freilich jederzeit möglich.
32
Will der Arbeitgeber den festgelegten Urlaub abändern, kann er den Urlaub weder einseitig widerrufen noch den Beschäftigten aus dem Urlaub zurückrufen. Weder das BUrlG noch der TVöD geben dem Arbeitgeber ein entsprechendes Recht; dieser muss sich vor der Genehmigung des Urlaubs vielmehr gründlich Gedanken machen, ob er den Urlaub zu dem gewünschten Zeitpunkt gewähren kann oder nicht.
Hat der Arbeitgeber unter Vorbehalt den Urlaub bewilligt, um den Beschäftigten gleichwohl aus dem Urlaub zurückrufen zu können, fehlt es an einer uneingeschränkten und damit wirksamen Urlaubsgewährung.
Eine solche Erklärung verstößt hinsichtlich des Mindesturlaubsanspruchs gegen § 13 Abs. 1 BUrlG und ist mithin rechtsunwirksam.
Was den über den gesetzlichen Mindesturlaub hinausgehenden tariflichen Urlaubsanspruch betrifft, so ist auch diese „Vereinbarung“ unwirksam. Denn nach § 4 Abs. 4 S. 1 TVG ist ein Verzicht auf entstandene tarifliche Rechte nur in einem von den Tarifvertragsparteien gebilligten Vergleich zulässig.
Da es bislang an einer vorherigen Zustimmung der Tarifvertragsparteien fehlt, hat der Arbeitgeber keine Möglichkeit, sich von dem einmal dem Beschäftigten gegenüber erteilten Urlaub zu lösen.
Auch der Beschäftigte kann sich nicht von dem zuvor festgelegten Urlaub wieder lossagen. Eine einseitige Änderung des Beschäftigten ist gleichfalls unwirksam.
Im Rahmen der Corona-Epidemie kommt diesem Grundsatz besondere Bedeutung zu. Nicht wenige Arbeitnehmer haben – in Anbetracht dessen, dass die Beschäftigungsstellen ohnehin (teilweise) geschlossen oder begrenzt besetzt wurden oder der Urlaub aufgrund von Reisebeschränkungen nicht angetreten werden konnte – sich darum bemüht, ihren Urlaub zu stornieren. Im Einverständnis mit dem Arbeitgeber ist dies möglich. Allerdings haben Arbeitgeber zunehmend die Rücknahme des Urlaubs aus Sorge darum verweigert, dass sich die Inanspruchnahme des Erholungsurlaubs auf das Jahresende verlagert und insoweit Personalengpässe entstehen können. Zudem geht die Sorge um, dass es zu einem Konflikt mit den Verfallsfristen des Urlaubs kommen könne.
9.Zusammenhängende Urlaubsgewährung
33
Die gesundheitspolitische Zielsetzung des BUrlG und diesem folgend der TVöD sehen eine zusammenhängende Inanspruchnahme des Urlaubs vor, damit sich ein nachweisbarer Erholungseffekt für den Beschäftigten einstellen kann.
Daher ist auch eine beliebig zergliederte Aufsplittung des Urlaubs nicht möglich. Dieser ist vielmehr zusammenhängend zu gewähren und zu nehmen. Damit die Regeneration von Körper und Geist tatsächlich eintritt, haben arbeitsmedizinische Untersuchungen ergeben, dass eine Urlaubsdauer von zumindest zwei, besser drei Wochen von Nöten ist. Dem kommt daher die Protokollerklärung zu § 26 Abs. 1 S. 6 TVöD nach, die zwar auch die grds. Teilungsmöglichkeit des Gesamturlaubsanspruchs vorsieht, aber zugleich anstrebt, dass ein Urlaubsteil von zwei Wochen gewährt werden soll.
Eine Gewährung von halben Tagen oder gar Stundenanteilen sieht das Urlaubsrecht demzufolge nicht vor.
Beispiel
Abzulehnen ist der Wunsch eines sog. Wochenendpendlers alle Urlaubstage einzeln zur Verlängerung der Wochenenden zu nehmen. Dies würde de facto auf eine 4-Tage-Woche hinauslaufen, die der Zielsetzung vom BUrlG und TVöD zuwiderlaufen würde.
10.Mitbestimmung
34
§ 75 Abs. 3 Nr. 3 BPersVG sieht vor, dass dem Personalrat durch Abschluss von Dienstvereinbarungen ein Mitbestimmungsrecht bei der Aufstellung des Urlaubsplanes sowie bei der Festsetzung der zeitlichen Lage des Erholungsurlaubs für einzelne Beschäftigte eröffnet wird, wenn zwischen Arbeitgeber und Beschäftigtem kein Einverständnis erzielt wird.
Demgegenüber ergibt sich für den Betriebsrat ein Mitbestimmungsrecht nach § 87 Abs. 1 Nr. 5 BetrVG hinsichtlich der Aufstellung allgemeiner Urlaubsgrundsätze und des Urlaubsplans sowie der Festlegung der zeitlichen Lage des Urlaubs einzelner Arbeitnehmer, wenn zwischen dem Arbeitgeber und den beteiligten Arbeitnehmern kein Einverständnis erzielt wird.
Eine Pflicht und damit Wirksamkeitsvoraussetzung für die Erteilung von Urlaub ist die Aufstellung entsprechender Urlaubsgrundsätze und Urlaubspläne indes nicht.
Demzufolge wird hiervon auch wenig Gebrauch gemacht.
11.Erkrankung während des Urlaubs
35
Indem § 26 Abs. 2 TVöD auf das BUrlG Bezug nimmt, findet insbesondere § 9 BUrlG Anwendung, der die Frage beantwortet, welche Auswirkungen eine Erkrankung auf den Urlaub hat: Erkrankt ein Arbeitnehmer während des Urlaubs, so werden die durch ärztliches Zeugnis nachgewiesenen Tage der Arbeitsunfähigkeit auf den Jahresurlaub nicht angerechnet.
Dem Beschäftigten werden demzufolge die Urlaubstage nicht in Abzug gebracht, soweit er durch eine Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung seine krankheitsbedingte Arbeitsunfähigkeit nachzuweisen vermag. Eine mündliche Krankmeldung, wie zunächst grds. für die Entstehung des Entgeltfortzahlungsanspruchs ausreichend, genügt gerade nicht.
36
Nimmt der Beschäftigte eine medizinische Vorsorge- oder Rehabilitationsmaßnahme i.S.d. § 10 BUrlG in Anspruch, so dürfen diese Maßnahmen ebenfalls nicht auf den Urlaub angerechnet werden.
37
Dem Beschäftigten wird eine Nachgewährung des Urlaubs ebenfalls nicht versagt, soweit dieser an einer Wiedereingliederungsmaßnahme i.S.d. § 74 SGB V (umgangssprachlich auch als „Hamburger Modell“ bezeichnet) teilnimmt. Während einer solchen Maßnahme ruhen die Hauptleistungspflichten. Es entsteht für diesen Zeitraum ein Vertragsverhältnis sui generis, das alleine dem Rehabilitationszweck dient und nicht dem Austausch von Leistung und Gegenleistung. Gleichwohl besteht die Arbeitsunfähigkeit während der Wiedereingliederung fort; der Urlaub ist soweit nicht erfüllbar.
38
Nicht von § 9 MuSchG erfasst werden hingegen Beschäftigungsverbote nach § 3 sowie § 16 MuSchG. Denn die werdende Mutter ist nicht krank, da die Schwangerschaft als solche kein regelwidriger Zustand ist. Dies hat zur Folge, dass die werdende Mutter keine Nachgewährung der Urlaubstage verlangen kann, wenn in die Zeit des bereits gewährten Erholungsurlaubs ein Beschäftigungsverbot fällt, sie also nach Urlaubsantritt ein Beschäftigungsverbot erhält. Dies ist darauf zurückzuführen, dass die werdende Mutter aufgrund des Beschäftigungsverbots völlig oder teilweise mit der Arbeit aussetzt, somit die Kausalität ausschließlich auf einem nicht von § 9 BUrlG erfassten Beschäftigungsverbot beruht.
Auch eine analoge Anwendung schließt die Rechtsprechung insoweit aus.[15] Ein schwangerschaftsbedingtes Beschäftigungsverbot ginge typischerweise nicht mit einer der krankheitsbedingten Arbeitsunfähigkeit vergleichbaren Beeinträchtigung einher.
Beispiel
Eine Arbeitnehmerin tritt am 3.7.2021 ihren dreiwöchigen Erholungsurlaub an. Ab dem 10.7.2021 erhält sie ein Beschäftigungsverbot. Der Urlaub während der Zeit des Beschäftigungsverbotes kann ihr nicht wieder gutgeschrieben werden.
Anders gestaltet sich die Rechtslage indessen, wenn vor Urlaubsantritt ein mutterschutzrechtliches Beschäftigungsverbot erteilt worden ist. In diesem Fall kann nach § 362 Abs. 1 BGB nicht der erforderliche Leistungserfolg des Urlaubs eintreten. Der Urlaubsanspruch bleibt deshalb bestehen.[16]
Beispiel
Einer Arbeitnehmerin ist Erholungsurlaub ab dem 3.7.2021 genehmigt worden. Ab dem 1.7.2021 erhält sie ein Beschäftigungsverbot. Der Urlaub während des Beschäftigungsverbots wird ihr gutgeschrieben.
39
Keine Gutschrift des genehmigten Urlaubs erfolgt, soweit der Arbeitnehmer Arbeitsbefreiung nach § 29 TVöD bzw. § 45 SGB V erhalten hat.
Beispiel
Zur Betreuung seines erkrankten achtjährigen Kindes erhält der Arbeitnehmer nach § 29 Abs. 1 S. 1 e) aa TVöD fünf Tage Arbeitsbefreiung. Am zweiten Krankheitstag des Kindes erkrankt der Arbeitnehmer selbst. Auch hier werden alle fünf Tage nach § 29 TVöD verbraucht und können nicht gutgeschrieben werden.
Bisweilen heftig diskutiert wird in der Praxis, wie zu verfahren ist, wenn ein Beschäftigter von seinem Arbeitszeitkorridor angesammelte Stunden seines Arbeitszeitkontos tageweise abbaut und während dieser Zeit erkrankt. Auch hier fehlt es an einer Grundlage im BUrlG, dass diese Stunden erhalten bleiben können, wenn der Beschäftigte nach Antritt des Ausgleichszeitraums erkrankt.
Beispiel
Ein Arbeitnehmer hat donnerstags und freitags die Inanspruchnahme von Freizeitausgleich genehmigt bekommen. Freitags morgens erkrankt er. Die Arbeitsstunden können ihm nicht gutgeschrieben werden.
Achtung
In diesem Zusammenhang sei darauf verwiesen, dass der Abbau von zusätzlich geleisteten Arbeitsstunden stets vorab zu genehmigen ist. Der Arbeitnehmer ist nicht berechtigt, Freizeitausgleich zu nehmen und sich diesen nachträglich genehmigen zu lassen, um das Erkrankungsrisiko auszuschließen. Auch ist er nicht befugt, den genehmigten Abbau der angesammelten Stunden rückgängig zu machen, wenn sich das Erkrankungsrisiko realisiert hat.
40
Ob im Falle einer Arbeitskampfmaßnahme eine Nachgewährung des Urlaubs erfolgt, hängt ebenfalls von den konkreten Umständen des Einzelfalls ab:
Wird nach bewilligtem Urlaub ein rechtmäßiger Streik im Betrieb bzw. in der Dienststelle durchgeführt, gewährt die Rechtsprechung keine Nachgewährung; der Urlaub wird durch den Streik nicht unterbrochen.
Tritt der Beschäftigte seinen Urlaub an, hat er Anspruch auf Urlaubsentgelt – der Streik führt zu keiner Unterbrechung des Urlaubs.
Entscheidet sich der Beschäftigte hingegen dazu, an dem Streik mitzuwirken, kann er während der Arbeitskampfmaßnahme keinen Urlaub beanspruchen; denn während des Streiks besteht keine Arbeitspflicht, so dass der Beschäftigte von dieser auch nicht urlaubsbedingt freigestellt werden kann.
Anderes kann nur gelten, wenn er vor Urlaubsbeginn ausdrücklich gegenüber dem Arbeitgeber erklärt hat, seine Streikteilnahme vorübergehend beenden zu wollen. Aus Gründen der Kampfparität kann der Arbeitgeber allerdings in einem solchen Fall die Urlaubsgewährung verweigern.
Beispiel
Einem Arbeitnehmer ist Urlaub ab dem 20.4.2021 bewilligt worden. Ab dem 22.4.2021 wird die Dienststelle bestreikt. Der Urlaub wird abgebaut.
Erkrankt der Beschäftigte während des Streiks, hat er keinen Anspruch auf Entgeltfortzahlung wegen der streikbedingt suspendierten Hauptleistungspflichten. Denn die Krankheit muss die alleinige Ursache für den Arbeitsausfall sein.
Erkrankt der Beschäftigte jedoch vor Streikbeginn, verliert er nicht den Anspruch auf Entgeltfortzahlung (dies führt dann auch regelmäßig dazu, dass vor Beginn einer Arbeitskampfmaßnahme gerade bei nicht gewerkschaftlich organisierten Beschäftigten, die kein Geld aus der Streikkasse erhalten, der Krankenstand drastisch ansteigt), soweit er sich nicht an dem Arbeitskampf beteiligt oder beteiligt hätte, wofür den Arbeitgeber die Beweislast trifft.
Darauf aufbauend hat die Rechtsprechung entschieden, dass der Beschäftigte seinen Urlaubsanspruch behält, der während eines vor Streikbeginn gewährten Urlaubs arbeitsunfähig erkrankt. Der Nachgewährungsanspruch des § 9 BUrlG besteht daher, wenn der Beschäftigte seinen Urlaub angetreten hat, dann in der Dienststelle bzw. in dem Betrieb ein rechtmäßiger Streik geführt wurde und der Beschäftigte sodann arbeitsunfähig erkrankt. Solange der Beschäftigte sich nicht am Streik beteiligt, behält er seinen Entgeltfortzahlungsanspruch nach dem EFZG. Dadurch kann der Nachgewährungsanspruch nach § 9 BUrlG greifen.
Beispiel
Einem Arbeitnehmer ist Urlaub ab dem 20.4.2021 bewilligt worden. Ab dem 22.4.2021 wird die Dienststelle bestreikt. Ab dem 23.4.2021 erkrankt der Arbeitnehmer, was er durch ärztliches Zeugnis belegt. Hier erfolgt eine Gutschrift der durch Attest belegten Tage der Arbeitsunfähigkeit.
12.Urlaubszweckwidrige Erwerbstätigkeit während des Urlaubs
41
§ 8 BUrlG regelt, dass der Arbeitnehmer während des Urlaubs keine dem Urlaubszweck widersprechende Erwerbstätigkeit leisten darf.
Da der Erholungsurlaub der Regeneration von Leib und Seele dienen und damit die Leistungsfähigkeit des Beschäftigten wieder auffrischen soll, besteht die Gefahr, dass eine dennoch zeitgleich ausgeübte Erwerbstätigkeit diesem Zweck zuwiderlaufen könnte.
Daher ist jede selbstständige oder unselbstständige Arbeit verboten, die zum Zwecke der Entgelterzielung ausgeübt wird und durch die die Arbeitskraft überwiegend in Anspruch genommen wird.
Von dem Verbot ausgenommen sind hingegen Tätigkeiten, die dem geistigen Ausgleich dienen, wie etwa die gelegentliche Mitarbeit einer Büroangestellten in einer Straußenwirtschaft, selbst wenn damit ein Entgelt erzielt wird.
Berechtigte Tätigkeiten, die auch sonst während des Arbeitsverhältnisses verrichtet werden, werden ebenso wenig erfasst. Dies gilt im Falle einer regelmäßigen Arbeitsleistung, wie bei Nebenerwerbslandwirten üblich oder auch bei Doppelarbeitsverhältnissen, die in Teilzeit verrichtet werden.
Der Beschäftigte darf daher ebenso seine zuvor schriftlich angezeigte und nicht untersagte Nebentätigkeit innerhalb und außerhalb des öffentlichen Dienstes, wie Aus- und Fortbildungsveranstaltungen sowie Schulungen ausüben.
Eigenleistungen – Tätigkeiten für sich selbst – etwa körperlich erschöpfende Arbeiten für die Fertigstellung des Eigenheims oder Arbeiten im Garten, werden gleichfalls nicht vom Anwendungsbereich des § 8 BUrlG erfasst, wie persönliche Hobbies. Ist der Beschäftigte z.B. begeisterter Imker oder Hühnerhalter, so kann ihm die Pflege der Bienen bzw. Hühner auch nicht während der Urlaubszeit untersagt werden.
Auch familiäre Unterstützungen, Nachbarschaftshilfen und Gefälligkeiten im Freundeskreis werden vom Verbot des § 8 BUrlG ausgenommen.
Tätigkeiten für wohltätige Organisationen, familienrechtliche bzw. öffentlich-rechtliche Verpflichtungen bleiben ebenso erlaubt (wie freiwillige Feuerwehr, Betreuung, THW-Helfer).
42
Geht der Beschäftigte hingegen einer anderweitigen Vollzeitbeschäftigung während seines Erholungsurlaubs nach, verstößt der Beschäftigte gegen § 8 BUrlG. Dies berechtigt den Arbeitgeber jedoch nicht, den Entgeltanspruch zu kassieren und die Urlaubsvergütung zurückzufordern. Anderweitige dahin gehende arbeitsvertragliche Vereinbarungen mit dem Beschäftigten sind hinsichtlich des gesetzlichen Mindesturlaubs unwirksam.
Denn eine verbotene Erwerbstätigkeit eines Arbeitnehmers während des Urlaubs führt nicht dazu, dass der gewährte Urlaub verfällt. Die suspendierte Pflicht des Arbeitnehmers lebt nicht wieder auf. Ein solches Ergebnis ist nicht vom Gesetz vorgesehen. Der Anspruch auf Zahlung des Urlaubsentgelts ist von einer urlaubszweckwidrigen Erwerbstätigkeit unabhängig. Aus § 8 BUrlG ergibt sich insbesondere kein Anspruch des Arbeitgebers, das Urlaubsentgelt im Umfang des Urlaubsanspruchs aus diesem Anlass zu kürzen. Der Anspruch auf Zahlung des Urlaubsentgelts entfällt in einem solchen Fall auch nicht von selbst. Der gesetzgeberische Zweck des § 8 BUrlG kann nur darin gesehen werden, den Arbeitnehmer dazu anzuhalten, die durch die Befreiung von der Arbeitspflicht erlangte Freizeit nicht zu anderweitiger Erwerbstätigkeit zu nutzen. Ein solches Ziel kann nicht mit einer Rückzahlungsverpflichtung oder dem Wegfall des Anspruchs auf das Urlaubsentgelt erreicht werden.
Jedoch berechtigt der Pflichtverstoß den Arbeitgeber zum Ausspruch einer Abmahnung; im Wiederholungsfall kann auch eine ordentliche Kündigung in Betracht kommen. Eine außerordentliche Kündigung wird hingegen nur im Ausnahmefall zulässig sein.
Daneben besteht für den Arbeitgeber die Möglichkeit, mittels einer einstweiligen Verfügung gegenüber dem Beschäftigten einen Unterlassungsanspruch durchzusetzen.
Im Einzelfall kann sich zudem ein Schadensersatzanspruch gegenüber dem Beschäftigten ergeben. Wird etwa der Beschäftigte aufgrund der unberechtigten Erwerbstätigkeit längerfristig arbeitsunfähig, z.B. bei einem schweren Sturz auf einer Baustelle, so kann der Arbeitgeber die Kosten für die Einstellung einer Ersatzkraft als Schaden geltend machen.