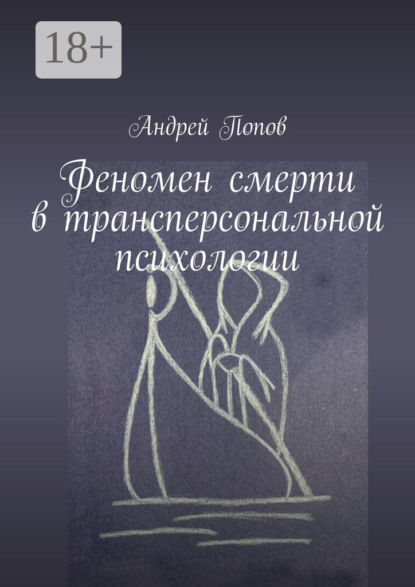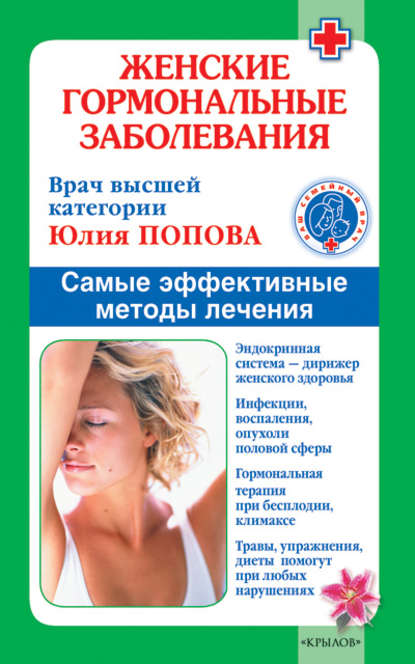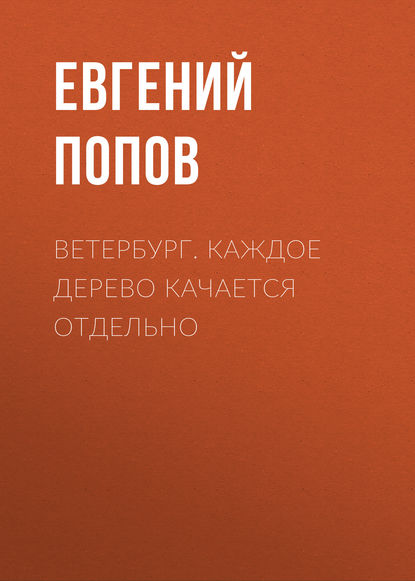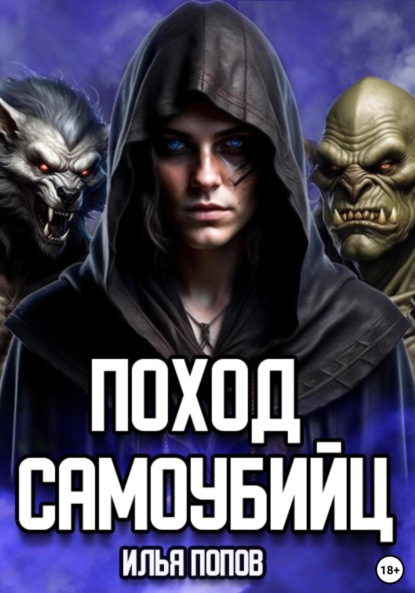Beschäftigte im Öffentlichen Dienst II
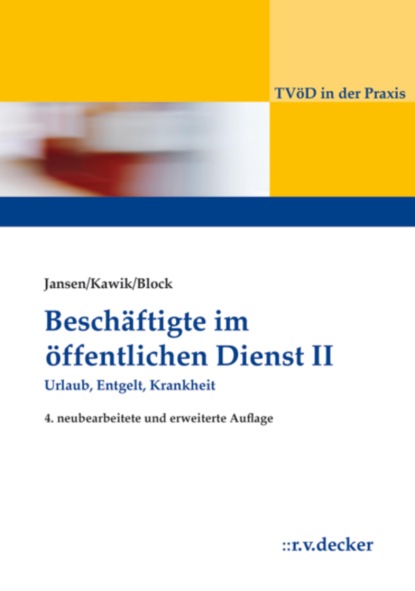
- -
- 100%
- +
Anlässlich der Geburt eines Kindes gewährt die Tarifnorm einen eintägigen Arbeitsbefreiungsanspruch. Zur Geltendmachung ist es nicht erforderlich, dass eine häusliche Gemeinschaft besteht.
Keine Arbeitsbefreiung soll jedoch auch weiterhin für die Niederkunft der Lebensgefährtin gewährt werden. Dies ist umso erstaunlicher, als dass die SUrlV der Beamten nunmehr explizit die nichteheliche Lebensgemeinschaft in den anspruchsberechtigten Personenkreis aufgenommen hat. Insoweit besteht Nachholbedarf für diese nicht mehr zeitgemäße Einschränkung, um auch Vätern und Mütter in einer nichtehelichen Lebensgemeinschaft mit einem entsprechenden Zeitvolumen zu beschenken und Vater-/Mutterschaft zugleich gesellschaftlich besonders anzuerkennen.
112
§ 29 TVöD selbst enthält als Konkretisierung des § 616 BGB keine ausdrückliche Regelung und Frist, wann die Arbeitsbefreiung genommen werden kann, so auch nicht hinsichtlich der Niederkunft.
Das BAG[54] hatte zu der insoweit sinngleich formulierten Regelung des § 52 BAT – TgRV-O entschieden, dass der Freistellungsanspruch nicht in erster Linie dem Zweck dient, dem Beschäftigten die Teilnahme an der Geburt des Kindes zu ermöglichen. Die Freistellung erfolge nach dem Tarifwortlaut nicht wegen der Geburt des Kindes, sondern aus Anlass der Niederkunft der Ehefrau. Sie diene dazu, dem Beschäftigten die Erfüllung in einem solchen Fall denkbarer Beistandspflichten nach § 1353 Abs. 1 BGB zu erleichtern. Deshalb müsse der tarifliche Freistellungsanspruch auch nicht am Tag der Geburt des Kindes verwirklicht werden.
Das Gericht[55] hatte in einem weiteren Fall hinsichtlich § 30 MTV für das Cockpit-Personal der Frage nachzugehen, ob der bei Niederkunft gewährte Sonderurlaubsanspruch von drei Arbeitstagen auch zu einem späteren Zeitpunkt statt des Geburtstages des Kindes genommen werden könne.
Nach der Geburt des Kindes am 8.3.2010 hatte der Arbeitnehmer zunächst eine sogenannte „Blockfreizeit“ im März in Anspruch genommen, im Anschluss derer er am 3. bzw. 6.4.2010 und erneut am 19.5.2010 die dreitägige Arbeitsbefreiung geltend machen wollte, was der Arbeitgeber am 25.5.2010 ablehnte.
Das LAG Köln hat hierzu ausgeführt, dass keine bestimmte Frist zur Geltendmachung oder für den Verfall des Anspruchs tarifiert ist.
Der tariflichen Regelung ließe sich nicht entnehmen, dass der Anspruch einen „unmittelbaren zeitlichen Zusammenhang“ mit der Niederkunft der Ehefrau voraussetze und untergehe, wenn der Anspruch erst „nahezu einen Monat nach der Niederkunft“ erstmals geltend gemacht werde.
Dem Wortlaut der tariflichen Regelung lasse sich eine solche Begrenzung des Anspruchs nicht entnehmen.
Sie sei auch mit Rücksicht auf den Sinn und Zweck nicht geboten. Nicht wegen der Geburt des Kindes, sondern aus Anlass der Niederkunft der Ehefrau erfolge die Freistellung. Es solle dem Beschäftigten nicht lediglich ermöglicht werden, der Entbindung des Kindes beizuwohnen oder unmittelbar im Zusammenhang mit der Entbindung entstehende Aufgaben zu übernehmen. Auch zu einem späteren Zeitpunkt bestehe noch anlassbezogener Bedarf für eine Gewährung von Arbeitsbefreiung. So stehe es dem Beschäftigten wahlweise frei, sich um Mutter und/oder Kind zu kümmern oder anlassbezogene Maßnahmen durchzuführen. Hätten die Tarifparteien eine zeitliche Beschränkung des Anspruchs gewollt, hätte es nahegelegen, im Regelungszusammenhang der streitgegenständlichen Tarifnorm eine besondere Maßgabe vorzusehen.
Da dies nicht geschehen ist, muss es dabei verbleiben, dass der Arbeitsbefreiungsanspruch anlassbezogen entsteht und zu erfüllen ist.
Indem § 29 Abs. 1 S. 1 Buchst. a) TVöD nahezu wortgleich verfasst ist, greift die Rechtsprechung folglich auch auf die Regelung des TVöD.
Allenfalls kann daher auf die tarifliche Ausschlussfrist von sechs Monaten nach § 37 TVöD abgestellt werden.
Im Falle einer Mehrlingsentbindung erhöht sich die Anzahl der Freistellungstage nicht entsprechend. Dabei spielt auch keine Rolle, ob ein Kind vor und eines nach Mitternacht entbunden wird. Denn der Wortlaut des § 29 TVöD spricht insoweit von der Niederkunft als solcher, einem einheitlichen Vorgang, unabhängig davon, ob es sich um die Geburt eines oder mehrerer Kinder handelt.
113
Absatz 1 Buchst. b): Tod der Ehegattin/des Ehegatten, der Lebenspartnerin/des Lebenspartners im Sinne des Lebenspartnerschaftsgesetzes, eines Kindes oder Elternteils:zwei Arbeitstage
Im Todesfall der von Buchst. b) erfassten Personen erhält der Beschäftigte zwei Tage Arbeitsbefreiung.
Kinder im Sinne dieser Regelungen sind neben den leiblichen Kindern auch Adoptivkinder. Gleiches gilt für Adoptiveltern. Nicht vom Regelungskreis enthalten sind Großeltern, Schwiegereltern, Pflegeeltern und Stiefeltern, Geschwister, Pflegekinder und Enkel; eine Norm, die ebenfalls in der Praxis daher heftige Kritik auslöst.
Der häuslichen Gemeinschaft bedarf der Anspruch ebenfalls nicht.
114
Absatz 1 Buchst. c): Umzug aus dienstlichem Grund an einen anderen Ort:ein Arbeitstag
Muss der Beschäftigte aus dienstlichen Gründen seinen Wohnort wechseln, so soll der damit einhergehende Aufwand gleichfalls durch Arbeitsbefreiung honoriert werden.
Ein privat veranlasster Umzug löst den Anspruch allerdings nicht aus.
Erfolgt ein Arbeitgeberwechsel im öffentlichen Dienst, bedarf es, um den Anspruch auszulösen, einer schriftlichen Anerkennung des dienstlichen bzw. betrieblichen Interesses am Umzug.
115
Absatz 1 Buchst. d): 25- und 40-jähriges Arbeitsjubiläum:ein Arbeitstag
Als Dank für die langjährige Treue zum Arbeitgeber wird dem Tarifbeschäftigten zum 25- und 40-jährigen Arbeitsjubiläum ein Tag Arbeitsbefreiung gewährt.
Dies setzt nach § 23 Abs. 2 TVöD einen Anspruch auf Zahlung des Jubiläumsgeldes voraus. Nicht mehr aufgenommen wurde, im Gegensatz zu der beamtenrechtlichen Regelung, das 50-jährige Dienstjubiläum. Warum hiervon Abstand genommen wurde in Anbetracht dessen, dass diese Fälle verschwindend gering sind, erschließt sich nicht auf den ersten Blick.
116
Absatz 1 e): schwere Erkrankung von Angehörigen, eines Kindes oder einer Betreuungsperson:bis zu vier Arbeitstage im Kalenderjahr
Erkrankt ein im Haushalt lebender Angehöriger – wozu neben Ehegatten, Verlobten, Verwandte und Verschwägerte in gerader Linie, Geschwister, Schwiegereltern und Pflegekinder zählen –, so dass deren Pflege unerlässlich ist, besteht ein Anspruch auf Arbeitsbefreiung, § 29 Abs. 1 e) aa und bb TVöD – eine insoweit sehr praxisrelevante Regelung.
Obschon der Wortlaut eine schwere Erkrankung fordert, wird diese von der Praxis nicht verlangt; bereits eine Erkrankung genügt, die einen Betreuungs- bzw. Pflegeaufwand erforderlich macht.
Der Nachweis hierzu ist mittels einer ärztlichen Bescheinigung zu erbringen, § 29 Abs. 1 S. 2 TVöD.
Die Arbeitsbefreiung nach § 29 Abs. 1 S. 2 TVöD hat indes nur zu erfolgen, soweit eine andere Person zur Pflege oder Betreuung nicht sofort zur Verfügung steht; ansonsten bedarf es keiner Arbeitsbefreiung.
Tipp
Der Anspruch steht jedem Beschäftigten zu und muss nicht etwa unter Ehepaaren aufgeteilt werden. Ist ein Elternteil Tarifbeschäftigter und der andere Elternteil Beamter, so steht dem Tarifbeschäftigten der volle Anspruch zu und dem Beamten aufgrund der SUrlV ebenfalls der dort genannte Maximalanspruch.
Hinzuweisen ist ebenfalls darauf, dass der Anspruch nicht etwa deshalb reduziert werden kann, weil der Beschäftigte einer Teilzeittätigkeit nachgeht. Selbst wenn der Beschäftigte erst im Verlauf des Kalenderjahres seine Arbeit antritt, steht ihm der volle Freistellungsanspruch zu.
Gleiches gilt auch im Falle eines Statuswechsel im laufenden Kalenderjahr, soweit etwa ein Tarifbeschäftigter zum Beamten ernannt wird. Mangels entsprechender Anrechnungsregelung können insoweit jeweils Ansprüche nach der Tarifnorm sowie nach der SUrlV geltend gemacht werden.
117
Für den Umfang der Arbeitsbefreiung ist schließlich das Alter der zu betreuenden Person ausschlaggebend. Auffangvorschrift ist insoweit § 29 Abs. 1 e) aa) TVöD, der einen Tag Arbeitsbefreiung gewährt, soweit der erkrankte Angehörige ab 12 Jahre alt ist.
118
Handelt es sich um ein erkranktes Kind, das das 12. Lebensjahr noch nicht vollendet hat, besteht ein Befreiungsanspruch auf bis zu vier Arbeitstage, § 29 Abs. 1 e) bb) TVöD. Gewährt wird dieser Anspruch einmalig für jedes Kind pro Kalenderjahr; die tarifierte Begrenzung nach § 29 Abs. 1 S. 3 TVöD wird nicht angewandt.[56]
Um den Beschäftigten mehr Flexibilität zuzugestehen, können diese Tage auch regelmäßig als halbe Tage in Anspruch genommen werden, so etwa damit sich die Betreuungspersonen vor- und nachmittags mit der Betreuung und Pflege abwechseln können.
119
Ausgeschlossen wird der Anspruch, um eine doppelte Absicherung zu verhindern, soweit ein Anspruch auf Krankengeld nach § 45 SGB V besteht.
Dies trifft etwa bei nicht gesetzlich Versicherten, sondern privatversicherten Beschäftigten zu oder bei nicht unter die Familienversicherung nach § 10 SGB V fallenden Kindern.
Beispiel
Ist ein Elternteil Tarifbeschäftigter und gesetzlich krankenversichert und sind der andere Elternteil sowie auch die gemeinsamen Kinder privatversichert, greift § 45 SGB V nicht. Insoweit findet ausschließlich die Tarifnorm Anwendung.
Beispiel
Eine gesetzlich krankenversicherte Arbeitnehmerin wird zum 1.5.2021 in einer 3-Tage-Woche eingestellt. Ihr gleichfalls tarifbeschäftigter und gesetzlich krankenversicherter Ehemann befindet sich bereits seit 2018 in Vollzeit in einem Arbeitsverhältnis. Ihr einziges 8-jähriges Kind erleidet im September beim Sportunterricht eine Fraktur der rechten Hand und ist infolgedessen 21 Tage erkrankt. Hier steht jedem Elternteil ein 10-tägiger Anspruch auf Arbeitsbefreiung zu. Über die Aufteilung können die Eltern dabei grds. frei entscheiden.
Achtung
§ 26 Abs. 1 e) bb) TVöD ist insoweit nicht (zusätzlich) neben § 45 SGB V anwendbar. Ein Freistellungsanspruch wird entweder nach dem TVöD oder nach dem SGB V gewährt.
120
Ist der Anwendungsbereich des SGB V eröffnet, umfasst der sozialrechtliche Anspruch des § 44 SGB V neben dem Krankengeldanspruch nach § 45 Abs. 1 SGB V einen unbezahlten Freistellungsanspruch für jedes Kind von längstens 10 Arbeitstagen, für Alleinerziehende längstens 20 Arbeitstage je Kalenderjahr.
Begrenzt ist der Anspruch nach § 45 Abs. 2 SGB V, soweit der Beschäftigte mehrere Kinder unter 12 Jahren hat, auf 25 Tage bzw. 50 Tage für Alleinerziehende je Kalenderjahr. Unerheblich ist es nach Auffassung des BSG,[57] ob die Alleinerziehende das gemeinsame Sorgerecht über das Kind hat; maßgeblich ist, dass sie in häuslicher Gemeinschaft allein mit dem Kind lebt.
Im Gegensatz zu § 29 Abs. 1 e) bb) TVöD gewährt das Sozialrecht nicht nur einen Anspruch bei bis zu zwölfjährigen Kindern. Darüber hinaus wird auch ein Freistellungsanspruch gewährt, soweit es sich um ein behindertes und auf Hilfe angewiesenes Kind handelt. Ein bestimmter Grad der Behinderung ist nicht Voraussetzung. Vielmehr muss das behinderte Kind einen Entwicklungsstand haben, der einem unter zwölfjährigen Kind entspricht.
Für nicht gesetzlich versicherte Beschäftigte kommt der tarifliche Anspruch hingegen zur Anwendung. Sind die vier Tage nicht ausreichend, kommt ein Freistellungsanspruch bis zur in § 45 Abs. 2 SGB V genannten Gesamthöhe nach § 45 Abs. 5 SGB V in Betracht, da diese Vorschrift einen unbezahlten Freistellungsanspruch unabhängig vom Versichertenstatus gewährt.
Achtung
Dem Anspruch steht nicht entgegen, wenn sich das Kind in stationärer Behandlung befindet. Nach dem Urteil des LSG Berlin[58] ist der Anspruch auf Krankengeld auch zu gewähren, wenn es medizinisch erforderlich ist, dass der Versicherte zur Beaufsichtigung, Betreuung oder Pflege seines erkrankten Kindes im Krankenhaus (Mitaufnahme als Begleitperson) der Arbeit fernbleibt.
121
Erkrankt eine Betreuungsperson eines Kindes, das das achte Lebensjahr noch nicht vollendet hat oder wegen körperlicher, geistiger oder seelischer Behinderung dauernd pflegebedürftig ist, so steht dem Beschäftigten ein Anspruch auf Arbeitsbefreiung von bis zu vier Arbeitstagen im Kalenderjahr zu, wenn er die Betreuung des Kindes übernehmen muss, § 29 Abs. 1 e) cc) TVöD.
Betreuungsperson kann jede Person sein, die mit der Versorgung des Kindes betraut worden ist, gleichgültig, ob in einer Verwandtschaftsbeziehung stehend, oder nicht.
Beispiel
Neben dem Ehegatten und den Großeltern kommt auch die Tagesmutter, Erzieherin in einer Kindestagesstätte, das Au-pair oder ggf. noch die Grundschullehrerin in Betracht, soweit krankheitsbedingt die Einrichtung geschlossen wird.
122
Achtung
Darauf hinzuweisen ist, dass zu den persönlichen Anlässen i.S.d. § 29 TVöD nicht solche zu rechnen sind, in denen die Schulen aufgrund des Corona-Ausbruchs geschlossen worden sind und für die Kinder eine Betreuung nicht anderweitig sichergestellt werden kann. Um diesem Umstand Rechnung zu tragen, hat das BMI als Ausfluss des § 616 BGB den Tarifbeschäftigten bis zu 10 Tage Sonderurlaub unter Fortzahlung des Entgelts gewährt, soweit Kinder unter 12 Jahren betroffen sind, wobei vorrangig Möglichkeiten mobilen Arbeitens zu nutzen seien. In besonderen Härtefällen kann darüber hinaus Arbeitsbefreiung unter Fortzahlung des Entgelts nach § 21 TVöD gewährt werden. Anknüpfungspunkt ist insoweit die Neuregelung des § 563 IfSG.
123
Achtung
Nur bei den Doppelbuchstaben aa) und bb) bedarf es der Vorlage einer ärztlichen Bescheinigung.
Im Falle einer erkrankten Betreuungsperson kann keine ärztliche Bescheinigung verlangt werden. Ein solche könnte z.B. auch nicht von einer Erzieherin einer Kindertagesstätte für alle betroffenen Eltern eingefordert und als nicht vertretbare Handlung auch nicht eingeklagt werden.
124
Absatz 1 f): ärztliche Behandlung während der Arbeitszeit:
erforderlich nachgewiesene Abwesenheitszeit einschließlich
erforderlicher Wegezeiten
Der Tarifbeschäftigte kann weiterhin einen Freistellungsanspruch geltend machen, wenn die ärztliche Behandlung während der Arbeitszeit erfolgen muss. Davon soll auch auszugehen sein, wenn der Arzt den Beschäftigten während der Kernarbeitszeit zur Untersuchung oder Behandlung in seine Praxis bestellt und der Beschäftigte auf die Termingestaltung keinen Einfluss nehmen kann.[59] Grundsätzlich hat jedoch der Beschäftigte anzustreben, dass eine Behandlung außerhalb der Arbeitszeit, bei Gleitzeit folglich außerhalb der Kernzeit, erfolgt. Eine Zeitgutschrift kann der Beschäftigte insoweit während der Gleitzeit nicht verlangen. In Dienststellen ohne Kernzeit ist daher der Beschäftigte grds. dazu verpflichtet, das Defizit vor oder nach der ärztlichen Behandlung nachzuholen. Eine Zeitgutschrift kann insoweit nur in Betracht kommen, soweit die ärztliche Behandlung sich über den gesamten Arbeitstag bzw. wesentliche Teile hiervon erstreckt.
Nach Auffassung des LAG Niedersachsen[60] ist ein Arztbesuch nicht bereits dann notwendig, wenn der behandelnde Arzt einen Arbeitnehmer während der Arbeitszeit zur Behandlung oder Untersuchung in seine Praxis bestellt. Der Arbeitnehmer muss versuchen, das Arbeitsversäumnis möglichst zu vermeiden. Hält der Arzt außerhalb der Arbeitszeit Sprechstunden ab und sprechen keine medizinischen Gründe für einen sofortigen Arztbesuch, muss der Arbeitnehmer die Möglichkeit der Sprechstunde außerhalb der Arbeitszeit wahrnehmen. Unverschuldet ist die Versäumnis hingegen, wenn der Arbeitnehmer von dem Arzt zu einer Untersuchung oder Behandlung einbestellt wird und der Arzt auf terminliche Wünsche des Arbeitnehmers keine Rücksicht nehmen will oder kann.
Das Erfordernis der ärztlichen Behandlung während der Arbeitszeit ist durch entsprechende ärztliche Bescheinigung zu belegen. Diese hat regelmäßig auch die Dauer der Abwesenheitszeit zu enthalten.
3.Allgemeine staatsbürgerliche Pflichten nach § 29 Abs. 2 TVöD
125
§ 29 Abs. 2 TVöD enthält einen Freistellungsanspruch bei Erfüllung allgemeiner staatsbürgerlicher Pflichten.
Bei Wahrnehmung dieser nach deutschem Recht bestehenden Pflichten, soweit die Arbeitsbefreiung gesetzlich vorgeschrieben ist und soweit die Pflichten nicht außerhalb der Arbeitszeit, ggf. nach ihrer Verlegung wahrgenommen werden können, besteht der Anspruch auf Fortzahlung des Entgelts insoweit, als Beschäftigte nicht Ansprüche auf Ersatz des Entgelts geltend machen können.
Von der Regelung erfasst wird etwa die Tätigkeit als Wahlhelfer, als ehrenamtlicher Richter in der Arbeitsgerichtsbarkeit, als Schöffe in der Strafgerichtsbarkeit oder als Zeuge.
Wird dem Beschäftigten für die Wahrnehmung seiner staatsbürgerlichen Pflichten ein Entgelt gewährt, so enthält die Tarifnorm die Verpflichtung, den Erstattungsbetrag an den Arbeitgeber abzuliefern, da dieser das Entgelt fortzahlt und eine Doppelbezahlung vermieden werden soll.
Aus Gründen der Verwaltungsvereinfachung sieht das BMI vor, dass das Entgelt bei Tätigkeiten als ehrenamtlicher Richter, Schöffe oder Zeuge für die Dauer der zeitlichen Inanspruchnahme bei erteilter Arbeitsbefreiung abweichend von § 29 Abs. 2 TVöD nach § 21 TVöD außertariflich fortgezahlt wird.
Damit entfallen zugleich die Voraussetzungen einer Entschädigung für Verdienstausfall nach den §§ 18 und 22 JVEG. Lediglich die in § 16 JVEG enthaltene Entschädigung für Zeitversäumnis darf noch geltend gemacht werden.
Gibt der Beschäftigte gegenüber dem Gericht wahrheitswidrige Angaben über sein Entgelt ab und macht sowohl die Entgeltfortzahlung als auch die zusätzliche Entschädigung geltend, kommt eine Strafbarkeit wegen Betrugs in Betracht.
4.Arbeitsbefreiung in sonstigen dringenden/begründeten Fällen nach § 29 Abs. 3 TVöD
126
Die Generalklausel des § 29 Abs. 3 TVöD ermöglicht zwei Fälle von Arbeitsbefreiung:
Absatz 3 S. 1: Arbeitsbefreiung in sonstigen dringenden Fällen:
bis zu drei Arbeitstagen
Die Arbeitsbefreiung wird unter Fortzahlung des Entgelts gewährt. Die bezahlte Freistellung wird nur gewährt, soweit der Anlass nicht unter die in Absatz 1 geregelten Sachverhalte fällt oder gerade nicht fallen soll (wie etwa der Umzug aus privaten Gründen). Es bedarf daher einer wirklichen Ausnahmesituation, um die Arbeitsbefreiung begründen zu können.
Der Arbeitgeber hat hierüber im Einzelfall eine Entscheidung im Rahmen des billigen Ermessens nach § 315 BGB unter Einbeziehung der wechselseitigen Interessen zu treffen.
Regelmäßig wird der Beschäftigte zunächst gehalten sein, Erholungsurlaub nach § 26 TVöD zu beantragen oder positive Arbeitszeitsalden zu nutzen.
Beispiele
Hochwasser, Brand, extremer Schneefall, fehlende Betreuung von Kindern unter 12 Jahren während der sog. Corona-Krise bei besonderen Härtefällen.
Absatz 3 S. 2: Arbeitsbefreiung in begründeten Fällen:
kurzfristige Arbeitsbefreiung
127
Unter Verzicht auf das Entgelt kann dem Beschäftigten kurzfristige Arbeitsbefreiung erteilt werden, wenn die dienstlichen oder betrieblichen Verhältnisse es gestatten.
Auch insoweit handelt es sich um eine Ermessensentscheidung des Arbeitgebers, jedoch ist der Freistellungsanspruch als unbezahlter bereits zu gewähren, wenn vernünftige, nachvollziehbare dienstliche oder betriebliche Gründe nicht entgegenstehen.
Wie der Protokollnotiz zu Absatz 3 Satz 2 zu entnehmen ist, können hierzu auch Anlässe gehören, für die nach Absatz 1 kein Anspruch besteht, wie etwa der Umzug aus privaten Gründen oder die über Absatz 1 hinausgehende Arbeitsbefreiung wegen Krankheit eines zu pflegenden Kindes. Anzuerkennen ist ebenfalls die Eheschließung des Beschäftigten, der Tod der Großeltern, Schwiegereltern, Stiefeltern und Geschwister, Taufe, Erstkommunion, Konfirmation und Firmung eines Kindes und silberne Hochzeit des Beschäftigten.
Kurzfristig i.S.d. § 29 Abs. 3 S. 2 TVöD wird eine Freistellung sein, soweit diese dem in Absatz 1 benannten Umfang entspricht.
In der Praxis kommt Absatz 3 keine große Bedeutung zu, da die Hürde für Satz 1 entsprechend hoch ist und Satz 2 kaum von den Beschäftigten begehrt wird, da diese auf das Entgelt verzichten müssen.
5.Arbeitsbefreiung für gewerkschaftliche Zwecke gem. § 29 Abs. 4 TVöD
128
Absatz 4 Satz 1: Arbeitsbefreiung für die Teilnahme an gewerkschaftlichen Tagungen:
bis zu acht Werktage im Jahr
Unter Fortzahlung des Entgelts kann Gewerkschaftsvertretern für die Teilnahme an Tagungen Arbeitsbefreiung gewährt werden, sofern nicht dringende dienstliche Interessen entgegenstehen. Diese Kann-Bestimmung setzt wiederum eine ermessenfehlerfreie Entscheidung des Arbeitgebers voraus.
Den Antrag auf Arbeitsbefreiung hat nicht etwa die das Mitglied anfordernde Gewerkschaft, sondern der gewählte Vertreter selbst zu stellen.
Nicht erfasst vom Begriff der Tagungen i.S.d. Vorschrift sind gewerkschaftliche Schulungsveranstaltungen. Ebenso wenig fallen die Teilnahme an einer Demonstration oder Werbeveranstaltungen hierunter.
129
Absatz 4 Satz 2: Arbeitsbefreiung für die Teilnahme an Tarifverhandlungen:
ohne zeitliche Begrenzung
Auf Anfordern einer der vertragsschließenden Gewerkschaften kann dem Beschäftigten unter Fortzahlung des Entgelts Arbeitsbefreiung zur Teilnahme an Tarifverhandlungen erteilt werden.
Im Gegensatz zur Teilnahme an Tagungen können dienstliche Interessen nicht entgegengehalten werden wie auch die Dauer zeitlich unbegrenzt ist.
Nicht umfasst werden hiervon allerdings gewerkschaftsinterne Vor- oder Nachberatungen.
6.Arbeitsbefreiung für die Tätigkeit in Berufsbildungsausschüssen und in Organen von Sozialversicherungsträgern nach § 29 Abs. 5 TVöD
130
Stehen dringende dienstliche oder betriebliche Interessen nicht entgegen, kann zur Teilnahme in Prüfungs- und Berufsbildungsausschüssen sowie Tätigkeiten für Organe von Sozialversicherungsträgern Arbeitsbefreiung unter Fortzahlung des Entgelts nach § 29 Abs. 5 TVöD gewährt werden. Es bedarf auch hierbei einer Ermessensentscheidung nach § 315 BGB.
7.Arbeitsbefreiung in Anlehnung an besondere Tatbestände der SUrlV
131
Wie bereits erwähnt, können weitergehende Arbeitsbefreiungstatbestände, soweit nicht ausdrücklich in § 29 TVöD erwähnt, den Tarifbeschäftigten nicht gewährt werden.
Da sich jedoch herausgestellt hat, dass es darüber hinausgehende förderungswürdige Anwendungsfälle für eine Freistellung gibt, hat das BMI mit Rundschreiben vom 20.7.2016 – D5-31001/7#18 – die entsprechende Anwendung der SUrlV der Beamten hinsichtlich einzelner Fallkonstellationen gebilligt.