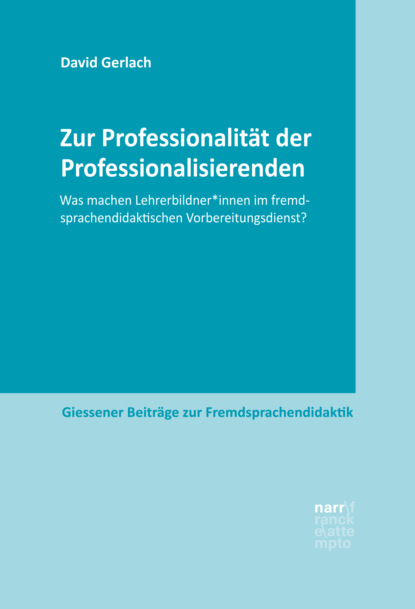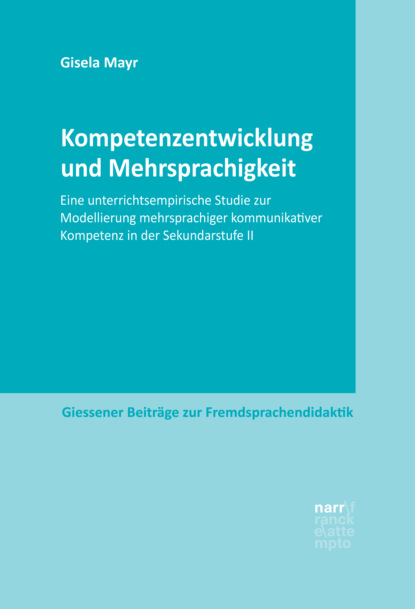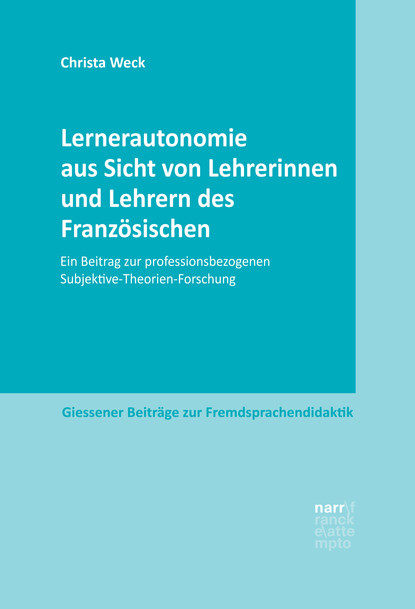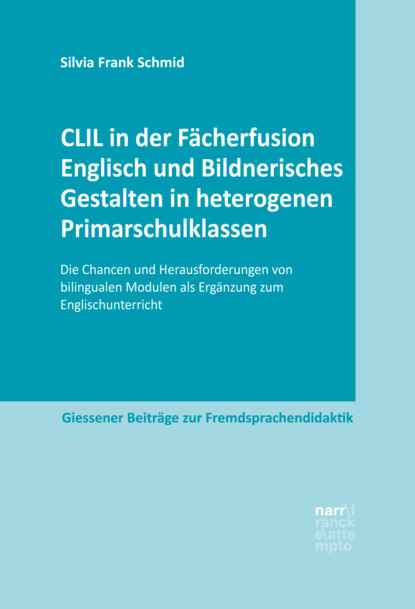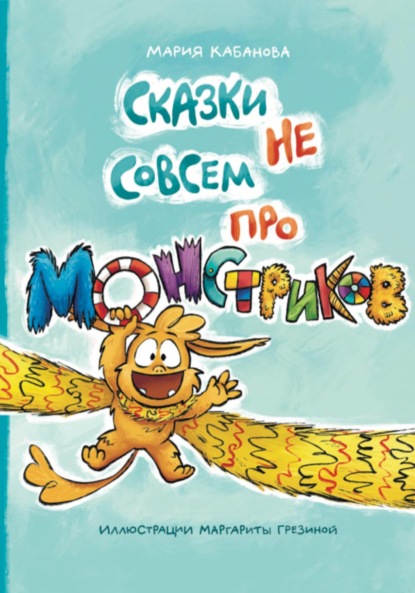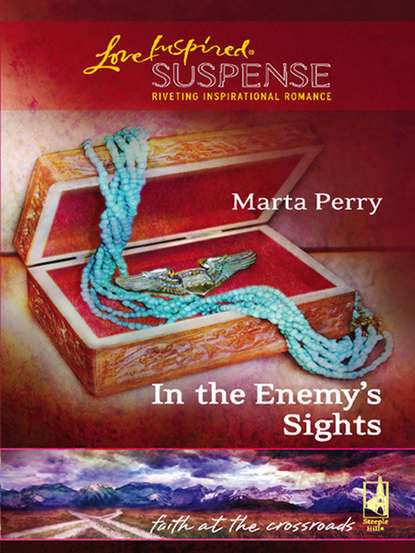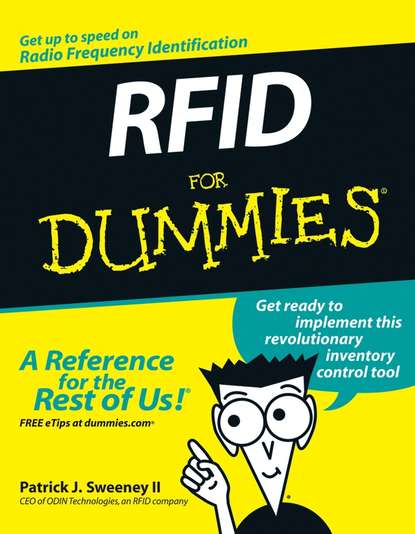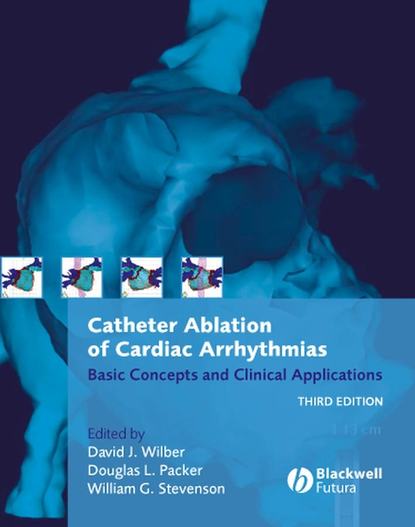Kooperatives Lernen im Englischunterricht
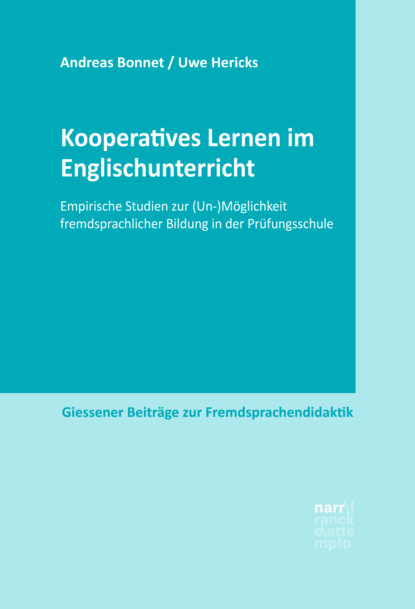
- -
- 100%
- +
Metaanalytische Befunde zu schülerseitigen Effekten von KL über verschiedene Domänen hinweg. Der Grad der empirischen Fundierung ist in der rechten Spalte benannt (A=Johnson/Johnson 1994; B=Shachar 2003).
2.4.2 Befunde der Unterrichtsforschung
Die generell positive Wirkung von KL in unterschiedlichen Domänen wird auch durch weitere Untersuchungen gestützt. So konstatiert Shachar (2003, 103):
Research on co-operative learning conducted during the past three decades in several countries has consistently documented the positive effects of co-operative learning and its contribution to the improvement of students’ skills […].
Dennoch steht seit den 1990er Jahren die Frage im Raum, inwieweit KL leistungsschwächere Schüler*innen stärker fördere als leistungsstarke, oder ob es leistungsstarke Schüler*innen sogar benachteilige (vgl. z. B. Li/Adamson 1992). Auf der Basis von acht Studien, die alle über mehrere Monate in kontrolliertem Experimentaldesign mit Lehrerschulung und begleitender Unterrichtsbeobachtung durchgeführt wurden, kommt Shachar (2003) zu dem Ergebnis, dass leistungsschwache Schüler*innen (low achievers) durch KL die größten Zugewinne beim fachlichen Lernen und bei der Identifikation mit der Schule erreichen: Während leistungsschwache Schüler*innen in KL gegenüber frontal-instruktiver Lehrerzentrierung signifikante Zugewinne in Leistungstests in sieben Bereichen in einer Gesamthöhe von 9,3 Prozent erzielten, seien es bei Schüler*innen mittlerer Leistungsstärke vier Bereiche und insgesamt 7,5 Prozent und bei Leistungsstarken zwei Bereiche und insgesamt 1 Prozent (ebd., 109, 112). Mit gleicher Tendenz verteilten sich die Ergebnisse bei Fragen zur Schulidentifikation. Leistungsschwache Schüler*innen erzielten in KL gegenüber frontal-instruktiver Lehrerzentrierung hohe Zugewinne, während Leistungsstarke sogar Verluste zeigten.
Während dies bisweilen (z. B. Li/Adamson 1992) als Schwäche von KL interpretiert wurde, sieht Shachar darin eher einen Verweis auf die Schwäche des Schulsystems. Solange schulische Leistung einseitig akademisch definiert werde und das Sprachspiel des Frontalunterrichts dominiere, wären jene Schüler*innen im Vorteil, die konkurrenzorientiert und dominant diese Sozialform beherrschen. Es sei daher kein Wunder, dass diese Schüler*innen frontal-instruktive Lehrerzentrierung präferierten. Anschließend an eine typische Schüleräußerung konstatiert Shachar:
‚If we were studying only for intellectual challenge, this would be a good method. But we are studying for the exams, so it’s not appropriate.‘ In other words, the traditional WC [whole class instruction, AB] method successfully eradicates students’ intellectual gratification and interest and turns school studies into a mechanical process aimed exclusively at a specific target (Shachar 2003, 115).
Ironischerweise zeigen die Befunde von Shachar, dass gerade KL dazu führt, dass die Schüler*innen ihre schulische Situation reflektieren. Erst damit kommen sie somit zu einer Art von Lernerautonomie, die sie zu sozialer Partizipation befähigt (Benson 2001; Bonnet/Bracker 2018). Shachar zieht daher aus ihrem Literaturüberblick das Fazit, dass frontal-instruktive Lehrerzentrierung allen Schüler*innen schade. Den Leistungsschwachen, weil sie fachlich zurückbleiben und ein negatives Selbstkonzept entwickeln. Den Leistungsstarken, weil ihr Wertespektrum begrenzt bleibe auf „a narrow individualism and competition for high grades“ (Shachar 2003, 116f.), anstatt ihre in den Gruppen gezeigten Fähigkeiten der solidarischen Hilfestellung, der Gruppenorganisation und ggf. -leitung und der Konfliktschlichtung zu würdigen und auch durch Noten zu belohnen.
Diese Interpretation wird durch die Ergebnisse von Buchs/Butera (2015) bestätigt. Auf der Basis einer umfassenden Sichtung der Literatur und den von ihnen selbst durchgeführten Studien stellen sie signifikante Unterschiede in der Kooperativität der Gruppenarbeiten und nachfolgend in der Erreichung von dem KL zugeschriebenen positiven Effekten fest. Das Kernproblem sei, dass bedingt durch eine einseitig auf soziale Leistungsnormen fokussierte schulische Sozialisation auch im KL eine Orientierung auf sozialen Vergleich durchschlagen könne, die das Selbstkonzept insbesondere schwächerer Schüler*innen gefährde:
When students endorse mastery goals, they may perceive other students as relevant sources of information, offering means for progressing and improving their competence. They are likely to perceive strong interdependence with others. Thus, mastery goals can foster student involvement in exchange of information and cooperation. In contrast, students focused on performance goals may perceive other students as potential competitors. As they need to outperform others to affirm their own competence, they are likely to perceive negative interdependence and reduce their willingness to cooperate. This may decrease the benefit of social interactions for learning outcomes (ebd., 207).
Wolle man ernsthaft Effekte von KL bestimmen, genüge es daher nicht, KL formal über Sozialformen zu definieren, sondern man müsse die realisierte Leistungsnorm und besser noch die in den Gruppenprozessen tatsächlich zustande kommende Kooperativität empirisch bestimmen. Empirisch kommen sie außerdem zu dem Befund, dass eine derartige Orientierung besser durch Zuweisung unterschiedlichen Materials als durch Bearbeitung identischen Materials durch die Lernenden zu erreichen sei (ebd., 205). Zusätzlich zu individueller Leistungsstärke und realisierter Zielstruktur wird schließlich die individuelle Ungewissheitstoleranz als für den Ertrag aber auch die Angemessenheit von KL in einem gegebenen Kontext diskutiert. Auf der Basis von vier umfassenden Studien in Deutschland, dem Iran und Kanada folgern Huber et al. (1992, 20), dass KL v. a. für Lernende mit ausgeprägter Ungewissheitsorientierung förderlich sei und dass eher auf Gewissheit orientierte Lernende auf KL und andere Inszenierungsformen mit erhöhter Ungewissheit besonders vorbereitet werden müssten.
Auf dieser Basis kommt man zu dem Ergebnis, dass KL sowohl im kognitiven Bereich als auch in Hinblick auf emotionale und soziale Aspekte bessere Wirkungen erzielt als individualisierte oder auf Konkurrenz angelegte frontal-instruktiv lehrerzentrierte Inszenierungsformen. Dabei hat sich ebenfalls empirisch gezeigt, dass nicht Gruppenarbeit an sich, sondern das Zustandekommen kooperativer Interaktion in einer auf Können fokussierten Zielstruktur für positive Effekte verantwortlich zu sein scheint. Damit sind zentrale empirische Befunde zu KL referiert. Allerdings haben bis hierher Fremdspracherwerb, geschweige denn Fremdsprachenunterricht, noch keine Rolle gespielt. Was ist dazu zu sagen?
2.4.3 Befunde der Fremdsprachenforschung
Aus der Perspektive der Fremdsprachenforschung werden die allgemeinen Wirkungen von KL auf die Lernenden nicht in Zweifel gezogen (vgl. z. B. Oxford 1997; Würffel 2007). Die bereits angesprochenen Relativierungen in Bezug auf Leistungsstärke und Ungewissheitstoleranz sind durch Oxford (1997, 445) ebenfalls bereits in der Fremdsprachenforschung rezipiert worden. In Hinblick auf die Anwendung der Mikromethoden des KL im Fremdsprachenunterricht ist es ein Allgemeinplatz, dass KL den Schüler*innen eine Art kommunikativen Schonraum zur Verfügung stellt. Sie können zunächst mit ihren Mitschüler*innen sprechen, bevor sie sich in der ganzen Klasse äußern müssen und in manchen Methoden (z. B. Placemat) werden die sprachlichen Anforderungen langsam gesteigert: Die anspruchsvolle mündliche Kommunikation wird durch schriftliche Aktivitäten vorbereitet. Diese Annahmen klingen plausibel, wurden allerdings nie systematisch geprüft. Dies galt lange Zeit für viele Annahmen bezüglich KL und Fremdsprachenunterricht. Seit dem Befund von Würffel (2007, 4), die empirische Belege noch als sehr unvollständig betrachtete, sind einige Arbeiten hinzugekommen. Insgesamt ist die empirische Evidenz aber immer noch sehr lückenhaft. Die gefundenen Effekte lassen sich in drei Bereiche kategorisieren (vgl. Tab. 2.2), die im Folgenden kurz vorgestellt werden.
Der erste Bereich umfasst Wirkungen, die mit der Interaktionsstruktur verbunden sind und daher zumindest mittelbar den Fremdspracherwerb beeinflussen. Wenn auch schwach, so doch jeweils mindestens mit einer empirischen Studie sind folgende Wirkungen belegt. Rein quantitativ kann man davon ausgehen, dass die Zeit, die jede*r Lernende in der Zielsprache kommuniziert, gegenüber frontalen Unterrichtsinszenierungen deutlich erhöht ist (Haitink/Haenen 2002; Würffel 2007; Zhu/Mitchell 2012). Auch ist eindeutig dokumentiert, dass der Umfang mündlicher (Shachar/Sharan 1994) und schriftlicher Sprachproduktion (Shachar/Eitan 2000) durch KL um bis zu 50 Prozent gegenüber frontal-instruktiver Lehrerzentrierung zunimmt. Darüber hinaus scheint sich auch die Qualität der Interaktion zu verändern. So finden sich Belege dafür, dass bestimmte kooperative Methoden – in diesem Falle jigsaw-activities und peer-response-activities – intensiviertes negotiation of meaning im linguistischen Sinne der sprachlichen Disambiguierung und gegenseitigen Verständnissicherung, die gemäß Interaktionshypothese (vgl. z. B. Long 1996) den Fremdspracherwerb fördert, zur Folge haben (Chinnery 2008; Zhu/Mitchell 2012). In gleicher Weise besteht begründeter Anlass zu der Vermutung, dass klassische Methoden des KL, hier z. B. das Gruppenpuzzle, bei entsprechender Begleitung durch sprachliche Übungen tiefere Argumentationen und einen höheren Elaborationsgrad der peer-Interaktion bewirken (Jacobs/Ferrell 2001; Haitink/Haenen 2002; Kronenberg/Souvignier 2005).
Immer wieder genannt, aber nicht empirisch belegt, sind folgende Effekte. Rein quantitativ wird davon ausgegangen, dass sich für die einzelnen Lernenden mehr Übungsmöglichkeiten ergeben (Würffel 2007). Hinsichtlich der Interaktionsqualität wird angenommen, dass sich eine höhere Redundanz der Äußerungen der Lernenden und eine bessere Passung der Äußerungen zur Sprachkompetenz der peers ergibt (Würffel 2007) und dass in den kooperativen Phasen eine größere Vielfalt unterschiedlicher Sprechhandlungen vollzogen wird (Schwerdtfeger 2000). Beides würde den Fremdspracherwerb im Sinne der Interaktions- und Outputhypothese (vgl. z. B. Swain 1993) zumindest mittelbar fördern.
Erzeugte Wirkung Quelle Empirische Belegtheit Interaktionsstruktur Erhöhung der Zeit für authentische Kommunikation in der Zielsprache Haitink/Haenen 2002; Würffel 2007; Zhu/Mitchell 2012 Mind. 1 emp. Studie Deutlich umfassendere mündliche und schriftliche Sprachproduktion Shachar/Sharan 1994; Shachar/Eitan 2000 Mind. 1 emp. Studie Intensive negotiation of meaning im linguistischen Sinne der sprachlichen Disambiguierung in jigsaw-activities und bei peer-response-activities Chinnery 2008; Zhu/Mitchell 2012 Argumentative Begründung Vielfältigere Diskursmuster und dadurch Realisierung einer größeren Vielfalt von Sprechakten Schwerdtfeger 2000 Argumentative Begründung Tiefere Argumentationen der Lernenden und höherer Elaborationsgrad der peer-Interaktion bei entsprechendem Training Jacobs/Ferrell 2001; Haitink/Haenen 2002; Kronenberger/Souvignier 2005 Mind. 1 emp. Studie Mehr Übungsmöglichkeiten für einzelne Lernende Würffel 2007 Argumentative Begründung Höhere Redundanz der Äußerungen und bessere Passung zur Sprachkompetenz der Mitlernenden Würffel 2007 Argumentative Begründung Förderung sprachlicher (Teil-)fertigkeiten Förderung des Schreibprozesses der Individuen und Erweiterung der Schreibkompetenz Faistauer 1997 Argumentative Begründung Förderung der Lesekompetenz durch virtuelles (untutorierte SchreibWIKIS) und reales (Lesen im Gruppenpuzzle) KL Platten 2008; Law 2011 Mind. 1 emp. Studie Zunahme der Englischleistung durch KL Sharan 1984 Argumentative Begründung Emotionale und metakognitive Effekte Gruppenzusammenhalt verstärkt motivationale Faktoren und damit sowohl mittelbar als auch unmittelbar den Kompetenzerwerb. Dramabezogenes KL fördert autonome Motivation Dörnyei 1997; Law 2011 Mehrere emp. Studien Emotionen erweisen sich selbst als soziale Konstruktionen Imai 2010 Argumentative Begründung Verstärkte Reflexivität Haitink/Haenen 2002; Rankes 1999 Mind. 1 emp. StudieTab. 2.2:
Befunde zu schülerseitigen Effekten von KL im Bereich des Fremdsprachenlernens.
Der zweite Bereich umfasst positive Auswirkungen von KL auf sprachliche (Teil-)Fertigkeiten und damit unmittelbare Effekte im Bereich des Fremdspracherwerbs. Diese Effekte sind jeweils durch eine empirische Untersuchung und damit schwach belegt. So wird zum einen eine gegenüber nicht-kooperativen Inszenierungen erhöhte Förderung der Lesekompetenz durch virtuelle, hier: untutoriertes Schreiben von Wikis (Platten 2008), und reale Kooperation, hier: Lesen im Gruppenpuzzle (Law 2011), festgestellt. Zum anderen scheint es in kooperativen Inszenierungen zur Erweiterung der Schreibkompetenzen und einer Förderung des individuellen Schreibprozesses zu kommen (Faistauer 1997). Eine generelle Zunahme der Englischleistung durch KL misst Sharan (1984).
Der dritte Bereich schließlich umfasst die emotionalen und metakognitiven Effekte, die wiederum mittelbar auf den Fremdspracherwerb einwirken. Relativ gut durch mehrere empirische Untersuchungen, die von Dörnyei (1997) referiert werden, ist belegt, dass KL den Gruppenzusammenhalt (cohesion) erhöht und damit motivationale Faktoren wie die Motivation selbst aber auch andere Faktoren wie z. B. Selbstwirksamkeit fördert. Diese Faktoren wiederum stehen in engem Zusammenhang mit der Fachkompetenz, die hier als Sprachkompetenz aufzufassen ist. Eine weitere Studie berichtet, dass mit Mitteln der Dramapädagogik (z. B. Standbild) arbeitende Methoden des KL die autonome Motivation der Lernenden erhöhen, die wiederum in hohem Zusammenhang mit dem Erwerb sprachlicher Kompetenz gesehen wird (Law 2011). Einen sehr interessanten Befund fördert eine aktuelle Studie aus Japan zu Tage. Während die emotionalen Effekte des KL bis vor kurzem immer in Bezug auf die Auswirkungen auf die Individuen beforscht wurden (s.o.), kann eine sehr innovative Studie (Imai 2010) mit großem empirischen Aufwand – neben Fragebögen und Interviews kommt auch die Videographie privater Treffen der Arbeitsgruppen zum Einsatz – rekonstruieren, wie Emotionen sich im Verlauf der gemeinsamen Arbeit verändern und wie sie im Sinne gemeinsamer emotionaler Aushandlungen sozial konstruiert werden. Damit findet sich im Bereich der Emotionen ein ähnliches Phänomen der Ko-Konstruktion, wie es insbesondere im Rahmen von Kollaboration für die kognitive Wissenskonstruktion angenommen wird. Im metakognitiven Bereich finden sich ebenfalls schwache, aber immerhin vorhandene empirische Belege dafür, dass es in kooperativen Inszenierungen zu verstärkter Reflexivität kommt.
Im Lichte dieser Zusammenschau lässt sich insgesamt resümieren, dass es zwar keinesfalls abschließende, aber durchaus sehr umfassende empirische Hinweise darauf gibt, dass KL den Fremdspracherwerb fördert. Dies geschieht sowohl mittelbar, nämlich einerseits über die Intensivierung der Kommunikation und die Verstärkung von sprachliches Lernen unterstützenden Merkmalen der Interaktion, und andererseits über die positive Beeinflussung von den Fremdspracherwerb steigernden emotionalen Faktoren, wie z. B. Motivation. Darüber hinaus sind auch unmittelbare Wirkungen belegt, nämlich eine gegenüber nicht-kooperativen Inszenierungen erhöhte direkte Verbesserung sprachlicher Teilfertigkeiten wie Lese- oder Schreibkompetenz.
2.4.4 Befunde der Lehrerforschung
Damit ist die Frage der schülerseitigen Effekte umfassend diskutiert. Wie sieht es also mit der Forschung zu Lehrer*innen im KL aus? Aber muss man sich überhaupt mit ihnen beschäftigen, denn schließlich sollen sie sich ja gerade überflüssig machen? Ja, man muss. Dies zu begründen bedarf gar nicht mehr der – ohnehin arg dekonstruierten (Herzog 2014) – Hattie-Studie, sondern ein Blick in die Forschung zu KL selbst genügt. Wie bereits ausgeführt wurde (vgl. Kap. 2.2.2), ist es nicht die Sozialform, sondern die unterrichtliche Interaktionspraxis, die die Kooperativität des Unterrichts und damit dessen Wirkungen hervorbringt. Diese Praxis, so die oben bereits zitierte Studie (Tesch 2010) weiter, wird wiederum stark durch die von den Lehrer*innen in den Unterricht hineingetragenen Orientierungen bestimmt. Der Zusammenhang zwischen KL und der Professionalisierung von Lehrer*innen, auf den dieser Befund verweist, ist allerdings ein bis auf Praxis bezogene Veröffentlichungen (z. B. Green/Green 2005) weitgehend unbestelltes Feld.
Vorläufig lässt sich sagen, dass der Zusammenhang zwischen KL und der Professionalität und Professionalisierung von Lehrer*innen in zwei Richtungen wirkt. Zum einen stellt sich die Frage, ob und wenn ja auf welche Weise Lehrer*innen das Zustandekommen von Kooperativität durch Vorgaben und begleitendes Handeln beeinflussen können und wie dieses Handeln zustande kommt. Anders gefragt: Wie schlagen sich die Orientierungen der Lehrenden im Unterricht nieder und woher kommen sie? Zum anderen stellt sich die Frage, wie die Inszenierung von KL auf die Lehrenden zurückwirkt. Anders gefragt: Wie werden die Orientierungen von Lehrer*innen durch kooperativen Unterricht verändert? Wurde bislang – sowohl in der Forschung als auch v. a. in der Praxisliteratur – gefragt, was Lehrer*innen mit KL machen, so fragt diese Studie nun darüber hinaus, warum sie das machen und was KL mit den Lehrer*innen macht. Diese Teilfragen werden durch das Zusammenspiel der Teilstudien zum Unterricht und zur Professionalisierung der Lehrer*innen bearbeitet.
Was lässt sich zum Stand der Lehrerforschung im Bereich des KL sagen? Zum einen finden sich Veröffentlichungen sowohl im deutschen (z. B. Pauli/Reusser 2000), als auch im englischen Sprachraum (z. B. Gillies 2007; Gillies/Boyle 2010), die den Forschungsstand der Lehrerforschung zu KL resümieren und die Veränderung der Lehrerrolle beim KL betonen. Unter der Überschrift „teachers’ responsibilities in establishing cooperative learning“ fasst Gillies (2007, 193–217) die Befunde zahlreicher Untersuchungen zusammen. Unter Berufung auf drei Studien (Ayres/Sawyer/Dinham 2004; Dolezal et al. 2003; Walker 2000) bestimmt sie zunächst Eigenschaften von Lehrer*innen, in deren Unterricht besonders erfolgreich gelernt wird. Diese Lehrer*innen besitzen demnach emotionale (Freundlichkeit, Zugänglichkeit, menschliche Wärme, Begeisterung für das Fach) und kognitive (Stellung und Durchsetzung hoher inhaltlicher Anforderungen, hohes Fachwissen, großes Methodenrepertoire) Charakteristika, die dazu führen, dass ihre Schüler*innen inhaltlich herausgefordert werden, Risiken eingehen, große kognitive Verarbeitungstiefe der Inhalte erreichen, miteinander kooperativ arbeiten und Verantwortung übernehmen. Um diese Ziele im Rahmen von KL zu erreichen, müssten Lehrer*innen laut Gillies v. a. vier Dinge gelingen: das Setzen von Erwartungen für die kooperative Gruppenarbeit, die Förderung von dem Kompetenzerwerb dienenden (kommunikativen) Handlungsmustern der Schüler*innen, die Aufgabenstellung, die Bereitstellung von Feedback zu den beobachteten Lernfortschritten der Schüler*innen. Diese vier Bereiche, die man auch als aufeinander folgende Schritte bei Einführung von KL auffassen kann, werden im Folgenden nacheinander kurz diskutiert.
Das Setzen der Erwartungen beginnt laut Gillies (2007, 198ff.) damit, den Schüler*innen zu verdeutlichen, dass es der Lehrperson ernst damit sei, dass die Schüler*innen zusammenarbeiten, Ideen und Lernmittel teilen, sich gegenseitig unterstützen und Konflikte demokratisch lösen. Unter Bezugnahme auf mehrere empirische Untersuchungen (u.a. Gillies/Ashman 1998; Mercer 1996; Webb/Farivar, 1994) schließt sie, dass es in dieser ersten Phase neben dem Aufbau von Vertrauen und gegenseitigem Verständnis v. a. darum gehe, gemeinsam mit den Schüler*innen soziale Normen der Zusammenarbeit auszuhandeln und das Ergebnis in geeigneter Form (z. B. als Aushänge im Klassenraum) als Merkposten für alle bereitzustellen.
Im nächsten Schritt sei es erforderlich, dass die Lernenden geeignete Handlungsmuster erwerben. Unter Bezugnahme auf weitere Studien begründet Gillies zunächst, dass dazu sinnvollerweise die Verwendung von Kooperationsskripts wie z. B. die wechselseitige Übernahme der Rolle von Lehrer*in und Lerner*in im reziproken Lehren (O’Donnell/Dansereau 2000), die Ko-Konstruktion von Wissen durch Erstellung gemeinsamer Produkte wie z. B. einer Mind-Map (Boxtel et al. 2002) oder die Verpflichtung auf das Begründen von Aussagen (Chinn/O’Donnell/Jinks 2000) dienen könne. Um von diesem grundlegenden Niveau des reinen Verstehens zu höheren Denkoperationen zu gelangen, seien umfassendere Skripts wie z. B. das Modell „ASK to THINK-TEL WHY“ (King 1997) sinnvoll, die neben dem gegenseitigen Erklären und Begründen auch das gezielte Herstellen und Hinterfragen von Zusammenhängen und die Reflexion eigener Lösungswege und Denkschemata enthalten. Eine ganze Reihe weiterer Studien (z. B. Webb 1991, 1992; Webb/Mastergeorge 2003) deuten darauf hin, dass der Erfolg von KL nicht nur von der Fähigkeit zum Erklären, sondern in gleicher Weise vom eindeutigen Anzeigen eines Hilfebedürfnisses und dem präzisen Formulieren der eigenen Fragen abhängt.
Diese Befunde decken sich mit den im vorangegangenen Teil referierten Studien (z. B. Law 2011), und Kronenberger und Souvignier (2005) weisen in einer Studie zum Gruppenpuzzle mit 9-jährigen nach, dass ein zusätzliches Fragetraining zwar nicht in der Expertenphase, wohl aber in der Stammgruppenphase, in der das eigentliche peer-teaching stattfindet, das Elaborationsniveau der Interaktion deutlich anhebt. Insgesamt kann daher auch für den Fremdsprachenunterricht davon ausgegangen werden, dass die gezielte Vermittlung von Interaktionsmustern erforderlich ist. Hier kommt allerdings eine weitere Ebene hinzu, denn es existieren auch noch sprachliche Anforderungen auf der Ebene der Redemittel. So referiert Würffel (2007, 3) den Befund von Legutke (2003, 235), dass nicht nur die sozialen Kompetenzen, sondern auch die sprachlichen Fertigkeiten für KL geschult werden müssten. Dies gilt über die sprachlichen Mittel im engeren Sinne hinaus auch für das Frage- und Erklärungsverhalten.
Der dritte Schritt, das Stellen von Aufgaben, wird von Gillies nicht auf inhaltlicher Ebene, sondern vielmehr auf der Ebene der für die Aufgabenbearbeitung notwendigen kognitiven und sprachlichen Handlungen diskutiert. So unterscheidet sie mit Cohen (1994) wenig komplexe (low-level) Kooperation, in der lediglich Informationen und Erklärungen ausgetauscht werden, von komplexer (high-level) Kooperation, in der auch das eigene Vorgehen reflektiert und ausgehandelt werden müsse. Während die komplexeren Aufgaben den Vorteil hätten, Reflexion und Metakognition zu fördern, bestehe bei ihnen die Gefahr, dass sich Schüler*innen in den Diskussionen verlören und dadurch die für den Lernerfolg entscheidende Anzahl auf den Aufgabeninhalt bezogener Interaktion verringere. Um dieses Problem zu lösen, verweist Gillies auf den Befund einer Vergleichsstudie von Cohen et al. (2002), in der die Bereitstellung klarer Erwartungen hinsichtlich des zu erstellenden Produkts (z. B. in Form eines schriftlichen Erwartungshorizonts), die Gruppeninteraktion intensivierte und die Produkte eindeutig verbesserte. Gemäß den Erkenntnissen von Buchs und Butera (2015) könnte diese übermäßige Fokussierung auf Produkte allerdings auch eine abträgliche Leistungsorientierung zur Folge haben. Dass Cohen et al. (2002) dies anscheinend nicht im Blick hatten, zeigt sowohl die Komplexität des KL als auch die Fortschritte in dessen Beforschung.