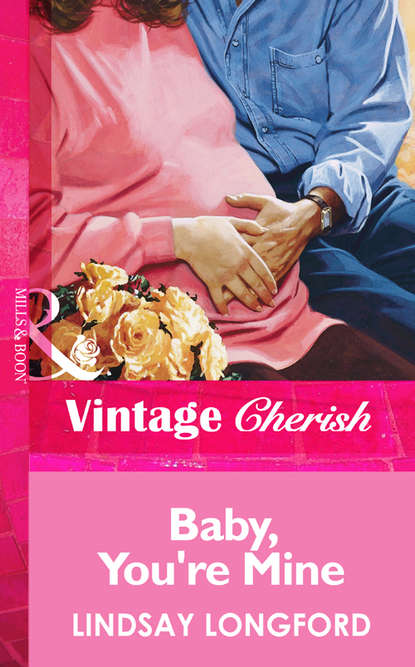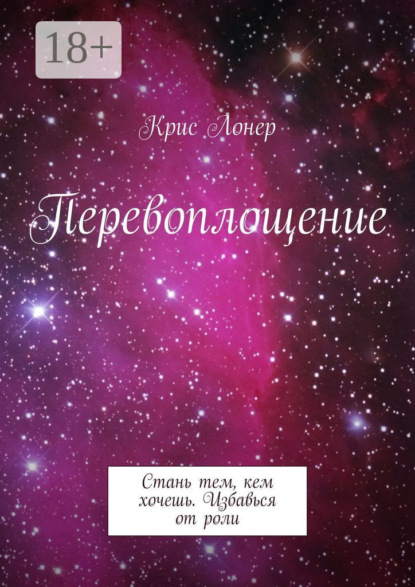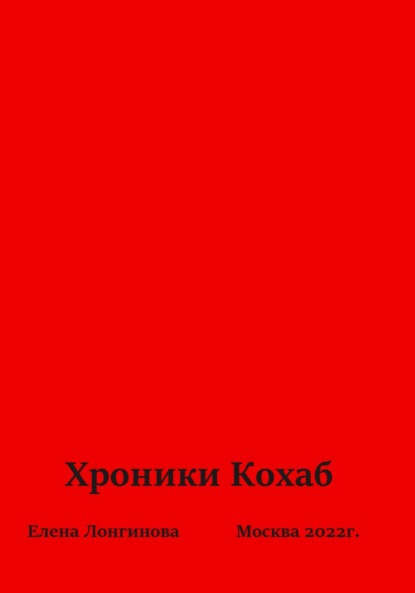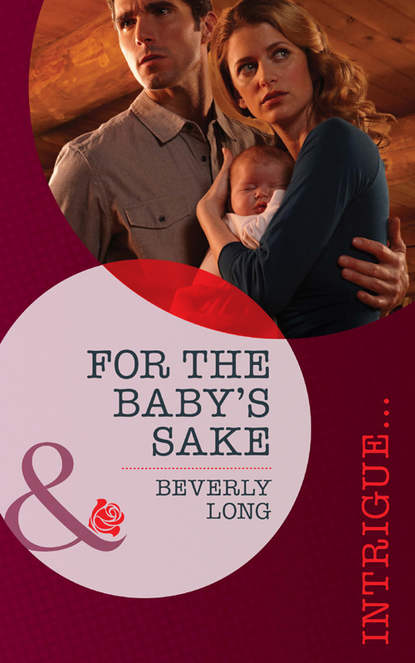Die rechtlichen Grundlagen der Europäischen Union
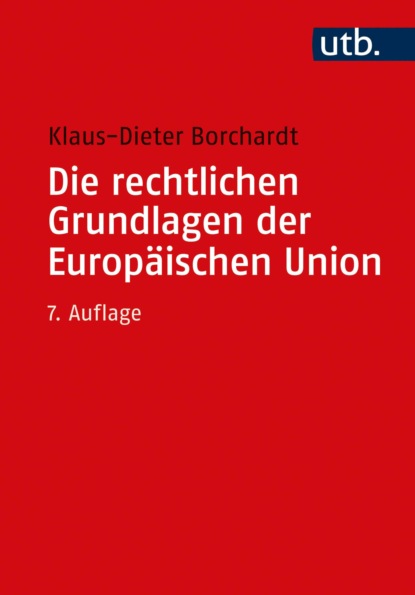
- -
- 100%
- +
[94] Nicht so weit wie die Assoziierungsabkommen gehen die sogenannten Kooperationsabkommen, die allein auf eine intensive wirtschaftliche Zusammenarbeit gerichtet sind. Solche Abkommen verbinden die EU u.a. mit den Maghreb-Staaten (Marokko, Algerien und Tunesien), den Mashrik-Staaten (Ägypten, Jordanien, Libanon und Syrien) und mit Israel.
3. Handelsabkommen (Art. 218 AEUV)
[95] Schließlich gibt es eine Vielzahl von Handelsabkommen, die mit einzelnen Drittstaaten, Gruppen von Drittstaaten oder im Rahmen internationaler Handelorganisationen auf zoll- und handelspolitischem Gebiet abgeschlossen werden. Die wichtigsten internationalen Handelsabkommen sind das „Übereinkommen zur Gründung der Welthandelsorganisation“ (World Trade Organisation „WTO“) und die in seinem Rahmen abgeschlossenen multilateralen Handelsabkommen, von denen als die wichtigsten zu nennen sind: das „General Agreement on Tariffs and Trade“ (GATT 1994), der „Antidumping- und Subventionskodex“, das „Allgemeine Übereinkommen über den Handel mit Dienstleistungen“ (GATS), das „Übereinkommen über handelspolitische Aspekte der Rechte des geistigen Eigentums“ (TRIPS) sowie die „Vereinbarung über Regeln und Verfahren zur Beilegung von Streitigkeiten“. Daneben haben in immer stärkerem Maße bilaterale Freihandelsabkommen gegenüber den multilateralen Abkommen an Boden gewonnen. Aufgrund der enormen Schwierigkeiten, im Rahmen der WTO multilaterale Liberalisierungsabkommen zu schließen (ein Beispiel sind die[S. 87] ernüchternden Ergebnisse der Verhandlungen der Doha-Agenda), haben sich alle großen Handelsnationen, darunter auch die EU, dem Abschluss bilateraler Freihandelsabkommen zugewendet. Beispiele für die EU sind der erfolgreiche Abschluss der Verhandlungen mit Süd-Korea, Kanada (CETA) Singapur, Japan, Neuseeland, Australien, Vietnam, Mexiko, Mercosur Staaten (Argentinien, Brasilien, Paraguay, Uruguay). Hingegen sind die Verhandlungen mit den USA (TTIP) gescheitert und durch ein Mandat für eine weit weniger weitreichende Übereinkunft betreffend die Abschaffung von Zöllen auf industrielle Güter ersetzt worden78. Sobald auch nur eine Bestimmung der Abkommen in die geteilte Zuständigkeit der EU und der Mitgliedstaaten fällt, z.B. eine Regelung zu Investment-Schiedsgerichten, kann die EU diese dann gemischten Freihandelsabkommen nur gemeinsam mit den Mitgliedstaaten und unter Mitwirkung der nationalen Parlamente abschließen79.
B. Ungeschriebene Rechtsquellen
[96] Den bisher aufgeführten Rechtsquellen der EU ist gemeinsam, dass es sich dabei um geschriebenes Unionsrecht handelt. Wie jede andere Rechtsordnung auch kann die Unionsrechtsordnung aber nicht ausschließlich aus geschriebenen Normen bestehen, weil jede Rechtsordnung Lücken aufweist, die durch ungeschriebenes Recht auszufüllen sind.
I. Allgemeine Rechtsgrundsätze
[97] Ungeschriebene Quellen des Unionsrechts sind zunächst die allgemeinen Rechtsgrundsätze80.
Dabei handelt es sich um Normen, die die elementaren Vorstellungen von Recht und Gerechtigkeit zum Ausdruck bringen, denen jede Rechtsordnung verpflichtet ist. Das geschriebene Unionsrecht, das im Wesentlichen nur wirtschaftliche und soziale Sachverhalte regelt, kann diese Verpflichtung nur zum Teil erfüllen, so dass die allgemeinen Rechtsgrundsätze eine der wichtigsten Rechtsquellen der EU darstellen. Durch sie können die vorhandenen Lücken geschlossen oder das bestehende Recht durch Auslegung im Sinne des Gerechtigkeitsprinzips fortentwickelt werden.
[S. 88]
[98] Die Verwirklichung der Rechtsgrundsätze erfolgt durch die Rechtsanwendung, insbesondere durch die Rechtsprechung des Gerichtshofs der EU81, der gemäß Art. 19 EUV „die Wahrung des Rechts bei der Auslegung und Anwendung der Verträge“ zu sichern hat.
[99] Bezugspunkte für die Ermittlung der allgemeinen Rechtsgrundsätze sind vornehmlich die gemeinsamen Rechtsgrundsätze der Rechtsordnungen der Mitgliedstaaten. Sie liefern das Anschauungsmaterial, aus dem die für die Lösung eines Problems notwendige Rechtsregel auf EU-Ebene entwickelt wird.
Zu diesen allgemeinen Rechtsgrundsätzen gehören etwa neben den Verfassungsgrundsätzen der Eigenständigkeit, der unmittelbaren Anwendbarkeit, des Vorrangs des Unionsrechts und der Grundsatz der Haftung der Mitgliedstaaten für Verletzungen des Unionsrechts auch die Gewährleistung der Grundrechte sowie die Grundsätze der Verhältnismäßigkeit und des Vertrauensschutzes, die inzwischen teilweise positiv-rechtlich geregelt sind (Charta der Grundrechte, Grundsatz der Verhältnismäßigkeit in Art. 5 Abs; 4 EUV und Protokoll Nr. 2.82.
II. Gewohnheitsrecht
[100] Zum ungeschriebenen Unionsrecht zählt daneben auch das Gewohnheitsrecht. Darunter versteht man durch Übung und Rechtsüberzeugung entstandenes Recht, das primäres oder sekundäres Recht ergänzt oder ändert. Die Möglichkeit der Existenz solchen Gewohnheitsrechts wird grundsätzlich anerkannt83. Die tatsächliche Herausbildung von Gewohnheitsrecht unterliegt auf der Ebene des Unionsrechts allerdings wesentlichen Grenzen.
Eine Grenze ergibt sich aus der Existenz eines speziellen Verfahren zur Vertragsänderung (Art. 48 EUV). Dadurch wird zwar die Herausbildung von Gewohnheitsrecht nicht schlechthin ausgeschlossen, jedoch verschärft diese Tatsache die Anforderungen, die an den Nachweis einer lang andauernden Übung und einer entsprechenden Rechtsüberzeugung zu stellen sind. Jedes Organhandeln der EU muss zudem seinen Geltungsgrund in den Unionsverträgen finden, nicht jedoch aufgrund des tatsächlichen Verhaltens und eines entsprechenden Rechtsbindungswillens. Daraus folgt, dass Gewohnheitsrecht im Range von Vertragsrecht in keinem Fall von den EU-Organen, sondern allenfalls von den Mitgliedstaaten unter den soeben beschriebenen verschärften Bedingungen ausgehen kann. Übungen und Rechtsüberzeugungen der[S. 89] EU-Organe können allerdings im Rahmen der Auslegung der von diesen Organen geschaffenen Rechtssätze herangezogen werden, wodurch unter Umständen die rechtliche und tatsächliche Tragweite des betreffenden Rechtsaktes geändert wird. Allerdings sind auch hierbei die durch das primäre Unionsrecht vorgegebenen Voraussetzungen und Grenzen zu beachten.
C. Absprachen zwischen den Mitgliedstaaten der EU
[101] Als letzte Rechtsquelle der EU sind die Absprachen zwischen den Mitgliedstaaten zu nennen. Diese werden zum einen getroffen, wenn es um die Regelung von Fragen geht, die zwar in einem engen Zusammenhang zur Tätigkeit der EU stehen, für die den EU-Organen aber keine Kompetenz übertragen worden ist.
I. Völkerrechtliche Abkommen
[102] Zunächst existieren echte völkerrechtliche Abkommen zwischen den Mitgliedstaaten, mit denen insbesondere die territoriale Beschränktheit nationaler Regelungen überwunden und einheitliches Recht auf Ebene der Union geschaffen werden soll. Dies ist vor allem von Bedeutung im Bereich des internationalen Privatrechts. Als Beispiele seien hier erwähnt:
• Übereinkommen über die gerichtliche Zuständigkeit und die Vollstreckung gerichtlicher Entscheidungen in Zivil- und Handelssachen vom 27.9.1968, in Kraft getreten am 1.2.197384; dieses Übereinkommen ist im Verhältnis zwischen den Mitgliedstaaten mit Ausnahme Dänemarks durch die Verordnung (EG) Nr. 44/2001 des Rates vom 22.11.2000 über die gerichtliche Zuständigkeit und die Anerkennung und Vollstreckung von Entscheidungen in Zivil- und Handelssachen (EuGVVO) ersetzt worden85.
• Übereinkommen über die gegenseitige Anerkennung von Gesellschaften und juristischen Personen vom 29.2.196886.
• Übereinkommen über die Beseitigung der Doppelbesteuerung im Falle von Gewinnberichtigungen zwischen verbundenen Unternehmen vom 23.6.199087.
[103] Die Mitgliedstaaten der EU können daneben völkerrechtliche Abkommen schließen, deren Regelungsgegenstand zwar in einem engen faktischen Zusammenhang mit der Tätigkeit der EU steht, für die aber keine Kompetenz an die EU-Organe übertragen worden ist. Zu nennen sind vor allem
• das Übereinkommen über das auf vertragliche Schuldverhältnisse anzuwendende Recht vom 19.6.198088,
[S. 90]
• die Vereinbarung über Gemeinschaftspatente vom 15.12.198989; diese Vereinbarung ist im Rahmen der Verstärkten Zusammenarbeit in die Verordnung (EU) Nr. 1257/2012 über das EU-Patent überführt und damit dem EU-Recht unmittelbar zugeordnet worden90,
• Das Abkommen über Stabilität, Koordinierung und Steuerung in der WWU (sog. Fiskalpakt 2012), das von 25 der damals 27 Mitgliedstaaten (Vereinigtes Königreich und die tschechische Republik blieben dem Pakt fern, Kroatien war noch kein Mitglied der EU) am 2. März 2012 unterzeichnet wurde.91
Diese Abkommen unterliegen uneingeschränkt den völkerrechtlichen Regeln.
II. Beschlüsse der im Rat vereinigten Vertreter der Regierungen der Mitgliedstaaten
[104] Auf diese Handlungsform wird zurückgegriffen, wenn Zweifel über die Reichweite der Zuständigkeit der EU bestehen, die zu treffende Regelung jedoch zur Verwirklichung der Vertragsziele als notwendig erachtet wird. Dabei handelt es sich um Übereinkommen der Mitgliedstaaten in Form eines Beschlusses der im Rat vereinigten Vertreter der Regierungen der Mitgliedstaaten, der gleichzeitig mit einem Unionsrechtsakt des als EU-Organ handelnden Rates verbunden wird92. Ihre formelle Zugehörigkeit zum Unionsrecht ist jedoch nur insoweit sichergestellt, als sich diese Rechtsakte in den Rahmen der Unionsverträge einfügen93. Dabei kommt es entscheidend darauf an, ob diese Rechtsakte eine von der Zuständigkeit der EU erfasste Politik betreffen und eine allgemeine Überzeugung über die Verbindlichkeit dieser Rechtsakte besteht94.
[S. 91]
D. Schematische Übersicht über die Rechtsquellen des Unionsrechts
(1) Primäres Recht:
– Unionsverträge (EUV, AEUV, EAGV), Charta der Grundrechte
– Allgemeine (Verfassungs-)Rechtsgrundsätze
(2) Völkerrechtsabkommen der EU
(3) Sekundäres Recht:
• Rechtsakte mit Gesetzescharakter
– Verordnungen
– Richtlinien
– Beschlüsse
• Rechtsakte ohne Gesetzescharakter
– Einfache Rechtsakte
– Delegierte Rechtsakte
– Durchführungsrechtsakte
• Unverbindliche Rechtsakte
– Empfehlungen und Stellungnahmen
• Sonstige Handlungen, die keine Rechtsakte sind
– Interinstitutionelle Vereinbarungen
– Entschließungen, Erklärungen, Aktionsprogramme
(4) Allgemeine Rechtsgrundsätze
(5) Übereinkommen zwischen den Mitgliedstaaten:
– Völkerrechtliche Übereinkommen
– Beschlüsse der im Rat vereinigten Vertreter der Regierungen der Mitgliedstaaten
Weiterführende Literatur: Bernhardt, Quellen des Gemeinschaftsrechts: Die „Verfassung der Gemeinschaft“, in: Kommission (Hrsg.), Dreißig Jahre Gemeinschaftsrecht, 1983, S. 77–90; Bleckmann, Die Rechtsquellen des Europäischen Gemeinschaftsrechts, NVwZ 1993, 824; Gilsdorf, Die Rechtswirkungen der im Rahmen von Gemeinschaftsabkommen erlassenen Organbeschlüsse, EuZW 1991, S. 459; Hirsch, Die Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs zu Assoziierungsabkommen, BayVBl. 1997, S. 449; Knauff, Ungeschriebenes Primärrecht, in: FS für Scheuing, 2011, S. 127; Kort, Zur europarechtlichen Zulässigkeit von Abkommen der Mitgliedstaaten untereinander, JZ 1997, S. 640; Ott, GATT und WTO im Gemeinschaftsrecht, 1996.
Конец ознакомительного фрагмента.
Текст предоставлен ООО «ЛитРес».
Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на ЛитРес.
Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.