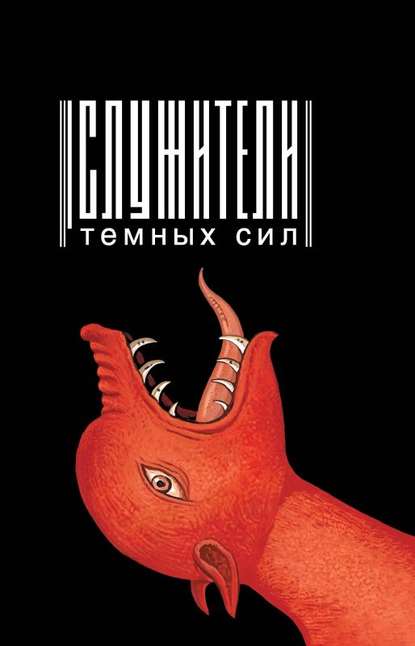Die rechtlichen Grundlagen der Europäischen Union
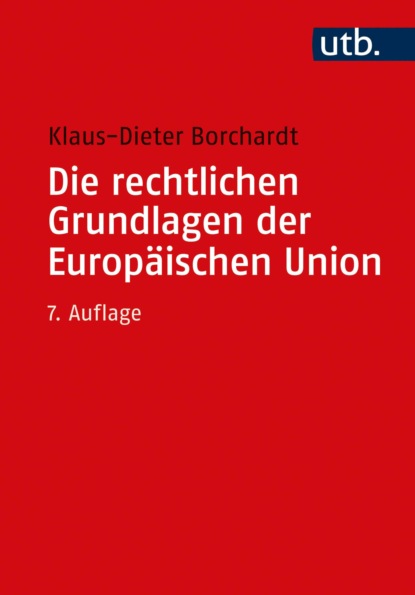
- -
- 100%
- +
d) Berufungsausschuss
V. Atypische Rechtsetzungsverfahren
1. Rechtsetzung im Bereich des Sozialen Dialogs
2. Rechtsetzung im Bereich der technischen Normen
B. Verwaltung
I. Kompetenzaufteilung zwischen EU und Mitgliedstaaten
1. Direkter Verwaltungsvollzug
2. Indirekter Verwaltungsvollzug
3. Verwaltungszusammenarbeit
[S. 16]
II. Verfahrensrechtliche Grundsätze im direkten Verwaltungsvollzug
1. Offenheit der Verwaltung
2. Effizienz der Verwaltung
3. Unabhängigkeit der Verwaltung
4. Rechtsstaatliche Grundsätze
5. Konkretisierungsauftrag
III. Verfahrensrechtliche Grundsätze im indirekten Verwaltungsvollzug
1. Vollzug unmittelbar anwendbaren EU-Rechts
2. Vollzug von mittelbar geltendem EU-Recht
IV. Die Haftung der Mitgliedstaaten für Verletzungen des EU-Rechts
1. Haftungsgrundlage
2. Haftungsgegenstand
3. Haftungsvoraussetzungen
a) Vorschrift, die dem Einzelnen Rechte verleiht
b) Hinreichend qualifizierter Verstoß
c) Kausalzusammenhang und Schaden
4. Umfang der Entschädigung
a) Berücksichtigung des entgangenen Gewinns
b) Schadensabwendungspflicht
5. Durchsetzung des Entschädigungsanspruchs
6. Rückwirkende Anwendung der Haftungsgrundsätze
C. Rechtsprechung
I. Die Direktklagen
1. Vertragsverletzungsverfahren (Art. 258–260 AEGV)
a) Funktion und Bedeutung
b) Einleitung des Verfahrens
c) Verfahrensstadien
d) Sanktionen bei Nichtbeachtung des Urteils des EuGH (Art. 260 AEUV)
e) Vertragsverletzungsklage durch einen Mitgliedstaat (Art. 259 AEUV)
2. Nichtigkeitsklage (Art. 263 AEUV)
a) Funktion der Nichtigkeitsklage
b) Zulässigkeit der Nichtigkeitsklage
c) Begründetheit der Nichtigkeitsklage
d) Nichtigerklärung
3. Untätigkeitsklage (Art. 265 AEUV)
4. Schadensersatzklage (Art. 268 i.V.m. Art. 340 AEUV)
a) Vertragliche Haftung
b) Außervertragliche Haftung
c) Haftung für rechtmäßiges Handeln
II. Rechtsmittelverfahren (Art. 256 Abs. 1 AEUV)
[S. 17]
1. Rechtsmittel gegenüber Entscheidungen des EuG
a) Beschränkung auf Rechtsfragen
b) Keine Veränderung des Streitgegenstandes
c) Rechtsmittelgründe
d) Urteil
2. Rechtsmittel gegenüber Entscheidungen der Fachgerichte
3. Rechtsmittel in Rechtssachen, die bereits Gegenstand einer zweifachen Prüfung waren
III. Das Vorabentscheidungsverfahren (Art. 267 AEUV)
1. Gegenstand des Vorabentscheidungsersuchens
a) Auslegungsfragen
b) Gültigkeitsfragen
c) Unzulässigkeit der Überprüfung nationalen Rechts
2. Vorlageberechtigung
3. Vorlageverpflichtung
a) Vorlagepflichtige Gerichte
b) Begriff des Rechtsmittels
c) Umfang der Vorlagepflicht
d) Sanktionen bei Verletzung der Vorlagepflicht
4. Wirkungen der Vorabentscheidung
a) Rechtliche Bindungswirkung des Urteils
b) Zeitliche Wirkung des Urteils
5. Vereinfachtes Verfahren/Eilverfahren
a) Vereinfachtes Verfahren (Art. 104 VerfO/EuGH)
b) Beschleunigtes Verfahren (Art. 104a VerfO/EuGH)
c) Eilverfahren (Art. 104b VerfO/EuGH)
IV. Vorläufiger Rechtsschutz (Art. 278, Art. 279 AEUV)
1. Bedeutung und Formen des vorläufigen Rechtsschutzes
2. Ausschluss der aufschiebenden Wirkung (Art. 278 Satz 1 AEUV)
3. Antrag auf Vollzugsaussetzung (Art. 278 Satz 2 AEUV) bzw. Antrag auf Erlass einer einstweiligen Anordnung (Art. 279 AEUV)
a) Zulässigkeit des Antrags
b) Begründetheit des Antrags
c) Entscheidung
V. Das Verfahren vor dem EuGH/EuG
1. Verfahrenseinleitung
2. Schriftliches Verfahren
3. Mündliche Verhandlung
4. Urteil
a) Urteilsberatung
b) Entscheidungsgründe
5. Verkündung, Veröffentlichung und Verfahrensdauer
6. Vollziehung und Vollstreckung
[S. 18]
2. Teil
Die Wirtschaftsverfassung
§ 7 Der Binnenmarkt
A. Vom Gemeinsamen Markt zum Binnenmarkt
B. Rechtliche Prinzipien des Binnenmarktes
I. Die Marktfreiheit im Binnenmarkt
II. Die Marktgleichheit im Binnenmarkt
III. Die Wettbewerbsfreiheit
C. Die Rechtsangleichung
I. Funktion und Begriff der Rechtsangleichung
II. Generelle Ermächtigungen zur Rechtsangleichung
1. Rechtsangleichung im Binnenmarkt
a) Abgrenzung der Art. 114 und 115 AEUV
b) Gegenstand der Rechtsangleichung
c) Abweichungsmöglichkeiten der Mitgliedstaaten nach Art. 114 Abs. 4 und 5 AEUV
2. Angleichung der Vorschriften über den Schutz des geistigen Eigentums
3. Rechtsangleichung nach Art. 352 AEUV
III. Spezielle Ermächtigungen zur Rechtsangleichung; Steuerharmonisierung
§ 8 Die Wirtschafts- und Währungspolitik
A. Die Entwicklung bis zum Eintritt in die Wirtschafts und- Währungsunion
I. Die Gründerjahre
II. Ein erster Neuanfang
III. Das Europäische Währungssystem
IV. Die drei Stufen der Wirtschafts- und Währungsunion
1. Der erfolgreiche Schritt auf die erste Stufe der WWU: Aufhebung der Beschränkungen des Geld- und Kapitalverkehrs
2. Der Eintritt in die zweite Stufe der WWU: Herstellung weitgehender Konvergenz
3. Die dritte Stufe der WWU: Einführung des Euro
B. Die rechtlichen Rahmenbedingungen
I. Marktwirtschaftliches Ordnungssystem
II. Ausgestaltung der Wirtschaftspolitik
1. Allgemeine wirtschaftliche Koordinierung
2. Überwachung der staatlichen Haushaltspolitik
[S. 19]
a) Grundsätze
b) Stabilitäts- und Wachstumspakt
c) Six-Pack
d) Europäisches Semester
e) Fiskalpakt
III. Ausgestaltung der Währungspolitik
1. Grundsätze der Währungspolitik
2. Einführung des „Euro“ als gemeinsame Währung
3. Wahrung der Stabilität des Euroraums
IV. Der institutionelle Rahmen
3. Teil
Die Grundfreiheiten
§ 9 Der freie Warenverkehr
A. Die Zollunion (Art. 30–32 AEUV)
I. Der Gemeinsame Außenzoll
1. Festlegung des Gemeinsamen Zolltarifs
2. Zoll- und Verfahrensrecht
II. Abschaffung der Binnenzölle
III. Verbot zollgleicher Abgaben
1. Begriffsbestimmung
2. Abgrenzung zu den Gebühren
3. Abgrenzung zu den inländischen Abgaben
4. Adressaten des Verbots
5. Unmittelbare Anwendbarkeit
B. Das Verbot der mengenmäßigen Beschränkungen und Maßnahmen gleicher Wirkung (Art. 34–36 AEUV)
I. Anwendungsbereich
1. Staatliche Maßnahmen
2. Waren
II. Mengenmäßige Einfuhr- und Ausfuhrbeschränkungen
III. Maßnahmen gleicher Wirkung wie mengenmäßige Beschränkungen
1. Begriff der „Maßnahme gleicher Wirkung“ i.S.v. Art 34 AEUV
a) Dassonville-Formel
b) Cassis-de-Dijon-Formel
c) Keck-Formel
d) Die Erweiterung der Keck-Formel durch die 3-Stufen-Theorie
e) Synthese der Rechtsprechung zum Begriff der Maßnahme gleicher Wirkung
[S. 20]
2. Wichtige Fallgruppen
a) Beschränkungen in Bezug auf die Ware selbst, ihre Verpackung oder Bezeichnung
b) Beschränkungen des Orts oder der Zeit des Verkaufs sowie der Vertriebswege
c) Regelungen über Preise und Preisbestandteile
d) Werbung und Absatzförderung
e) Beschränkungen zur Abwehr von Verwechselungen oder unlauterer Handlungspraktiken
f) Beschränkungen aufgrund gewerblicher Schutzrechte
3. Maßnahme gleicher Wirkung i.S.v. Art. 35 AEUV
IV. Schranken des Verbots – Rechtfertigung einer Beschränkung
1. Immanente Schranken
a) „Zwingende Erfordernisse“
b) Allgemeinwohlinteressen
c) Verhältnismäßigkeit
2. Rechtfertigung nach Art. 36 AEUV
a) Regelungszuständigkeit der Mitgliedstaaten
b) Geschützte Rechtsgüter
c) Grenzen der nationalen Regelungszuständigkeit
V. Prüfungsschema
C. Umformung der staatlichen Handelsmonopole (Art. 37 AEUV)
§ 10 Die Freiheit des Personen- und Dienstleistungsverkehrs
A. Allgemeiner Überblick
I. Die Regelungen
1. Freizügigkeit der Arbeitnehmer
2. Niederlassungsfreiheit
3. Dienstleistungsfreiheit
II. Abgrenzungsfragen
III. Vom Diskriminierungsverbot zum Behinderungsverbot
IV. Abschaffung der Grenzkontrollen: Schengener Besitzstand
B. Die Freizügigkeit der Arbeitnehmer (Art. 45–48 EGV)
I. Begünstigter Personenkreis
1. Arbeitnehmer
2. Familienangehörige
3. Angehörige der neuen Mitgliedstaaten
4. Angehörige von Drittstaaten
a) Grundsätzliche Rechtsstellung
b) Die Rechtsstellung der türkischen Staatsangehörigen
[S. 21]
c) Weitere Gestaltung der Einwanderungspolitik
II. Inhalt des Freizügigkeitsrechts
1. Grundsatz der Gleichbehandlung
a) Begünstigte des Gleichbehandlungsgebots
b) Verpflichtete des Gleichbehandlungsgebots
c) Gegenstand des Gleichbehandlungsgebots
2. Behinderungsverbot
3. Recht auf Stellenbewerbung
4. Recht auf Ausübung einer Beschäftigung
5. Gewerkschaftliche Rechte
6. Verbleiberecht
III. Rechtfertigung von Beschränkungen der Freizügigkeit
IV. Die soziale Sicherheit der Arbeitnehmer
1. Persönlicher Anwendungsbereich
2. Sachlicher Geltungsbereich
3. Grundprinzipien des Rechts der sozialen Sicherheit
a) Koordinierung der nationalen Sozialleistungssysteme
b) Grundsatz der Gleichbehandlung
c) Zusammenrechnung der Versicherungszeiten
d) Export der Sozialleistungen
V. Ausnahmen des Freizügigkeitsrechts zugunsten der öffentlichen Verwaltung
C. Die Niederlassungsfreiheit
I. Begünstigter Personenkreis
II. Sachlicher Anwendungsbereich
1. Erwerbstätigkeit
2. Niederlassung
3. Ausnahme: „Ausübung hoheitlicher Gewalt“
III. Inhalt des Niederlassungsrechts
1. Diskriminierungsverbot
a) Mögliche Eingriffsmaßnahmen
b) Verbot von Diskriminierungen
2. Verbot von Behinderungen
a) Anerkennung und Inhalt des Behinderungsverbots
b) Behinderung der Standortwahl von Gesellschaften
IV. Rechtfertigung von Beschränkungen der Niederlassungsfreiheit
V. Maßnahmen zur Erleichterung der Wahrnehmung der Niederlassungsfreiheit
1. Die gegenseitige Anerkennung der Diplome und Befähigungsnachweise
a) Allgemeine Regelung für die Anerkennung von Ausbildungsnachweisen
[S. 22]
b) Anerkennung der Berufserfahrung
c) Regelung zur automatischen Anerkennung spezifischer Berufsqualifikationen
d) Sprachkenntnisse
2. Gegenseitige Anerkennung außerhalb der Richtlinie 2005/36/EG
3. Koordinierung der Rechts- und Verwaltungsvorschriften der Mitgliedstaaten
D. Der freie Dienstleistungsverkehr (Art. 56–62 AEUV)
I. Persönlicher Anwendungsbereich
II. Sachlicher Anwendungsbereich: Begriff der Dienstleistung
III. Beschränkung der Dienstleistungsfreiheit
1. Diskriminierungsverbot
2. Behinderungsverbot
IV. Rechtfertigung von Beschränkungen der Dienstleistungsfreiheit
V. Maßnahmen zur Erleichterung der Wahrnehmung der Dienstleistungsfreiheit
VI. Öffentliches Auftragswesen
E. Gemeinsame Grundstruktur der Grundfreiheiten/Prüfungsschema
I. Gemeinsame Grundstruktur der Grundfreiheiten
1. Eingriffstatbestand
2. Rechtfertigung
3. Unmittelbare Anwendbarkeit der Grundfreiheiten
4. Grenzüberschreitender Bezug
II. Prüfungsschema für die Freizügigkeit, die Niederlassungsfreiheit und die Dienstleistungsfreiheit
F. Ein- und Ausreiserecht, Aufenthalts- und Verbleiberecht
I. Ein- und Ausreiserecht
II. Aufenthaltsrecht
1. Recht auf Aufenthalt von bis zu drei Monaten
2. Recht auf Aufenthalt während mehr als drei Monaten
3. Recht auf Daueraufenthalt
4. Verlust des Aufenthaltsrechts
5. Sanktionen
III. Verbleiberecht
IV. Einschränkungen aus Gründen des „ordre public“
1. Bedrohung der öffentlichen Ordnung, Sicherheit und Gesundheit
2. Verfahrensmäßige Rechte
[S. 23]
§ 11 Die Freiheit des Kapital- und Zahlungsverkehrs
A. Bedeutung und rechtliche Regelungen
B. Persönlicher Anwendungsbereich
C. Sachlicher Anwendungsbereich
I. Kapitalverkehr
II. Zahlungsverkehr
III. Abgrenzungsfragen
D. Beseitigung der Beschränkungen
E. Ausnahmen vom Beschränkungsverbot
I. Ausnahmen im Verhältnis der Mitgliedstaaten untereinander
II. Ausnahmen im Verhältnis zu Drittstaaten
F. Prüfungsschema für den freien Kapitalverkehr
4. Teil
Der freie Wettbewerb
§ 12 Die Grundlagen des europäischen Wettbewerbsrechts
A. Zweck und Aufbau der Wettbewerbsvorschriften
B. Verhältnis zum nationalen Wettbewerbsrecht und zu den internationalen Wettbewerbsregeln
I. Europäisches und nationales Wettbewerbsrecht
II. Europäisches und internationales Wettbewerbsrecht
§ 13 Vorschriften für Unternehmen
A. Das Kartellverbot (Art. 101 AEUV)
I. Tatbestand des Kartellverbots
1. „Unternehmen“ als Adressaten des Kartellverbots
2. Vereinbarungen, Beschlüsse, abgestimmte Verhaltensweisen
a) Vereinbarungen
b) Beschlüsse
c) Abgestimmte Verhaltensweisen
3. Verhinderung, Einschränkung oder Verfälschung des Wettbewerbs
4. Beeinträchtigung des zwischenstaatlichen Handels
5. Spürbarkeit
II. Rechtsfolge des Kartellverbots
III. Freistellungen vom Kartellverbot
1. Voraussetzungen der Freistellung
[S. 24]
2. Verfahren der Freistellung
3. Rechtsfolge der Freistellung
B. Das Verbot des Missbrauchs einer den Markt beherrschenden Stellung (Art. 102 AEUV)
I. Marktbeherrschende Stellung
1. Relevanter Markt
2. Marktanteil
II. Missbräuchliche Ausnutzung
1. Ausbeutungsmissbrauch
2. Behinderungsmissbrauch
a) Kampfpreisunterbietungen
b) Gewerbliche Schutzrechte
c) Ausschließlichkeitsbindungen und vergleichbare Maßnahmen
d) Lieferverweigerung
e) Begrenzung von Monopolen
f) Kosten-Preis-Schere
III. Rechtsfolgen des Missbrauchs einer marktbeherrschenden Stellung
C. Das Kartellverfahren
I. Wirksame Durchsetzung der Wettbewerbsregeln
1. Unmittelbare Anwendbarkeit des Art. 101 Abs. 3 AEUV
2. Dezentralisierung der Anwendung der Art. 101 und 102 AEUV
3. Ermittlungsbefugnisse der Kommission
a) Nachprüfungsbefugnisse
b) Befugnis zur Befragung
c) Auskunftsverlangen
d) Beachtung rechtsstaatlicher Grundsätze
4. Abstellung von Zuwiderhandlungen
a) Feststellung und Abstellung der Zuwiderhandlung
b) Einstweilige Maßnahmen
c) Beschluss über Verpflichtungszusagen
d) Feststellung der Nichtanwendbarkeit der Wettbewerbsregeln
5. Befugnisse der nationalen Wettbewerbsbehörden
6. Sanktionen
II. Einheitliche Anwendung der Wettbewerbsregeln
III. Rechtsschutz
§ 14 Fusionskontrolle
A. Entstehungsgeschichte
[S. 25]
B. Anwendungsbereich der Verordnung über Fusionskontrolle
I. Zusammenschluss von Unternehmen
II. Unionsweite Bedeutung des Zusammenschlusses
III. Untersagungskriterien
C. Verfahren der Fusionskontrolle
I. Zuständigkeiten für die Kontrolle von Unternehmenszusammenschlüssen
1. Verweisungen vor Anmeldung
2. Verweisung nach Anmeldung
II. Verfahrensvorschriften und Fristen
1. Vorabprüfverfahren
2. Hauptprüfverfahren
§ 15 Kontrolle staatlicher Beihilfen
A. Beihilfetatbestand
I. Vorliegen einer Beihilfe
1. Zuweisung eines wirtschaftlichen Vorteils an Unternehmen oder Wirtschaftszweige
2. Transfer staatlicher Mittel
3. Selektiver Charakter der Maßnahme
II. Verfälschung des Wettbewerbs
III. Beeinträchtigung des zwischenstaatlichen Handels
B. Ausnahmen vom Beihilfenverbot
I. Legalausnahmen nach Art. 107 Abs. 2 AEUV
II. Ausnahmen nach Art. 107 Abs. 3 AEUV