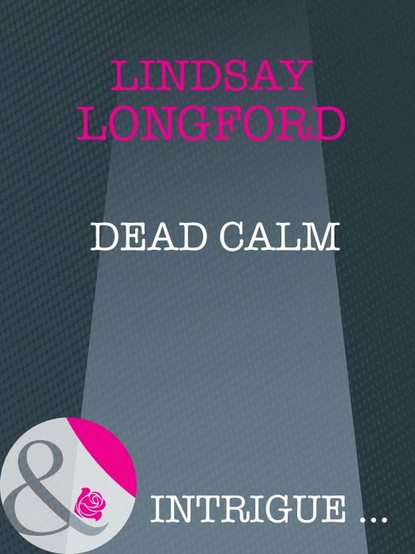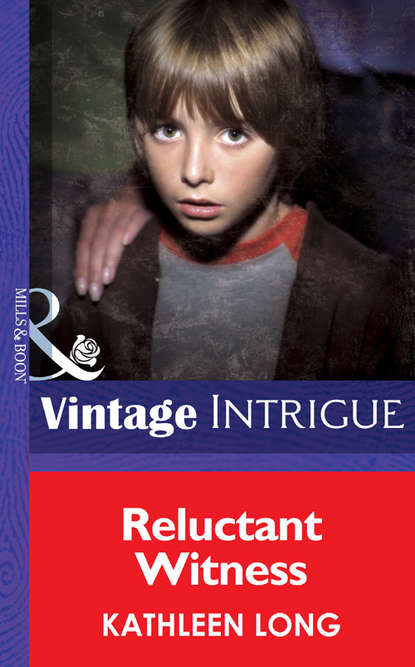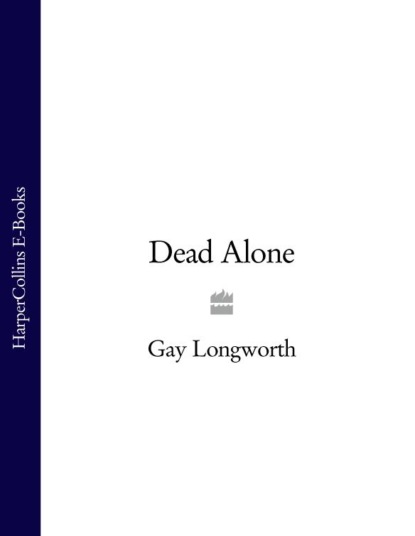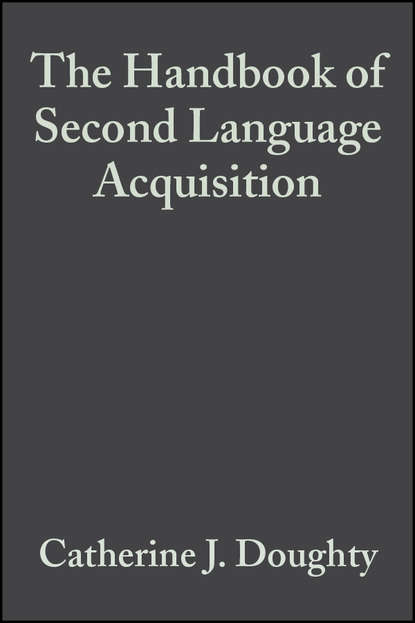Die rechtlichen Grundlagen der Europäischen Union
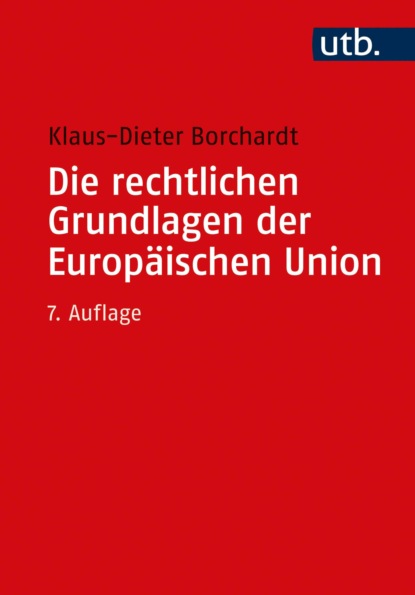
- -
- 100%
- +
[S. 34]
Zeittafel
26. Juni 1945 Unterzeichnung der Charta der Vereinten Nationen in San Francisco 9. September 1946 Rede von Winston Churchill in Zürich über die Vorzüge der Vereinigten Staaten von Europa 17. März 1948 Unterzeichnung des Vertrags über die Gründung der Westeuropäischen Union (WEU) in Brüssel 4. April 1949 Unterzeichnung des Nordatlantikvertrags zur Gründung der NATO in Washington 16. April 1949 Gründung der Organisation für Europäische Wirtschaftliche Zusammenarbeit (OEEC) in Paris 5. Mai 1949 Unterzeichnung des Vertrags über die Gründung des Europarats in Straßburg 9. Mai 1950 Deklaration von Robert Schuman über die Schaffung der Montanunion als erster Etappe einer Europäischen Föderation 4. November 1950 Unterzeichnung der Europäischen Konvention zum Schutze der Menschenrechte und Grundfreiheiten in Rom 18. April 1951 Unterzeichnung des Vertrags über die Gründung der Europäischen Gemeinschaft für Kohle und Stahl (EGKS-Vertrag) in Paris durch die Benelux-Staaten, Deutschland, Frankreich und Italien – Laufzeit 50 Jahre 23. Juli 1952 Inkrafttreten des EGKS-Vertrags 1. Juni 1955 Außenministerkonferenz von Messina zur Vorbereitung des EWG-Vertrags 25. März 1957 Unterzeichnung der Verträge zur Gründung der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft (EWG-Vertrag) und zur Gründung der Europäischen Atomgemeinschaft (EAG-Vertrag) in Rom durch die Benelux-Staaten, Deutschland, Frankreich und Italien (Römische Verträge) 1. Januar 1958 Inkrafttreten der Römischen Verträge 4. Januar 1960 Gründung der Europäischen Freihandelsassoziation (EFTA) in Stockholm durch Dänemark, Österreich, Norwegen, Portugal, Schweden, Großbritannien und die Schweiz 14. Dezember 1960 Unterzeichnung des Übereinkommens über die Organisation für Wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) in Paris 8. April 1965 Unterzeichnung des Vertrags zur Einsetzung eines gemeinsamen Rates und einer gemeinsamen Kommission der Europäischen Gemeinschaften (Fusionsvertrag) 1. Juli 1967 Inkrafttreten des Fusionsvertrags 1. Januar 1973 Beitritt Dänemarks, Großbritanniens und Irlands zu den Europäischen Gemeinschaften [S. 35] 1. August 1975 Unterzeichnung der Schlussakte der Konferenz für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa (KSZE) in Helsinki 18. Dezember 1978 Gründung des Europäischen Währungssystems (EWS) 7.-10. Juni 1979 Erste Direktwahl des Europäischen Parlaments 1. Januar 1981 Beitritt Griechenlands zu den Europäischen Gemeinschaften 1. Januar 1985 Austritt Grönlands aus der EWG 14. Juni 1985 Schengener Abkommen zwischen Frankreich, Deutschland, Belgien, Luxemburg und den Niederlanden betreffend den schrittweisen Abbau der Grenzkontrollen 1. Januar 1986 Beitritt Portugals und Spaniens zu den Europäischen Gemeinschaften 17./18. Februar 1986 Unterzeichnung der Einheitlichen Europäischen Akte (EEA) in Luxemburg und in Den Haag 1. Juli 1987 Inkrafttreten der EEA 3. Oktober 1990 Beitritt der DDR zur Bundesrepublik Deutschland und Eingliederung in die Europäischen Gemeinschaften 7. Februar 1992 Unterzeichnung des Vertrags über die Europäische Union in Maastricht (Unions-Vertrag) 2. Mai 1992 Unterzeichnung des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum (EWR-Abkommen) in Porto 1. Januar 1993 Inkrafttreten des EG-Binnenmarktes 1. November 1993 Inkrafttreten des Unions-Vertrages (Vertrag von Maastricht) 1. Januar 1994 Inkrafttreten des EWR-Abkommens 1. Januar 1995 Beitritt Österreichs, Finnlands und Schwedens zur Europäischen Union 1. März 1995 Inkrafttreten des Schengener Durchführungsübereinkommens (weitere Mitglieder bis März 2001: Italien, Spanien, Portugal, Griechenland, Dänemark, Österreich, Finnland und Schweden) 16. Juli 1997 „Agenda 2000“ der Europäischen Kommission zur Erweiterung der Europäischen Union 2. Oktober 1997 Unterzeichnung des Vertrages von Amsterdam 12. Dezember 1997 Beginn des Erweiterungsprozesses der Europäischen Union durch den Europäischen Rat in Luxemburg 1. Oktober 1998 Inkrafttreten der Europol-Konvention (Polizeiliche Zusammenarbeit in der EU) 1. Januar 1999 Einführung der gemeinsamen europäischen Währung „Euro“ 1. Mai 1999 Inkrafttreten des Vertrages von Amsterdam 24. März 2000 Verabschiedung der Lissabon-Strategie zur wirtschaftlichen, sozialen und ökologischen Erneuerung der EU 8. Dezember 2000 Feierliche Proklamation der Charta der Grundrechte der Europäischen Union 26. Februar 2001 Unterzeichnung des Vertrages von Nizza 1. Januar 2002 Einführung der Euro-Banknoten und Euro-Münzen als Zahlungsmittel [S. 36] 28. Februar 2002 Konstituierung des Konvents zur Ausarbeitung einer Europäischen Verfassung 28. Februar 2002 Errichtung von Eurojust (Europäische Stelle für justizielle Zusammenarbeit 1. Februar 2003 Inkrafttreten des Vertrages von Nizza 1. Mai 2004 Beitritt von Polen, Ungarn, Tschechische Republik, Slowakei, Slowenien, Lettland, Litauen, Estland, Malta, Zypern zur EU 29. Oktober 2004 Unterzeichnung des Vertrages über eine neue Verfassung für Europa Mai/Juni 2005 Ablehnung des Vertrages über eine Verfassung für Europa in Referenden in Frankreich (54,7% NEIN) und den Niederlanden (61,7% NEIN) 1. Januar 2007 Beitritt Bulgariens und Rumäniens zur EU 1. Januar 2007 Einführung des Euro in Slowenien 1. März 2007 Errichtung einer Agentur der Europäischen Union für Grundrechte 25. März 2007 Feierliche Begehung des 50. Geburtstages der Römischen Verträge in Berlin 12. Dezember 2007 Feierliche Proklamation der Charta der Grundrechte der Europäischen Union durch das Europäische Parlament, den Rat und die Europäische Kommission in Straßburg 13. Dezember 2007 Unterzeichnung des Vertrages von Lissabon 21. Dezember 2007 Estland, Lettland, Litauen, Malta, Polen, die Slowakei, Slowenien, die Tschechische Republik und Ungarn treten dem Schengen-Raum bei 1. Januar 2008 Einführung des Euro in Zypern und auf Malta 15. Februar 2008 1. Referendum in Irland über den Vertrag von Lissabon (53,13% NO) 1. Januar 2009 Einführung des Euro in der Slowakei 2. Oktober 2009 2. Referendum in Irland über den Vertrag von Lissabon (58,93% YES) 1. Dezember 2009 Inkrafttreten des Vertrages von Lissabon 1. Dezember 2009 Herman van Rompuy wird erster Präsident des Europäischen Rates; Baroness Catherine Ashton wird erste Hohe Vertreterin der Europäischen Union für Außen und Sicherheitspolitik 17. Juni 2010 Verabschiedung der Strategie 2020 21. Juni 2010 Schaffung eines Europäischen Auswärtigen Dienstes 1. Januar 2011 Einführung des Euro in Estland 1. Januar 2011 Europäische Finanzaufsichtsbehörde nimmt ihre Arbeit auf 25. März 2011 Euro-Plus-Paket zur wirtschaftspolitischen Koordinierung der WWU 24. Juni 2011 Abschluss der Beitrittsverhandlungen mit Kroatien 19. Dezember 2011 Liechtenstein tritt dem Schengen-Raum der EU bei [S. 37] 30. Januar 2012 25 Mitgliedstaaten einigen sich auf einen Vertrag über Stabilität, Koordinierung und Steuerung in der WWU 2. Februar 2012 Europäischer Stabilitätsmechanismus (EMS) wird vertraglich besiegelt 1. Juli 2013 Beitritt Kroatiens zur EU 1. Januar 2014 Einführung des Euro in Lettland 18. September 2014 Referendum über die Unabhängigkeit Schottlands: 55,3% stimmen mit nein, 44,7% stimmen mit ja 1. Januar 2015 Einführung des Euro in Litauen (19. Mitglied der Eurozone) 12. März 2015 Island nimmt seinen Beitrittsantrag förmlich zurück. 23. Juni 2016 Austrittsreferendum im Vereinigten Königreich (51,89% stimmen für den Austritt) 30.12.2016 Inkrafttreten des im Dezember 2015 vereinbarten „Klimaschutzübereinkommens von Paris“ durch die Europäische Union nach Ratifizierung durch die Mitgliedstaaten. 29. März 2017 Notifizierung des Austrittsverlangens durch britische Premierministerien Theresa May 31. Januar 2020 Austritt des Vereinigten Königreichs aus der EU[S. 38]
[S. 39]
1. Teil
Die politische Verfassung der Europäischen Union
§ 1 Die Entstehung und Entwicklung der Europäischen Union
A. Die frühen europäischen Einigungsbemühungen
[1] Die Konzeption eines Zusammenschlusses europäischer Staaten ist in der Geschichte des Kontinents fest verankert und hat lange vor Gründung der Europäischen Gemeinschaften in verschiedenen Formen politischen Ausdruck gefunden1. Allerdings galt der souveräne Nationalstaat über Jahrhunderte als optimale Organisationsform, so dass die Einsicht in die Notwendigkeit einer Union europäischer Staaten auf vertraglicher Grundlage sich zunächst nicht durchzusetzen vermochte.
I. Die Konkretisierung der Europäischen Idee zwischen den Weltkriegen
[2] Erst nach dem Ersten Weltkrieg aufgrund der durch ihn bewirkten Erschütterungen der überkommenen nationalen Strukturen wurden Modelle einer freiwilligen und friedlichen Zusammenführung gleichberechtigter Partner entwickelt2.
Ende des Jahres 1923 forderten der österreichische Graf Coudenhove-Kalergi und die von ihm ins Leben gerufene Paneuropäische Bewegung die Schaffung der „Vereinigten Staaten von Europa“3. Als Vorbilder dienten dabei die erfolgreichen Einigungsbemühungen der Schweiz von 1648, die Gründung des Deutschen Reiches von 1871 und vor allem die Entstehung der Vereinigten Staaten von Amerika im Jahre 1789.
[3] In seiner Rede vom 5. September 1929 vor dem Völkerbund in Genf unterbreitete der französische Außenminister Aristide Briand – unterstützt von seinem deutschen Amtskollegen Gustav Stresemann – den europäischen Regierungen den Vorschlag, eine Europäische Union im Rahmen des Völkerbundes zu gründen4. Obwohl zunächst nur eine engere Zusammenarbeit der europäischen Staaten im Rahmen der weltweiten Organisation des Völkerbundes angestrebt wurde, welche die Souveränität der europäischen Staaten unangetastet lassen sollte, hatte dieser Vorstoß zur Einigung Europas keinen Erfolg. Als zu übermächtig erwiesen sich in diesen Zeiten noch die Gedanken des Nationalismus und Imperialismus.
[S. 40]
II. Die Nachkriegszeit
[4] Erst der völlige Zusammenbruch Europas mit dem Ende des Zweiten Weltkrieges sowie der politische und wirtschaftliche Verfall der europäischen Staaten schufen die Voraussetzungen für einen Neubeginn und gaben der Idee einer neuen europäischen Ordnung Aufschwung. Die verschiedenen Anläufe zu einem Zusammenschluss Europas entsprangen vor allem drei Erkenntnissen:
• Zunächst war es das Wissen um die eigene Schwäche. Europa hatte infolge seiner kriegerischen Auseinandersetzungen seine jahrhundertealte Stellung als Zentrum des Weltgeschehens eingebüßt. Es wurde verdrängt von den zwei neuen Supermächten, den Vereinigten Staaten von Amerika und der früheren Sowjetunion, die beide über mehr militärische, politische und wirtschaftliche Macht verfügten als ein in zahlreiche Einzelstaaten zersplittertes Europa.
• Zum anderen war aufgrund der leidvollen Erfahrungen die Maxime jedes politischen Handelns: „Nie wieder Krieg!“ Nach zwei Weltkriegen, die als europäische Bruderkriege begannen und Europa zum eigentlichen Schlachtfeld und zum Hauptleidtragenden gemacht hatten, war die Vorstellung neuer kriegerischer Konflikte in Europa unerträglich.
• Hinzu kamen schließlich der Wunsch und das Verlangen nach einer besseren, freieren und gerechteren Welt mit einer vollkommeneren Ordnung des menschlichen und staatlichen Zusammenlebens.
[5] In ihrer Gesamtheit bieten die europäischen Einigungsbemühungen der Nachkriegszeit ein verwirrendes Bild komplizierter und nur schwer überschaubarer Organisationen. So existieren heute nebeneinander und ohne rechte Verbindung zueinander die OECD (Organization for Economic Cooperation and Development = Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung), die NATO (North Atlantic Treaty Organisation = Nordatlantikpakt), der Europarat und die Europäische Union. Die Zahl der Mitgliedstaaten schwankt bei diesen verschiedenen Organisationen zwischen 27 (EU) und 47 (Europarat).
Diese Vielfalt europäischer Gebilde gewinnt erst dann eine Struktur, wenn man sich vergegenwärtigt, welche konkreten Zielsetzungen sich hinter diesen Organisationen verbergen. Sie lassen sich in drei große Gruppen einteilen:
• Erste Gruppe: Die europäisch-atlantischen Organisationen
[6] Die europäisch-atlantischen Organisationen sind aus der nach dem Zweiten Weltkrieg entstandenen Verbundenheit der Vereinigten Staaten von Amerika mit West-Europa hervorgegangen. So war es kein Zufall, dass die erste europäische Organisation der Nachkriegszeit, die im Jahre 1948 gegründete OEEC (Organisation for European Economic Cooperation = Organisation für europäische wirtschaftliche Zusammenarbeit), auf eine Initiative der Vereinigten Staaten zurückgeht5. Deren damaliger[S. 41] Außenminister George Marshall forderte 1947 die Staaten Europas auf6, ihre Anstrengungen für den wirtschaftlichen Wiederaufbau zu vereinen. Hierfür sagte er die Unterstützung der USA zu, die sich im Marshallplan verwirklichte und die Grundlage für den schnellen Wiederaufbau Westeuropa bildete. Das Hauptanliegen der OEEC bestand zunächst in der Liberalisierung des Handels zwischen den Staaten. Als ergänzende Zielsetzung wurde 1960, dem Beitrittsjahr der USA und Kanadas, die Wirtschaftsförderung in der Dritten Welt durch Entwicklungshilfe festgeschrieben; aus der OEEC wurde die OECD7, die heute über 35 Mitglieder verfügt.
[7] Der OEEC folgte im Jahre 1949 als militärischer Pakt mit den Vereinigten Staaten und Kanada die NATO8. Zur Stärkung der sicherheitspolitischen Zusammenarbeit zwischen den europäischen Staaten wurde im Jahre 1954 die Westeuropäische Union (WEU) gegründet. Die WEU markierte 1954 den Anfang der Entwicklung einer Sicherheits- und Verteidigungspolitik in Europa. Ihre Rolle wurde jedoch nicht ausgebaut, da die meisten ihrer Kompetenzen an andere internationale Institutionen, insbesondere die NATO, den Europarat und die EU übertragen wurden. Konsequenterweise wurde die WEU zum 30. Juni 2011 aufgelöst.
• Zweite Gruppe: Europarat und OSZE
[8] Für die zweite Gruppe europäischer Organisationen ist kennzeichnend, dass sie ihrer Struktur nach so aufgebaut sind, dass möglichst vielen Staaten die Mitwirkung in ihnen ermöglicht wird. Dabei wurde bewusst in Kauf genommen, dass diese Organisationen über die traditionelle zwischenstaatliche Zusammenarbeit nicht hinauskommen.
[9] Zu diesen Organisationen gehört der am 5. Mai 1949 als politische Organisation gegründete Europarat9. Im Statut des Europarats gibt es weder einen Hinweis auf das Streben nach einer Föderation oder Union, noch sieht es die Übertragung oder Zusammenlegung von Teilen der nationalen Souveränität vor. Die Entscheidungen werden im Europarat in allen wesentlichen Fragen nach dem Grundsatz der Einstimmigkeit getroffen. Jeder Staat kann demnach durch ein Veto das Zustandekommen von Beschlüssen verhindern. Die parlamentarische Versammlung ist ausschließlich mit beratenden, nicht aber mit legislativen Funktionen ausgestattet. Sie kann nicht mehr tun, als Empfehlungen an den Ministerrat zu richten, der ihr nicht verantwortlich ist und eine Empfehlung bereits mit einer einzigen ablehnenden Stimme zu Fall bringen kann. Auch die Vorlagen, die den Ministerrat passieren, müssen, um Rechtsverbindlichkeit zu erlangen, erst noch durch die nationalen Parlamente ratifiziert werden. Damit bleibt der Europarat in seiner Konstruktion ein Organ internationaler Zusammenarbeit. Dennoch kann der Beitrag, den der Europarat für die europäische Einigung und das europäische Zusammengehörigkeitsgefühl geleistet[S. 42] hat, nicht hoch genug geschätzt werden. Sein Ziel bestand darin, eine enge Verbindung zwischen den Staaten Europas herzustellen und ihren wirtschaftlichen und sozialen Fortschritt zu fördern. Dies ist gelungen, denn aus den ursprünglich zehn Gründerstaaten sind inzwischen 47 Mitgliedstaaten geworden10.
Im Rahmen des Europarats wurden zahlreiche Konventionen auf dem Gebiet der Wirtschaft, der Kultur, der Sozialpolitik und des Rechts geschlossen. Die bedeutendste und zugleich auch bekannteste ist die Europäische Konvention zum Schutz der Menschenrechte und Grundfreiheiten vom 4. November 195011 (EMRK = Europäische Menschenrechtskonvention), der inzwischen alle 47 Mitglieder des Europarates beigetreten sind. Mit ihr wurde für die Mitgliedstaaten nicht nur ein praktisch bedeutsamer Mindeststandard für die Wahrung der Menschenrechte geschaffen, sondern auch ein Rechtsschutzsystem verankert, das es den durch die Konvention in Straßburg eingerichteten Organen, der Europäischen Kommission für Menschenrechte und dem Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte, erlaubt, im Rahmen der Konvention Menschenrechtsverletzungen in den Mitgliedstaaten zu verurteilen.
[10] Zu dieser Gruppe gehört weiterhin die „Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa“ („OSZE“), die im Jahre 1994 gegründet wurde und aus der „Konferenz für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa“ („KSZE“) hervorgegangen ist. Die OSZE, der gegenwärtig 57 Länder angehören, ist den Grundsätzen und Zielen verpflichtet, wie sie in der Helsinki-Akte von 1975 und der Pariser Charta von 1990 niedergelegt sind. Dazu gehört neben der Förderung vertrauensbildender Maßnahmen zwischen den europäischen Staaten auch die Schaffung eines „Sicherheitsnetzes“, das die Beilegung von Konflikten mit friedlichen Mitteln ermöglichen soll.
• Dritte Gruppe: Die Europäische Union