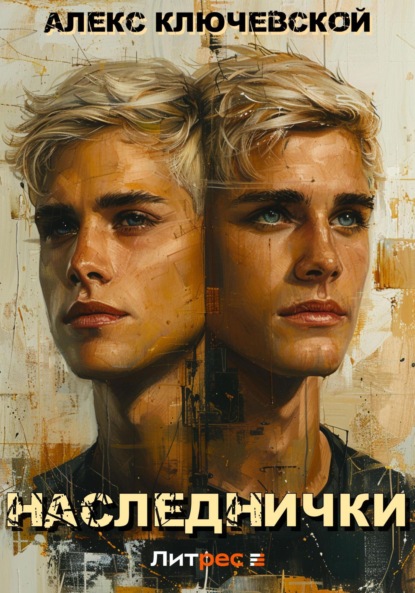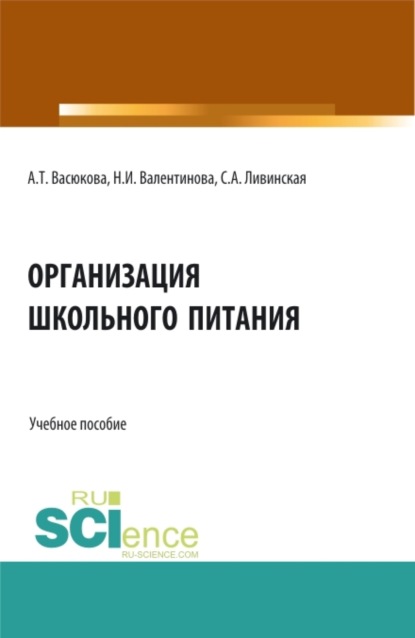Die rechtlichen Grundlagen der Europäischen Union
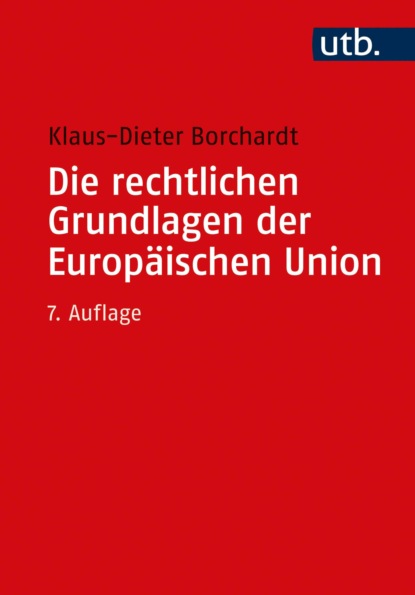
- -
- 100%
- +
[11] Die dritte Gruppe der europäischen Organisationen bildet die Europäische Union (EU). In ihrer heutigen Form ist die EU hervorgegangen aus der (inzwischen aufgelösten[S. 43]) Europäischen Gemeinschaft für Kohle und Stahl, der Europäischen Atomgemeinschaft und der Europäischen (Wirtschafts-)Gemeinschaft, die mit dem Vertrag von Lissabon mit der Europäischen Union verschmolzen wurde12. Die Europäische Union verfügt gegenwärtig über 27 Mitgliedstaaten13. Das gegenüber den herkömmlichen internationalen Staatenverbindungen grundlegend Neue der EU besteht darin, dass die Mitgliedstaaten zugunsten der EU auf Teile ihrer Souveränität verzichtet und diese mit eigenen, von den Mitgliedstaaten unabhängigen Machtbefugnissen ausgestattet haben. In Ausübung dieser Befugnisse ist die EU in der Lage, europäische Hoheitsakte zu erlassen, die in ihren Wirkungen den staatlichen gleichkommen14.
III. Die Gründung der Europäischen Gemeinschaften
[12] Den Grundstein zur Bildung der EG legte der damalige französische Außenminister Robert Schuman mit seiner Erklärung vom 9. Mai 1950, in der er den von ihm und Jean Monnet entwickelten Plan vorstellte, „die Gesamtheit der deutsch-französischen Produktion von Kohle und Stahl unter eine gemeinsame oberste Autorität innerhalb einer Organisation zu stellen, die der Mitwirkung anderer Staaten Europas offensteht“15.
Hintergrund dieses Vorschlags war die Erkenntnis, dass es einerseits wenig sinnvoll war, Deutschland einseitige Kontrollen aufzuzwingen, andererseits aber ein völlig unabhängiges Deutschland immer noch als eine potentielle Friedensbedrohung empfunden wurde. Der einzige Ausweg aus diesem Dilemma bestand darin, Deutschland politisch und wirtschaftlich in eine festgefügte Gemeinschaft Europas einzubinden.
[13] Mit Abschluss des Gründungsvertrages der Europäischen Gemeinschaft für Kohle und Stahl (EGKS) durch die sechs Gründerstaaten (Belgien, Bundesrepublik Deutschland, Frankreich, Italien, Luxemburg und die Niederlande) am 18. April 1951 in Paris und seinem In-Kraft-Treten am 23. Juli 1952 wurde der Schuman-Plan schließlich Realität16.
Von der Existenz dieser Gemeinschaft erhoffte man sich eine Initialzündung für eine dieser Gemeinschaft nachfolgende weitere politische Einigung Europas, die mit der Schaffung einer europäischen Verfassung konkrete Gestalt annehmen sollte.
[S. 44]
[14] Schon im Oktober 1950, also noch vor Unterzeichnung des Gründungsvertrages der EGKS, wurde auf französische Initiative die Idee einer Europäischen Verteidigungsgemeinschaft (EVG) geboren. Vor dem Hintergrund zunehmender Spannungen zwischen den Supermächten USA und der damaligen UdSSR entsprach es den Sicherheitsbedürfnissen der westeuropäischen Staaten, ihre Verteidigungsanstrengungen zu verstärken und die europäische Integration voranzutreiben, um auf diese Weise den Bedrohungen des Kalten Krieges entgegenzuwirken17. Die Lösung sah man abermals in einer auch Deutschland umfassenden supranationalen Gemeinschaft (sog. Plevenplan). Dieser Plan scheiterte jedoch im August 1954 an der Ablehnung durch die französische Nationalversammlung, deren Mehrheit nicht bereit war, einen so starken Eingriff in die französische Souveränität, wie ihn der Verzicht auf eine nationale Armee darstellte, mitzutragen18.
Mit dem Scheitern der EVG hatten zugleich auch die Bemühungen um eine politische Einigung Europas einen schweren Rückschlag erlitten. Einem Jahr der Resignation folgte aber bereits im Juni 1955 ein neuer Vorstoß der Außenminister der Mitgliedstaaten der EGKS zur „Schaffung eines Vereinigten Europas“.
[15] Auf der Konferenz von Messina beschlossen die sechs Gründerstaaten der EGKS, ihre Arbeit am europäischen Einigungswerk dort fortsetzten, wo man mit der EGKS begonnen hatte, nämlich auf dem weniger von nationalen Emotionen geprägten Gebiet der Wirtschaft. So war man zwar bescheidener geworden, kam aber dadurch der europäischen Wirklichkeit näher, die augenscheinlich mit den Plänen der EVG überfordert worden war. Die Untersuchung der Möglichkeiten einer fortschreitenden Integration übertrugen die sechs Außenminister einem Ausschuss, der unter dem Vorsitz des belgischen Außenministers Spaak tagte. Der Spaak-Ausschuss legte 1956 seinen Bericht vor, der als Grundlage für die Vertragsverhandlungen zur Gründung der Europäischen Atomgemeinschaft (EAG) und der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft (EWG) diente. Die Verträge wurden im März 1957 unterzeichnet und traten am 1. Januar 1958 in Kraft19.
IV. Die Bildung der europäischen Freihandelszone
[16] Nach der Gründung der EWG und der EAG stellte sich die Frage, was mit den europäischen Staaten geschehen sollte, die zwar Mitglieder der OEEC waren, sich der EWG aber nicht angeschlossen hatten. Die Gründerstaaten der EWG hatten im[S. 45] EWG-Vertrag verschiedene Formen der Beteiligung dritter Staaten vorgesehen und damit zum Ausdruck gebracht, dass sie sich keineswegs von dritten Staaten abschotten wollten. Zu diesen Beteiligungsformen gehörte u.a. auch die Bildung von Freihandelszonen. Die ersten Bemühungen richteten sich in den Jahren 1956–1958 deshalb darauf, zwischen der EWG als Zollunion und den übrigen OEEC-Staaten eine Freihandelszone zu gründen. Eine Freihandelszone sieht wie die Zollunion ebenfalls den Abbau der Zölle zwischen den Mitgliedern vor, im Unterschied zur Zollunion kann jedes Mitglied gegenüber dritten Staaten jedoch einen eigenen Außenzoll beibehalten. Diese Regelungsfreiheit war vor allem für Großbritannien, das seinerzeit prominenteste Nichtmitglied der EWG, mit Rücksicht auf die Commonwealth-Länder von entscheidender Bedeutung. Die Bildung einer solchen Freihandelszone zwischen EWG- und OEEC-Staaten scheiterte jedoch im Dezember 1958 an unüberwindlichen Meinungsverschiedenheiten zwischen Frankreich und Großbritannien.
[17] Als Antwort darauf schufen 1959 Norwegen, Schweden, Dänemark, Österreich, die Schweiz und Portugal unter Führung Großbritanniens die Europäische Freihandelszone (EFTA), der später Island beitrat und Finnland assoziiert wurde20. Das Ziel der EFTA-Staaten war nach wie vor eine Beteiligung an den Handelsvorteilen, die die EWG ihren Mitgliedern gewährte. Entsprechende Abkommen zwischen der EWG und den EFTA-Staaten wurden zunächst jedoch nicht geschlossen, da die EWG-Mitgliedstaaten darauf bestanden, dass die EFTA-Staaten der Gemeinschaft mit allen Rechten und Pflichten als volle Mitglieder beitreten müssten. Diese „Alles-oder-Nichts-Haltung“ wurde im Laufe der Zeit von der EWG aufgegeben und mit einigen EFTA-Staaten wurden bilaterale Handels- und Assoziierungsabkommen geschlossen21. Im Zuge der Verwirklichung des Binnenmarktes wurde schließlich zwischen der EWG und ihren Mitgliedstaaten einerseits und den EFTA-Staaten andererseits ein Abkommen über die Schaffung eines Europäischen Wirtschaftsraums (EWR) ausgehandelt, das die Beziehungen zwischen der EG/EU und den EFTA-Staaten umfassend regelt22.
Weiterführende Literatur: Arnold, Verfassungsidentität und Letztentscheidungsrecht, in: FS für Scheuing, 2011, S. 17; Bieber/Schwarze, Verfassungsentwicklung in der Europäischen Gemeinschaft, 1984; Foerster, Die Idee Europa 1300–1946. Quellen zur Geschichte der europäischen Einigung, München 1963; Isensee, Europa als politische Idee und als rechtliche Form, 2. Aufl. 1994; Kraemer, EWG und EFTA – Entwicklung, Aufbau, Tätigkeit, 1968; Monnet, Mémoires, 1976, S. 312 ff.; Siegler, Dokumentation der Europäischen Integration, 2 Bde., 1961/64.
[S. 46]
B. Von den Europäischen Gemeinschaften zur Europäischen Union
I. Die vergeblichen Versuche zur Vertiefung der Europäischen Gemeinschaften
[18] Ermutigt durch die Anfangserfolge, insbesondere der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft, wandte man sich zu Beginn der sechziger Jahre erneut dem zu keiner Zeit aufgegebenen Ziel der Schaffung einer auch politischen Einheit der Mitgliedstaaten zu.
So beauftragten die Staats- und Regierungschefs der sechs Gründerstaaten der E(W)G eine Kommission unter Leitung des französischen Botschafters Christian Fouchet, Vorschläge für ein politisches Statut einer „Union der europäischen Völker“ vorzulegen. In zwei Anläufen versuchte die Studienkommission vergeblich, den Mitgliedstaaten einen für alle annehmbaren Vertragsentwurf zu unterbreiten (Fouchet-Pläne I und II)23. Die Interessengegensätze der Partnerländer erwiesen sich im Hinblick auf die Form und Qualität eines politischen Zusammenschlusses als derart hartnäckig, dass auf der Außenministerkonferenz am 17. April 1962 in Paris beschlossen wurde, die Verhandlungen über eine politische Union zunächst nicht fortzusetzen.
[19] In den Aufbaujahren der EWG fehlte es dann auch weitgehend an Initiativen, dem politischen Ziel der europäischen Einigung, „die Grundlagen für einen immer engeren Zusammenschluss der europäischen Völker zu schaffen“, näherzukommen. Neue Impulse für die politische Einigung gingen erst wieder von verschiedenen Gipfelkonferenzen der Staats- bzw. Regierungschefs der EWG gegen Ende der 60er Jahre aus. Auf der Grundlage des im Dezember 1969 auf dem Haager Gipfel beschlossenen Auftrags, Fortschritte auf dem Gebiet der wirtschaftlichen und politischen Einigung zu erreichen, wurde auf den Pariser Konferenzen von 1972 und 1974 als Instrument und neue Zielsetzung der europäischen Einigung die Schaffung einer Europäischen Union proklamiert24. Allerdings blieb es in der Folgezeit auch weitgehend bei derartigen Proklamationen, da nach wie vor zwischen den Mitgliedstaaten über die Verfassungsstruktur der Europäischen Union und die notwendigen Reformen des institutionellen Systems erhebliche Meinungsverschiedenheiten bestanden, über die keine Einigung erzielt werden konnte.
[20] Gleichwohl brachten die 70er Jahre im Integrationsprozess wichtige Ergebnisse. So hat die Gemeinschaft neue politische Instrumente entwickelt, welche die Grundlage für eine Koordinierung nationaler Politiken erweiterten. Dies gilt zunächst für die Europäische Politische Zusammenarbeit (EPZ)25. Dabei handelt es sich um[S. 47] ein Instrument, das die Mitgliedstaaten der EWG im Jahre 1970 für eine freiwillige außenpolitische Abstimmung geschaffen haben und das in der Folgezeit stetig verbessert und ausgebaut worden ist26. Daneben ist die Errichtung des Europäischen Währungssystems (EWS) im März 197927 zu nennen, durch das die währungspolitische Zusammenarbeit in Europa in eine neue Dimension vorstieß.28
II. Die Reformdiskussion der 80er-Jahre
[21] Mit Beginn der 80er Jahre setzte eine sehr intensive Reformdiskussion ein, die unter den Stichworten „Europa der zweiten Generation“, „Relance Européenne“ oder „Europäische Union“ geführt wurde. Von den europapolitischen Initiativen und Reformvorschlägen, die von verschiedenen Seiten eingebracht worden sind, verdient vor allem der von Altiero Spinelli initiierte und vom Europäischen Parlament am 14. Februar 1984 mit großer Mehrheit verabschiedete „Entwurf eines Vertrages zur Gründung der Europäischen Union“ besondere Beachtung29.
Das Europäische Parlament wagte mit diesem Vertragsentwurf einen qualitativen Sprung zur Europäischen Union. Der Entwurf sah die Übertragung neuer Zuständigkeiten auf die Union vor, die in Zentralbereiche staatlicher Politik vordrängten. Zu ihnen gehörten u.a. die Wirtschafts- und Währungspolitik, die Gesellschaftspolitik mit Sozial- und Gesundheitspolitik sowie im Bereich der Außenpolitik die Fragen nach Sicherheit, Frieden und Abrüstung. Die Rechtsetzung in der Union sollte durch eine Art Zweikammersystem erfolgen, das sehr stark an die Verhältnisse in einem Bundesstaat erinnerte. Ziel dieses Systems war es, ein Gleichgewicht zwischen Europäischem Parlament und Rat der Union, der aus Mitgliedern der Regierungen bestehen sollte, herzustellen.
[22] Auch wenn dieser Vertragsentwurf keine Aussicht hatte, von den nationalen Parlamenten ratifiziert und damit geltendes Recht zu werden, stellte er für die Mitgliedstaaten eine große Herausforderung dar. Diese Herausforderung haben die Regierungen der Mitgliedstaaten angenommen. Während sie sich noch im Juni 1983 auf dem Europäischen Rat in Stuttgart lediglich darauf verständigen konnten, „der EG in einer umfassenden Aktion Impulse zur Neubelebung zu geben“, kamen die Staats- und Regierungschefs auf dem Europäischen Rat Ende Juni 1985 in Mailand überein, mit der Schaffung eines Wirtschaftsraumes ohne Grenzen, der Stärkung des Systems der EPZ unter Einschluss von Fragen der Sicherheit und Verteidigung so-[S. 48] wie der Verbesserung der Entscheidungsstrukturen der EG durch eine Stärkung der Rechte des Europäischen Parlaments den noch weiten Weg zur Europäischen Union einzuleiten. Zu diesem Zweck beschloss der Europäische Rat die Einberufung einer Regierungskonferenz, die bis zum nächsten Europäischen Rat am 2. Dezember 1985 in Luxemburg zum einen über einen Vertrag über eine Außen- und Sicherheitspolitik und zum anderen über Änderungen des E(W)G-Vertrags verhandeln sollte.
Die Verhandlungen der Regierungskonferenz offenbarten allerdings in aller Deutlichkeit, dass keines der Mitgliedsländer zum damaligen Zeitpunkt bereit und in der Lage war, unter Preisgabe wesentlicher Teile seiner Souveränität den großen Sprung zur Europäischen Union zu wagen, den das Europäische Parlament mit seinem Vertragsentwurf vorgezeichnet hatte. Es konnte deshalb auch niemanden überraschen, dass der Europäische Rat auf seiner Konferenz am 2. Dezember 1985 in Luxemburg den Beginn einer Europäischen Union noch nicht schaffte.
III. Die Einheitliche Europäische Akte
[23] Die Beschlüsse von Luxemburg lieferten gleichwohl eine tragfähige Grundlage für eine verstärkte europäische Zusammenarbeit in den Bereichen der Herstellung eines europäischen Binnenmarktes30, der Umwelt-, Forschungs- und Technologiepolitik sowie der Außenpolitik. Von besonderer Bedeutung ist dabei, dass die konkret ins Auge gefassten Fortschritte nicht – wie nach anderen Gipfelkonferenzen – in einem Schlusskommuniqué niedergelegt wurden, sondern in Gestalt der „Einheitlichen Europäischen Akte“ (EEA)31 ein rechtliches Gewand erhalten haben.
Die Präambel dieser Akte stellt noch einmal das allgemeine Ziel, die Schaffung einer „Europäischen Union“, heraus, zu dessen Verwirklichung die EG und die EPZ beitragen sollten. Im Anschluss daran wurden im Einzelnen die rechtlichen Rahmenbedingungen zur Umsetzung der auf der Gipfelkonferenz beschlossenen Fortschritte im Bereich der Institutionen der EG, der Herstellung eines europäischen Binnenmarktes, der Zusammenarbeit in der Wirtschafts- und Währungspolitik, der Sozialpolitik, der Forschung und technologischen Entwicklung und des Umweltschutzes geschaffen. Der Form nach handelte es sich dabei um Änderungen und Ergänzungen der bereits bestehenden Gründungsverträge der EG. Der dritte Teil der EEA war der bis dahin nur informell betriebenen außenpolitischen Zusammenarbeit innerhalb der EPZ gewidmet, die mit der EEA ein rechtliches Dach erhalten hatte32.
[S. 49]
Mit ihrem In-Kraft-Treten am 1. Juli 1987 wurde die EEA Bestandteil des rechtlichen Fundaments, auf dem die EG beruhte und auf dem eine Europäische Union errichtet werden sollte.
IV. Der Vertrag über die Europäische Union
1. Der Vertrag von Maastricht
[24] Die Gründung der Europäischen Union durch den Vertrag von Maastricht eröffnete eine neue Etappe auf dem Weg zur politischen Einigung Europas. Dieser Vertrag, der bereits am 7. Februar 1992 in Maastricht unterzeichnet, aber erst wegen einiger Hindernisse im Ratifizierungsverfahren (Zustimmung der dänischen Bevölkerung erst in einem zweiten Referendum; Verfassungsklage in Deutschland gegen die parlamentarische Zustimmung33) am 1. November 1993 in Kraft treten konnte34, bezeichnet sich selbst als „eine neue Stufe bei der Verwirklichung einer immer engeren Union der Völker Europas“. Er beinhaltet neben einer Reihe von Änderungen des EWG-Vertrages und des EAG-Vertrages den Gründungsakt der Europäischen Union, ohne diese allerdings selbst zu vollenden. Es ist ein erster Teilschritt auf dem Weg hin zu einer endgültigen europäischen Verfassungsordnung. Die so gegründete Europäische Union ersetzte auch nicht die Europäischen Gemeinschaften, sondern stellte diese mit den neuen „Politiken und Formen der Zusammenarbeit“ (ex-Art. 1 UAbs. 3 EUV) unter ein gemeinsames Dach. Dies führte bildlich gesprochen zu drei Säulen, auf denen die Europäische Union beruhte: Die erste Säule bildeten die zwei noch verbliebenen Europäischen Gemeinschaften (EG und EAG), die weiter vertieft und um eine Wirtschafts- und Währungsunion erweitert wurden. Die zweite Säule bestand in der Zusammenarbeit der Mitgliedstaaten der EU im Bereich der Gemeinsamen Außen- und Sicherheitspolitik, die darauf abzielt, die Sicherheit der EU und ihrer Mitglieder zu stärken, den Weltfrieden zu wahren und die internationale Zusammenarbeit zu fördern sowie Demokratie, Rechtsstaatlichkeit und Menschenrechte zu gewährleisten. Die dritte Säule schließlich betraf die Zusammenarbeit der Mitgliedstaaten der EU in den Bereichen Polizeiliche und Justizielle Zusammenarbeit in Strafsachen.
[S. 50]
2. Der Vertrag von Amsterdam
[25] Eine erste Weiterentwicklung hat die EU dann mit dem Vertrag von Amsterdam erfahren, der am 2. Oktober 1997 in Amsterdam unterzeichnet wurde und nach Abschluss der Ratifizierungsverfahren in den Mitgliedstaaten am 1. Mai 1999 in Kraft getreten ist35. Er verstärkte vor allem die Gemeinsame Außen- und Sicherheitspolitik und die Zusammenarbeit der Mitgliedstaaten in den Bereichen Justiz und Inneres. Die Asyl- und Einwanderungspolitik wurde von der dritten in die erste Säule überführt. Dies hatte rechtlich die bedeutsame Konsequenz, dass diese Bereiche nicht mehr der bloßen Regierungszusammenarbeit unterlagen, sondern den strengen Verfahren und Grundsätzen der im Rahmen des EG-Vertrages durchgeführten Gemeinschaftspolitiken. Darüber hinaus verbesserte der Vertrag auch die demokratischen Grundlagen der Union und schaffte mehr Bürgernähe dadurch, dass etwa die Beschäftigung zu einem Anliegen von vorrangigem und gemeinsamem Interesse gemacht wurde und auch die anderen bürgernahen Politikbereiche, wie z.B. Umwelt-, Gesundheits- und Verbraucherpolitik, verbessert wurden. Gestärkt wurde auch der bereits mit dem Vertrag von Maastricht in „Verfassungsrang“ erhobene Grundsatz der Subsidiarität, der durch ein spezielles, dem Vertrag beigefügtes Protokoll konkretisiert wurde. Nicht gelungen ist hingegen die ebenfalls mit dem Vertrag von Amsterdam angestrebte institutionelle Reform, mit der die Gemeinschaftsinstitutionen auf den gewünschten und in Aussicht genommenen Beitritt der ost- und mitteleuropäischen Staaten vorbereitet werden sollten. Nicht zuletzt dieses Defizit führte schon sehr bald nach dem In-Kraft-Treten des Amsterdamer Vertrages zur Einsetzung einer neuen Regierungskonferenz, die sich dieses Problems annehmen und eine Lösung in einem neuen Vertragswerk erarbeiten sollte.
3. Der Vertrag von Nizza
[26] Am 11. Dezember 2000 wurde nach zehn Monaten intensiver Verhandlungen die Regierungskonferenz zum Abschluss gebracht, deren Auftrag darin bestand, die EU institutionell auf die Erweiterung vorzubereiten. Die Ergebnisse sind im „Vertrag von Nizza“ zusammengefasst, der Ende Februar 2001 in Nizza unterzeichnet wurde und nach der Ratifizierung durch die Mitgliedstaaten am 1. Februar 2003 in Kraft getreten ist.
Der Zweck dieser Vertragsreformen war es, der EU ihre Handlungsfähigkeit auch in einer um eine Vielzahl neuer Mitgliedstaaten erweiterten Union zu erhalten. Die beiden Verträge führten deshalb in erster Linie zu institutionellen Reformen. Im Vergleich zu vorangegangenen Reformrunden blieb der politische Wille zur Vertiefung der europäischen Integration vergleichsweise schwach.
[S. 51]
4. Der Vertrag über eine Verfassung für Europa
[27] Die dadurch vielfach hervorgerufene Kritik gab Anstoß zur Einleitung einer Debatte über die Zukunft der EU und ihrer institutionellen Ausgestaltung. Diese mündete in die Annahme einer Erklärung zur Zukunft der Europäischen Union durch die Staats- und Regierungschefs am 5. Dezember 2001 im belgischen Laeken. Darin verpflichtete sich die EU, demokratischer, transparenter und effizienter zu werden und den Weg zu einer Verfassung zu eröffnen. Als ein erster Schritt zur Umsetzung dieser Zielvorgabe wurde die Ausarbeitung einer Europäischen Verfassung in die Hände eines Konvents zur Zukunft Europas gelegt, dem der frühere französische Staatspräsident Valéry Giscard d’Estaing vorstand. Der vom Konvent ausgearbeitete Entwurf des „Vertrags über eine Verfassung für Europa“ wurde dem Vorsitzenden des Europäischen Rates offiziell übergeben und von den Staats- und Regierungschefs am 17. und 18. Juli 2004 in Brüssel mit verschiedenen Änderungen verabschiedet.
[28] Mit dieser Verfassung sollte aus der bisherigen Europäischen Union und der bisherigen Europäischen Gemeinschaft eine neue, einzige Europäische Union werden, die auf einem einzigen Verfassungsvertrag beruht. Daneben sollte lediglich die Europäische Atomgemeinschaft als weitere eigenständige Gemeinschaft bestehen bleiben, die jedoch – wie bisher – eng mit der neuen Europäischen Union verzahnt sein sollte. Dieser Verfassungsansatz ist dann aber im Ratifizierungsprozess gescheitert. Nach anfänglichen positiven Voten in 13 der damals noch 25 Mitgliedstaaten wurde der Verfassungsvertrag der EU in Referenden in Frankreich (54,68 % Neinstimmen bei 69,34 % Beteiligung) und den Niederlanden (61,7 % Neinstimmen bei 63 % Beteiligung) abgelehnt.
5. Der Vertrag von Lissabon
[29] Nach Verstreichen einer Reflexionsphase von beinahe zwei Jahren gelang es erst in der ersten Hälfte des Jahres 2007, ein neues Reformpaket auf den Weg zu bringen. Dieses Reformpaket nimmt formell Abschied vom europäischen Verfassungskonzept, wonach alle bestehenden Verträge aufgehoben und durch einen einheitlichen Text mit der Bezeichnung „Vertrag über eine Verfassung der EU“ ersetzt werden sollten. Stattdessen wurde ein Reformvertrag entworfen, der ganz in der Tradition der Verträge von Maastricht, Amsterdam und Nizza grundlegende Änderungen an den bestehenden EU-Verträgen vornimmt, um die Handlungsfähigkeit der EU nach innen und außen zu erhöhen, die demokratische Legitimation zu stärken und ganz allgemein die Effizienz des Handelns der EU zu verbessern. Ebenfalls nach guter Tradition wurde dieser Reformvertrag nach dem Ort seiner Unterzeichnung Vertrag von Lissabon getauft.
[30] Die Ausarbeitung des Vertrags von Lissabon ging außerordentlich zügig voran. Das lag insbesondere daran, dass die Staats- und Regierungschefs selbst auf der Sitzung des Europäischen Rates in Brüssel am 21. und 22. Juni 2007 in den Schlussfolgerungen[S. 52] im Detail festgelegt haben, in welcher Weise und in welchem Umfang die für den Verfassungsvertrag ausgehandelten Neuerungen in die bestehenden Verträge eingearbeitet werden sollten. Dabei gingen sie ganz untypisch vor und beschränkten sich nicht, wie sonst üblich, auf allgemeine Vorgaben, die dann von einer Regierungskonferenz umgesetzt werden sollten, sondern entwarfen selbst die Struktur und den Inhalt der vorzunehmenden Änderungen, wobei häufig sogar der genaue Text einer Vorschrift vorgegeben wurde. Besonders strittig dabei waren vor allem die Abgrenzung der Zuständigkeiten zwischen der EU und den Mitgliedstaaten, die Fortentwicklung der Gemeinsamen Außen- und Sicherheitspolitik, die neue Rolle der nationalen Parlamente im Integrationsprozess, die Einbindung der Charta der Grundrechte in das Unionsrecht sowie mögliche Fortschritte im Bereich der Polizeilichen und Justiziellen Zusammenarbeit in Strafsachen.