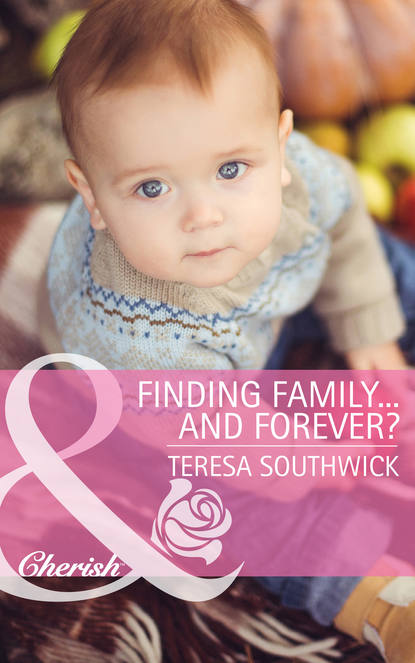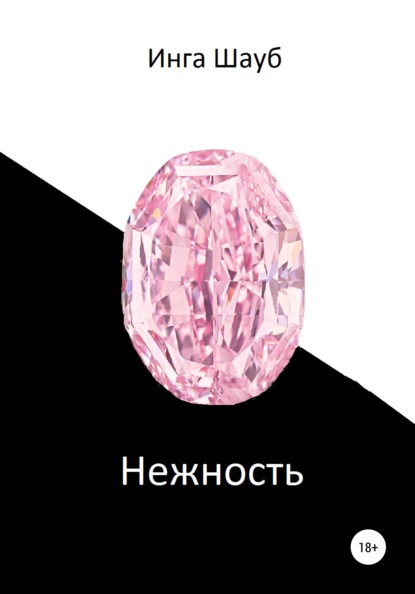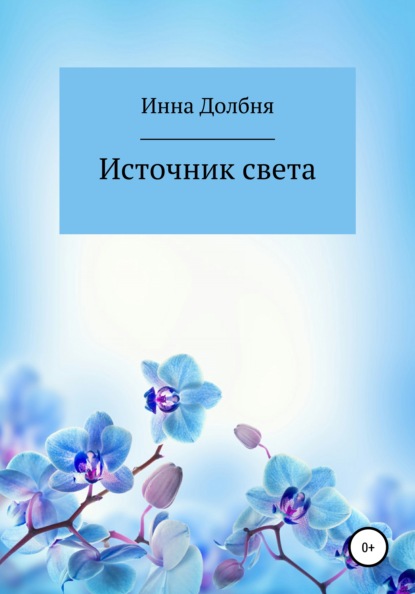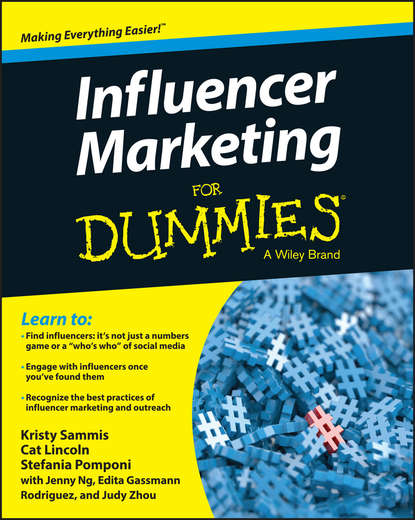Die rechtlichen Grundlagen der Europäischen Union
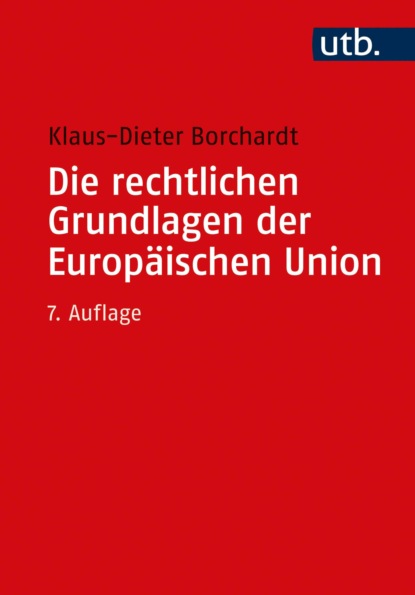
- -
- 100%
- +
2. Austritt Vereinigtes Königreich (Brexit)
[51] Drei Jahre nach dem britischen Referendum über den Austritt des Vereinigten Königreichs aus der EU vom 23. Juni 2016 (51,9% dafür – 48,1% dagegen bei 72,2% Beteiligung) und nach äußerst turbulenten Verhandlungen über das Austrittsabkommen42 wurde der Austritt des Vereinigten Königreichs aus der EU nach 47 Jahren der Zugehörigkeit zur EU zum 31. Januar 2020 endgültig besiegelt.
Im Hinblick auf den Achterbahn ähnlichen Verlauf der Verhandlungen soll im Folgenden ein kurzer Überblick über die wichtigsten Stationen bis zum Austritt am 31. Januar 2020 23h GTM (24h CTM) gegeben werden:
29.3.2017: Die Austrittserklärung des Vereinigten Königreichs aus der EU und der Europäischen Atomgemeinschaft wird dem Europäischen Rat formell durch die damalige Premierministerin May notifiziert43. Damit wurden die Fristen für die Ausarbeitung des Austrittsabkommens in Gang gesetzt. Das Vereinigte Königreich verlor das Recht auf Mitwirkung im Europäischen Rat und im Rat der EU; es behielt aber weiterhin seinen britischen Kommissar und seine Mitglieder im EP. In den Arbeitsgruppen des Rates und der Kommission konnten Vertreter des Vereinigten Königreichs im Einzelfall zugelassen werden.
29.4.2017: Der Europäische Rat mit 27 Mitgliedstaaten gibt noch an demselben Tag die Verhandlungsposition der EU bekannt und bestätigt Michel Barnier als Verhandlungsführer auf Seiten der EU; er ist zugleich der Leiter der bei der Kommission eingerichteten Task Force Artikel 5044.
[S. 61]
22.5.2017: Der Rat ermächtigt die Kommission zur Aufnahme von Verhandlungen und gibt unter Berücksichtigung der Verhandlungsposition des Europäischen Rates die Leitlinien für die Verhandlungen vor45.
19.6.2017: Auftakt der Verhandlungen zwischen der EU und dem Vereinigten Königreich.
14./25.11.2018: Abschluss eines vorläufigen Austrittsabkommens, das den Verbleib des Vereinigten Königreichs in einer Zollunion mit der EU vorsieht bis in einem weiteren Abkommen über die zukünftigen Beziehungen zwischen dem Vereinigten Königreich und der EU eine Lösung für die Grenze zwischen Nordirland und der Republik Irland gefunden wird (sog. „Backstop“).
11.1.2018: Beschluss des Rates über die Unterzeichnung des Austrittsabkommens46.
15.1.2019: Ablehnung des vorläufigen Austrittsabkommens durch das britische Unterhaus mit 432 Nein- gegenüber 202 Ja-Stimmen.
11.3.2019: Kommissionspräsident Juncker versichert der Premierministerin May, dass der „Backstop“ nicht dazu missbraucht werden wird, das Vereinigte Königreich in der Zollunion zu binden, um so eine weitere Abstimmung über das Austrittsabkommen zu ermöglichen (sog. „Straßburger Vereinbarung“).
12.3.2019: Erneutes Scheitern der Abstimmung über das Austrittsabkommen im Unterhaus trotz der „Straßburger Vereinbarung“ mit 391 Nein- gegenüber 242 Ja-Stimmen.
13.3.2019: Das Unterhaus lehnt einen Austritt aus der EU ohne Abkommen (sog. „harter Brexit“) ab und befürwortet am nächsten Tag die Beantragung einer Fristverlängerung.
20./21.3.2019: Premierministerin May stellt den Antrag auf Fristverlängerung beim Präsidenten des Europäischen Rates Tusk, worauf der Europäische Rat die Frist bis zum 12.4.2019 verlängert, was eine eventuelle Teilnahme des Vereinigten Königreichs an den Wahlen zum EP im Mai ermöglicht. Falls das Unterhaus das Austrittsabkommen bis Ende März genehmigen sollte, wird eine Fristverlängerung bis zum 22.5.2019 in Aussicht gestellt.
25.–27.3.2019: Das Unterhaus zieht den Brexit an sich und kündigt Alternativen zum vorgelegten Austrittsabkommen an.
29.3.2019: Das Unterhaus lehnt das Austrittsabkommen zum dritten Mal mit 344 Nein- gegenüber 286 Ja-Stimmen ab.
1.4.2019: Das Unterhaus lehnt vier Alternativvorschläge zum Austrittsabkommen ab und verwirft abermals die Möglichkeit eines „harten Brexit“.
[S. 62]
5./11.4.2019: Premierministerin May beantragt eine erneute Fristverlängerung, dieses Mal bis zum 30.6.2019. Der Europäische Rat optiert dagegen für eine „Flextension“, wonach der Brexit spätestens zum 31.10.2019 oder frühestens mit Annahme des Austrittsabkommens erfolgen soll. Das Vereinigte Königreich wird verpflichtet, an den Wahlen zum EP im Mail teilzunehmen.
23.5.2019: Die Brexit-Partei von Nigel Farage wird mit 30% stärkste Kraft in den Europawahlen im Vereinigten Königreich und erhält 29 der 73 britischen Sitze im EP, während die Konservativen um Premierministerin May nur 4 Sitze erringen.
24.5.2019: Premierministerin May erklärt ihren Rücktritt zum 7.6.2019.
23.7.2019: Boris Johnson tritt die Nachfolge als Premierminister an.
28.8.2019: Premierminister Johnson kündigt seine Absicht an, das britische Parlament für die Zeit vom 9.9. bis zum 14.10.2019 zu suspendieren.
4.9.2019: Das Unterhaus beschließt einen Text, der es Premierminister Johnson untersagt, einen „harten Brexit“ zu provozieren und verlangt die Beantragung einer weiteren Verlängerung, falls es zu keinem Einverständnis über das Austrittsabkommen kommt.
1.10.2019: Premierminister Johnson legt seinerseits einen Entwurf für ein Austrittsabkommen vor, der jedoch vom Europäischen Rat abgelehnt wird, allerdings mit dem Hinweis, dass durchaus Fortschritte in der britischen Haltung zu erkennen seien.
17.10.2019: Premierminister Johnson und Kommissionspräsident Juncker kündigen die Einigung über den Austrittsvertrag an, der insbesondere eine neue Lösung des Problems der Grenze zwischen Nordirland und der Republik Irland enthält47.
19.10.2019: Das Unterhaus lehnt auch diesen Kompromiss in einem beschleunigten Verfahren ab. Premierminister Johnson ist gezwungen, in Brüssel um eine erneute Fristverlängerung zu beantragen.
28.10.2019: Der Europäische Rat gewährt eine Fristverlängerung bis zum 31.1.2020.
29.10.2019: Nach dieser Fristverlängerung beschließt das Unterhaus mit den Stimmen der oppositionellen Labour Partei Neuwahlen für den 12.12.2019, die Premierminister Johnson relativ klar gewinnt.
9.1.2020: Das Unterhaus stimmt dem Austrittsabkommen mit 330 Ja- und 231 Nein-Stimmen endgültig zu. Das Oberhaus schließt sich diesem Votum an.
24.1.2020: Der Präsident des Europäischen Rates Charles Michel, Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen für die EU in Brüssel und Premierminister Boris Johnson für das Vereinigte Königreich in London unterzeichnen das Austrittsabkommen.
[S. 63]
29.1.2020: Das Europäische Parlament erteilt seine Zustimmung zum Austrittsabkommen (621 Ja – 49 Nein – 13 Enthaltungen).
30.1.2020: Der Rat nimmt den Beschluss über den Abschluss des Austrittsabkommens im schriftlichen Verfahren an.
31.1.2020 23h GMT/24h MEZ: Das Vereinigte Königreich verlässt die EU.
2.3.2020: Beginn der Verhandlungen über die künftigen Beziehungen zwischen dem Vereinigten Königreich und der EU, die bis zum 31.12.2020 abgeschlossen sein müssen, wenn keine Fristverlängerung für die Übergangszeit beantragt wird.
1.7.2020: Letzte Möglichkeit der Beantragung einer Fristverlängerung für die Übergangszeit um maximal zwei Jahre.
Kernstück des Austritts ist das Austrittsabkommen (dazu unter a)), mit dem die Grundlagen des Austritts geregelt werden. Es wird ergänzt durch eine Politische Erklärung (dazu unter b), die den Rahmen der Verhandlungen über die zukünftigen Beziehungen zwischen dem Vereinigten Königreich und der EU vorzeichnet (dazu unter c)).
a) Austrittsabkommen
• Anwendung des EU-Rechts während der Übergangszeit
Bis zum 31. Dezember 2020 (verlängerbar um 1 oder 2 Jahre, Art. 126, Art. 132 EUVK-Abkommen) gilt das Unionsrecht auch für das Vereinigte Königreich grundsätzlich wie bisher (Art. 127A VK-EU-Abkommen). Ausgenommen hiervon sind nur die institutionellen Bestimmungen (Art. 7, Art. 128 VK-EU-Abkommen).
• Das Problem der irischen Grenze
Nachdem der von der EU verlangte „Backstop“, der zur Vermeidung einer fühlbaren Grenze zwischen Nordirland und der Republik Irland praktisch das gesamte Vereinigte Königreich in eine Zollunion mit der EU gezwungen hätte, enthält das Austrittsabkommen nun eine auch für das Vereinigte Königreich akzeptable Regelung.
Ein Protokoll zum Austrittsabkommen stellt unmissverständlich klar, dass Nordirland Teil des Zollgebiets des Vereinigten Königreichs ist. Die Handelsabkommen, die das Vereinigte Königreich nach Ablauf der Übergangsfrist am 31.12.2020 (soweit keine Verlängerung vereinbart wird) und dem Verlassen der Zollunion der EU schließen kann, gelten auch uneingeschränkt in Nordirland. Nordirland wird deshalb eine Grenze mit der Republik Irland und damit mit dem Binnenmarkt und der Zollunion der EU haben, was theoretisch auch Warenkontrollen an dieser Grenze verlangen würde. Dies widerspräche aber dem Friedensabkommen von Belfast aus dem Jahre 1998 (auch bekannt als Good Friday Agreement), das nach 30 Jahren Bürgerkrieg zwischen dem Vereinigten Königreich, der Republik Irland und Unionisten sowie Nationalisten in Nordirland geschlossen wurde.
[S. 64]
Deshalb wurde im Austrittsabkommen vereinbart, die Zollgrenze zwischen dem Vereinigten Königreich und der EU ins Meer zwischen dem Vereinigten Königreich und Nordirland zu verlegen. Nordirland bleibt dabei allen relevanten Zoll- und Marktregelungen der EU unterworfen, insbesondere den Warenverkehrsregelungen, den Gesundheitsstandards, den Produktionsstandards, den Verkaufsmodalitäten für Agrarprodukte, den Mehrwert- und Verbrauchssteuerregeln sowie den Regelungen über die staatliche Beihilfenaufsicht. Die in Nordirland hergestellten Waren können so ohne jede Grenzkontrolle in die Republik Irland (und von dort an jeden Ort der EU) verbracht werden.
Alle anderen Waren und Produkte, die nach Nordirland eingeführt werden, werden von den britischen Zollbehörden in den Schiffs- und Flughäfen kontrolliert. Dabei muss vor allem festgestellt werden, ob diese Waren und Produkte allein für einen der britischen Märkte bestimmt sind, oder ob sie das „Risiko“ in sich bergen, über die Republik Irland in das Marktgebiet der EU verbracht zu werden. Ein Gemeinsamer Ausschuss wird auf der Grundlage bestimmter Kriterien (Natur und Wert des Produkts, Verwendung zum Direktverbrauch oder zur weiteren Verarbeitung, Wahrscheinlichkeit des Missbrauchs, etc.) das „Risiko“ einzugrenzen versuchen und Ausnahmen vorsehen. Die zollrechtliche Behandlung richtet sich dann nach der Zuordnung zum jeweiligen Zollgebiet: sofern die Ware für den Markt in Nordirland vorgesehen ist, finden die britischen Zollregeln vollumfänglich Anwendung; besteht hingegen das „Risiko“, dass sich diese Waren auf dem Binnenmarkt der EU wiederfinden, gelten die zollrechtlichen Vorschriften der EU.
Nach der Übergangszeit kann das nordirische Parlament alle vier Jahre mit einfacher Mehrheit entscheiden, ob es die Anwendung der europäischen Regeln beibehalten will. Bei einer (nicht sehr wahrscheinlichen) negativen Entscheidung verlieren die europäischen Vorschriften nach zwei Jahren auch in Nordirland ihre Gültigkeit; der Gemeinsame Ausschuss muss in diesem Fall während der zwei Jahre eine andere Lösung finden, die eine physische Grenze zwischen Nordirland und der Republik Irland verhindert.
• Gegenseitige Bürgerrechte
Vor dem Hintergrund, dass 3,2 Millionen Unionsbürger im Vereinigten Königreich ansässig sind, und dass 1,2 Millionen britische Staatsangehörige in der EU leben, ist die Frage des gegenseitigen Schutzes der Bürgerrechte eine absolute Priorität. Nach dem Austrittsabkommen genießen Unionsbürger und britische Bürger, die ihr Recht auf Aufenthalt im jeweiligen Hoheitsgebiet vor dem Ende der Übergangszeit (31.12.2020 plus eventuell maximal 2 Jahre Verlängerung) ausgeübt haben und danach weiter dort wohnen, auf Lebenszeit alle Rechte, die ihnen auch vor dem Austritt zugestanden haben; dies schließt ihre Familienangehörigen mit ein. Sie können auch nach dem Ende der Übergangszeit weiter ihren Lebensschwerpunkt dort bewahren, arbeiten oder studieren. Ihre Ehepartner, Kinder oder Enkelkinder,[S. 65] die in einem anderen Staat leben, können jederzeit in das Hoheitsgebiet des Familienangehörigen übersiedeln. Die Berechtigten bewahren auch sämtliche Ansprüche auf Gesundheitsleistungen und sonstige Leistungen der sozialen Sicherheit. Die gegenseitige Anerkennung von Berufsqualifikationen wird gewährleistet. Jedwede Diskriminierung aus Gründen der Staatsangehörigkeit ist auch weiterhin verboten, und dies über den Übergangszeitraum hinaus. Sie genießen vollständige Gleichbehandlung, insbesondere im Hinblick auf gleiche Rechte und Chancen beim Zugang zur Beschäftigung und Ausbildung.
Allerdings gelten diese Rechte nicht mehr automatisch. Vielmehr müssen etwa Unionsbürger bis zum Juni 2021 ihren Status als Aufenthaltsberechtigter im Vereinigten Königreich geltend machen. Bei Versäumung der Frist kann dieser Status nur bei Vorliegen guter Gründe für die verspätete Antragsstellung erlangt werden.
• Institutionelle Bestimmungen
Ein Gemeinsamer Ausschuss, der sich zu gleichen Teilen aus Vertretern des Vereinigten Königreichs und der EU zusammensetzt, hat die Aufgabe, die Umsetzung und Anwendung des Austrittsabkommens zu überwachen und zu erleichtern. Er kann Beschlüsse fassen und beiden Parteien geeignete Empfehlungen unterbreiten (Art. 164ff. VK-EU-Abkommen). Der Gemeinsame Ausschuss ist auch zuständig für die Entscheidung über eine eventuelle Verlängerung des Übergangszeitraums um ein oder zwei Jahre. Der Ausschuss ist darüber hinaus insbesondere auch für die Regelung von Streitfällen zuständig. Falls es dem Ausschuss nicht gelingt, eine für beide Seiten akzeptable Lösung zu finden, kann jede der beiden Parteien ein spezifisches Schiedspanel bestehend aus 5 Richtern anrufen, an dessen Entscheidung die Parteien gebunden sind und deren Nichtbeachtung mit Sanktionen oder sogar der Aussetzung des Abkommens (allerdings mit Fortgeltung der gegenseitigen Bürgerrechte) geahndet werden kann. Falls der Streitfall Fragen zur Auslegung des Unionsrechts aufwirft, müssen diese dem EuGH zur Vorabentscheidung vorgelegt werden.
• Spezielle Regelungen für die Übergangszeit
Die Parteien haben im Austrittsabkommen eine Reihe von Übergangsbestimmungen niedergelegt, die nur für den Zeitraum vom 1. Februar 2020 bis zum 31. Dezember 2020 (oder im Falle einer Verlängerung der Übergangszeit bis zu deren Ende) gelten:
• das Vereinigte Königreich verbleibt provisorisch im Binnenmarkt und der Zollunion der EU. Waren, die vor dem Ende der Übergangszeit im Vereinigten Königreich in den freien Verkehr gebracht worden sind, unterliegen auch nach dem Ende der Übergangszeit den Regeln des freien Warenverkehrs. Urheberrechte, die vor Ablauf der Übergangszeit gewährt wurden, gelten fort (Art. 50 VK-EU-Abkommen).
• Das Vereinigte Königreich unterliegt nach wie vor den Verpflichtungen aus den von der EU mit Drittländern abgeschlossenen Handelsabkommen. Es kann eigene[S. 66] Handelsabkommen verhandeln, unterzeichnen und ratifizieren, kann diese Abkommen aber erst nach Ablauf der Übergangszeit in Kraft setzen.
• Verwaltungsverfahren, insbesondere in den Bereichen Wettbewerb und staatliche Beihilfen, die vor dem Ende der Übergangszeit eingeleitet worden sind, werden bis zur Endentscheidung und Vollstreckung fortgesetzt (Art. 92 VK-EU-Abkommen).
• Die Sitzabkommen für die Europäische Bankenaufsicht, die Europäische Arzneimittel-Agentur und die Galileo-Sicherheitsüberwachungszentrale müssen bis zum Abschluss des Umzugs beendet werden (Art. 119 VK-EU-Abkommen).
• Der EuGH bleibt für alle vor dem Ende der Übergangszeit eingeleiteten Verfahren (Vorabentscheidungen, Vertragsverletzungen, Direktklagen etc.) von oder gegen das Vereinigte Königreich noch 4 Jahre nach dem Ende der Übergangszeit bis zur endgültigen Entscheidung zuständig (Art. 86f. VK-EU-Abkommen).
• In die auswärtigen Angelegenheiten wird das Vereinigte Königreich während der Übergangszeit nur insoweit einbezogen, als es selbst betroffen ist, wie z.B. im Falle eines gemischten Abkommens oder im Einzelfall auf Einladung (Art. 129 VK-EU-Abkommen).
• Finanzbestimmungen
Das Vereinigte Königreich muss alle unter dem mehrjährigen Finanzrahmen der EU 2014–2020 eingegangenen finanziellen Verpflichtungen vollumfänglich erfüllen, einschließlich solcher, die über die Übergangsperiode hinausgehen (Art. 135ff. VK-EU-Abkommen). Auf eine einfache Formel gebracht bedeutet dies: die von der EU- 28 eingegangenen finanziellen Verpflichtungen sind von der EU-28 zu erfüllen. Das Vereinigte Königreich zahlt folglich seinen Anteil am Europäischen Entwicklungsfonds oder der Fazilität für die Flüchtlinge in der Türkei. Es erfüllt seine Verpflichtungen gegenüber der Europäischen Investitionsbank bis 2030, während die Europäische Zentralbank dem Vereinigten Königreich seine Einlagen zurückbezahlt. Bis 2064 muss das Vereinigte Königreich auch seinen Anteil in die Pensionskasse der EU einzahlen. Obwohl noch keine endgültigen Zahlen vorliegen, wird der Gesamtaufwand des Vereinigten Königreichs allgemein auf 40 Milliarden Euro geschätzt.
b) Politische Erklärung
Dem Austrittsabkommen wurde eine Politische Erklärung vom 17. Oktober 2019 beigefügt48, die die groben Linien für die Verhandlungen zwischen der EU und dem Vereinigten Königreich über die zukünftigen Beziehungen vorzeichnet49. Diese Erklärung bedarf nicht der Ratifizierung und ist rechtlich nicht bindend. Sie enthält die gemeinsame Absicht, die formalen Verhandlungen über ein Abkommen über die zukünftigen Beziehungen sobald wie möglich nach dem Austritt des Vereinigten[S. 67] Königreichs aus der EU zu beginnen, so dass sein Inkrafttreten zum 31. Dezember 2020 erfolgen kann.
Die Politische Erklärung bekräftigt den Willen beider Parteien zu einer ehrgeizigen, breiten, tiefen und flexiblen Partnerschaft, deren Kern eine Freihandelszone ist. Als Grundprinzip soll dabei gelten, dass jedes einzelne Verhandlungsergebnis auf der einen Seite die vier Grundfreiheiten der EU, d.h. den freien Verkehr von Waren, Dienstleistungen, Kapital und Personen, und auf der anderen Seite die Souveränität des Vereinigten Königreichs respektieren soll.
Die Parteien streben ein ambitioniertes Freihandelsabkommen an mit „Null-Zollsätzen, Null-Quoten und Null-Dumping“. Es ist ein besonderes Anliegen der EU, dass die künftigen Handelsbeziehungen auf „gleichwertige Wettbewerbsbedingungen (level playing field)“ gegründet werden, wozu vor allem gemeinsame Standards in den Bereichen staatliche Beihilfen, soziale Sicherheit, Umwelt und Steuern vereinbart werden müssen.
Die Politische Erklärung enthält darüber hinaus Hinweise für die Verhandlungen betreffend die Finanzleistungen, die Zusammenarbeit in den Bereichen Sicherheit und Verteidigung und nicht zuletzt die Fischereirechte in den britischen Gewässern. Eine enge Zusammenarbeit soll auch in den globalen Aufgaben wie z.B. dem Klimaschutz, dem Umweltschutz oder der Entwicklungshilfe vereinbart werden.
c) Finale Regelung der zukünftigen Beziehungen
[53] Den ersten Schritt zur Eröffnung der Verhandlungen über die zukünftigen Beziehungen zwischen der EU und dem Vereinigten Königreich hat die Kommission am 3. Februar 2020 mit einer entsprechenden an den Rat gerichteten Empfehlung gemacht50. Die Empfehlung beruht auf den Leitlinien und Schlussfolgerungen des Europäischen Rates sowie auf der Politischen Erklärung des Vereinigten Königreichs und der EU vom 19. Oktober 2019.
Diese Empfehlung enthält auch einen umfassenden Vorschlag für die Verhandlungsleitlinien des Rates mit der Definition des Anwendungsbereichs und den Eckpunkten für die zukünftigen Beziehungen mit dem Vereinigten Königreich aus EU-Sicht. Die Leitlinien erstrecken sich auf alle Politikbereiche, die die zukünftigen Beziehungen zum Vereinigten Königreich ausmachen werden, namentlich Handel und Wirtschaftskooperation, Rechtsdurchsetzung und gerichtliche Zusammenarbeit in Strafsachen, Außenpolitik, Sicherheit und Verteidigung, Teilnahme an Unionsprogrammen und Zusammenarbeit in verschiedenen thematischen Bereichen.
Anders als in der Regelung der Beziehungen der EU zur Schweiz, wo man den Weg von mehr als ein Dutzend Einzelabkommen gewählt hat, sollen die künftigen Beziehungen zum Vereinigten Königreich in einem einzigen umfassenden Regelwerk[S. 68] (mit unter Umständen einigen wenigen Teilabkommen, wie etwa für die Fischerei) geregelt werden, das auf drei Säulen beruhen soll:
(1) Allgemeine Regelungen zu den grundlegenden Werten, Grundsätzen und der Governance: die Parteien sollen anerkennen, dass Wohlstand und Sicherheit nur im Rahmen einer auf dem Recht beruhenden internationalen Ordnung gewährleistet werden kann. Sie sollen sich zum Schutz der Individualrechte und der Rechtsstaatlichkeit bekennen, hohe Schutzstandards für Arbeitnehmer und Verbraucher anstreben, den Umweltschutz und den Kampf gegen den Klimawandel mit Nachdruck betreiben sowie auf einen freien und fairen Handel hinwirken.
Die Parteien sollen sich zur Zusammenarbeit verpflichten, um diese allgemeinen Prinzipien zu schützen und gemeinsam gegen interne wie externe Angriffe auf diese Werte und Interessen vorgehen.
(2) Wirtschaftliche Regelungen: die Parteien sollen einen angemessenen Ausgleich zwischen Rechten und Pflichten herstellen und gleichwertige Wettbewerbsbedingungen („level playing field“) schaffen. Dieser Ausgleich darf die Autonomie des Entscheidungsprozesses und der Rechtsordnung der EU nicht beeinträchtigen, muss den Schutz der finanziellen Interessen der EU gewährleisten und muss vereinbar sein mit den anderen Unionsprinzipien, insbesondere der Integrität des Binnenmarktes und der Zollunion sowie der Unteilbarkeit der vier Grundfreiheiten, wie es in den Leitlinien des Rates niedergelegt ist. Schließlich muss beachtet werden, dass das Vereinigte Königreich ein Drittstaat ohne Schengen-Status ist und dass das Vereinigte Königreich als Nicht-Mitgliedstaat der EU nicht den gleichen Verpflichtungen unterliegt wie die EU-Mitgliedstaaten und deshalb auch nicht die gleichen Rechte und Vorteile eines Mitgliedstaats genießen kann.
(3) Regelungen betreffend die Sicherheit: die Parteien sollen gemeinsame Anstrengungen im Hinblick auf die Durchsetzung des Rechts und die gerichtliche Zusammenarbeit in Strafsachen unternehmen und für eine enge Kooperation in der Außen-, Sicherheits- und Verteidigungspolitik Sorge tragen.
Zum territorialen Geltungsbereich der zukünftigen Partnerschaft ist die Erklärung des Europäischen Rates vom 25. November 2018 zu Gibraltar von Bedeutung. Danach wird Gibraltar nach dem Austritt des Vereinigten Königreichs nicht in den territorialen Geltungsbereich des die zukünftigen Beziehungen zwischen der EU und dem Vereinigten Königreich regelnden Abkommens einbezogen. Dies schließt allerdings die Möglichkeit nicht aus, dass die EU und das Vereinigte Königreich im Hinblick auf Gibraltar ein separates Abkommen vereinbaren. Ein solches separates Abkommen bedarf jedoch im Hinblick auf die Kompetenzen der EU und den Respekt der territorialen Integrität ihrer Mitgliedstaaten (Art. 4 Abs. 2 TEU) der Zustimmung Spaniens.
Nach der Kommission-Empfehlung soll das Abkommen mit dem Vereinigten Königriech auf Art. 217 AEUV und nicht, wie sonst bei Freihandelsabkommen üblich,[S. 69] auf Art. 207 AEUV gestützt werden. Dies hat zur Folge, dass dem Abkommen mit dem Vereinigten Königreich alle Mitgliedstaaten im Rat zustimmen müssen, da Art. 217 AEUV Einstimmigkeit und nicht, wie Art. 207 AEUV, nur eine qualifizierte Mehrheit verlangt. Offen ist auch noch, ob das Abkommen mit dem Vereinigten Königreich als allein dem Zuständigkeitsbereich der EU unterliegend angesehen wird, dann genügt die Einstimmigkeit im Rat, oder als ein gemischtes Abkommen, dann müssen die nationalen Parlamente das Abkommen zusätzlich nach ihren verfassungsrechtlichen Bestimmungen ratifizieren.