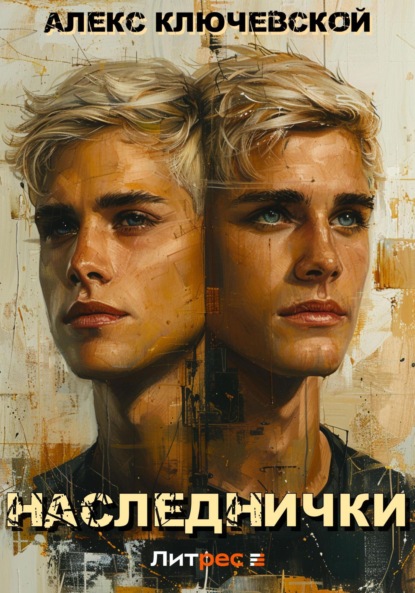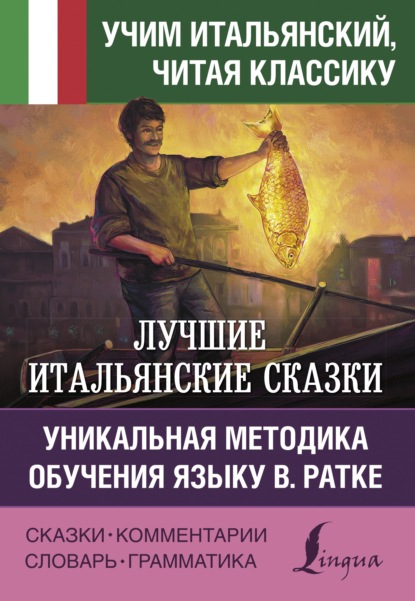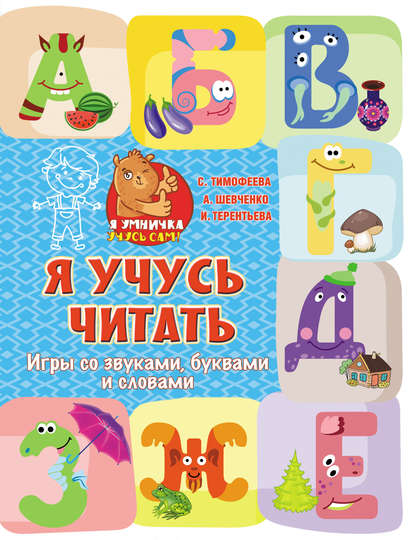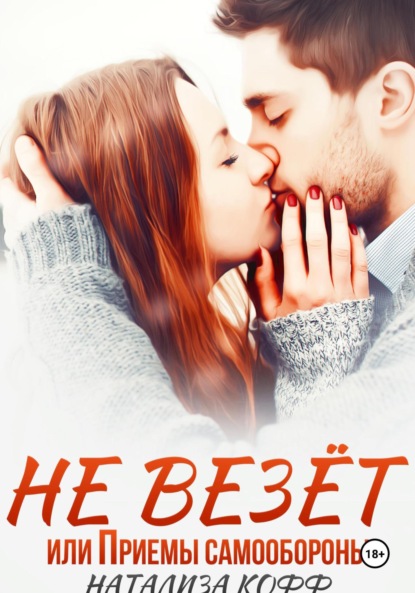Die rechtlichen Grundlagen der Europäischen Union
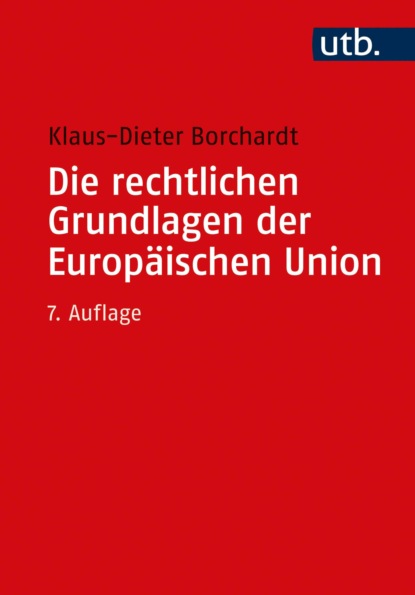
- -
- 100%
- +
Nach Ansicht der Kommission sollten die Verhandlungen wie folgt ablaufen, wenn das Ergebnis zum 31. Dezember 2020, also ohne Verlängerung der Übergangszeit, vorliegen soll:
Februar 2020: Kommission ersucht den Rat um ein Verhandlungsmandat März – Mai 2020: 1. Verhandlungsrunde mit einigen wichtigen Meilensteinen. • EU-Vereinigtes Königreich High Level Konferenz • Ende der Antragsfrist für eine Verlängerung der Übergangszeit • Versuch, das Fischereiabkommen abzuschließen • Europäischer Rat im Juni Juni – Oktober 2020: 2. Verhandlungsrunde, die zum Abschluss des Abkommens führen soll, mit einem Europäischen Rat im Oktober Oktober – Dezember 2020: Abschluss und Ratifizierung der(s) ersten Abkommen(s), womit die Beziehungen zwischen der EU und dem Vereinigten Königreich auf eine neue rechtliche Grundlage gestellt werden Januar – Dezember 2021: Verhandlung der noch ausstehenden Sachfragen.IV. Die (Beitritts-) Assoziierung
[54] Die Assoziierung ist eine besondere Form der vertraglichen Beziehungen zu den Drittstaaten, die über rein handelspolitische Regelungen hinaus eine enge wirtschaftliche Kooperation und finanzielle Unterstützung gewährt.
In Gestalt der Beitrittsassoziierung ist sie gleichsam eine Vorstufe des Beitritts, auf der eine Annäherung der wirtschaftlichen und sozialen Bedingungen eines Beitrittskandidaten an die Verhältnisse innerhalb der EU angestrebt wird51. Dieses Verfahren[S. 70] hat sich bereits im Falle Griechenlands, das der damaligen EWG im Jahre 1962 assoziiert wurde, bewährt. Diesen Weg hat die EU auch zur Vorbereitung des Beitritts der mittel- und osteuropäischen Staaten mit den sogenannten „Europa-Abkommen“ eingeschlagen. Anwendung findet diese Strategie nun auch im Rahmen des Beitrittsprozesses der Staaten des westlichen Balkans, die durch Stabilisierungs- und Assoziierungsabkommen (Ehemalige Jugoslawische Republik Mazedonien, jetzt Republik Nordmazedonien), 2004, Albanien, 2006, Serbien, 2008, Montenegro, 2010) bzw. Europäische Partnerschaftsabkommen (Bosnien und Herzegowina, 2008, Kosovo, 2008) auf ihrem Weg zu einem möglichen Beitritt zur EU begleitet werden. Der Stabilisierungs- und Assoziierungsprozess verfolgt drei Ziele: (1) Stabilisierung und schnellen Wechsel zu einer funktionierenden Marktwirtschaft, (2) Förderung von regionaler Kooperation und (3) Aussicht auf eine Mitgliedschaft in der EU. Der Stabilisierungs- und Assoziierungsprozess basiert auf einer fortschreitenden Partnerschaft, bei der die EU Handelszugeständnisse, wirtschaftliche und finanzielle Unterstützung anbietet. Jedes Land muss konkrete Fortschritte im Rahmen des Stabilisierungs- und Assoziierungsprozess machen, um den Anforderungen einer eventuellen Mitgliedschaft zu genügen. In jährlichen Berichten wird der Fortschritt der westlichen Balkanländer in Richtung eines möglichen Beitritts zur EU bewertet.
[55] Eine institutionell wie materiell bereits weit reichende (Beitritts-)Assoziierung beinhaltet das Abkommen über den Europäischen Wirtschaftsraum (EWR), das zwischen der EU und ihren Mitgliedstaaten einerseits und den EFTA-Staaten andererseits besteht52. Innerhalb des EWR soll auf der Grundlage des Bestandes an primärem und sekundärem Unionsrecht („acquis communautaire“) der freie Waren-, Personen-, Dienstleistungs- und Kapitalverkehr verwirklicht, eine einheitliche Wettbewerbs- und Beihilfenordnung statuiert sowie die Zusammenarbeit im Bereich der horizontalen Politiken (z.B. Umweltschutz, Forschung und Entwicklung, Bildung) vertieft werden53. Durch das EWR-Abkommen mit der EU verbunden waren ursprünglich Österreich, Island, Norwegen, Schweden, Finnland und Liechtenstein. Durch den Beitritt Österreichs, Finnlands und Schwedens zur EU sind Vertragspartner der EU im Rahmen des EWR-Abkommens nur noch Norwegen, Island und Liechtenstein.
Weiterführende Literatur: Adam, BREXIT, Eine Bilanz, 2019; Beise, Die DDR und die EG, EA 1990, S. 149 ff.; Bruha, Verfassungsrechtliche Aspekte der Rechtsetzung im EWR, Außenwirtschaft 1991, S. 357; Burtscher, Der EWR, in: Röttinger-Weyringer, Handbuch der europäischen Integration, S. 508; Doehring, Einseitiger Austritt aus der Europäischen Gemeinschaft, in FS Schiedermair, 2001, S. 695; Ehlermann, Mitgliedschaft in der EG, EuR 1984, S. 113 ff.; EG-Kommission (Hrsg.), Die Zwölfergemeinschaft nach dem Beitritt Spaniens und Portugals, 1985; Hummer, Der EWR und seine Auswirkungen auf Österreich,[S. 71] EuZW 1992, 361; Jansohn, Brexit means Brexit, Akademie der Wissenschaften und der Literatur, 2018; Köck, Ist ein EWG-Beitritt Österreichs zulässig?, 1987; Kreidler-Pleus, Der EG-Beitritt Portugals, 1990; Lasok, The UK as member of the EC, 1986; Miller, Rechtsprobleme der Mitgliedschaft Irlands in der EG, 1986; Rentmeister, Österreich und die EG, Die politische Dimension eines möglichen Beitritts, EA 1989, S. 155 ff, Schumann, Dänemark in der Gemeinschaft, 1985; Sommermann, Rechtsprobleme nach dem Eintritt Spaniens und Portugals in die EG, DVBl. 1987, S. 936; v.d. Groeben, Die Erweiterung der EG durch den Beitritt der Länder Griechenland, Spanien und Portugal, 1979; Wölker, Rechtsprobleme nach dem Eintritt Spaniens und Portugals in die EG, JZ 1988, S. 140 ff.
[S. 72]
§ 2 Ziele, Methoden und Akteure der europäischen Einigung
A. Ziele der europäischen Einigung
[56] Die verstärkten europäischen Einigungsbemühungen nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs beruhten – wie bereits gesehen – auf der Einsicht, dass nur durch die Einigung Europas ein Schlussstrich unter die Geschichte der Kriege und des Blutvergießens, der Leiden und der Zerstörung in Europa gezogen werden konnte.
Von diesem Grundanliegen sind auch die ursprünglichen Gründungsverträge der EG und die heute geltenden EU-Verträge geprägt. Als oberste Ziele formulieren sie die Wahrung und Festigung des Friedens, die wirtschaftliche Einigung zum Nutzen aller innerhalb der EU lebenden Bürger durch Schaffung eines europäischen Binnenmarktes, das Streben nach politischer Einheit und nicht zuletzt die Stärkung und Förderung des sozialen Zusammenhalts in der Union (vgl. den Zielekatalog in Art. 3 EUV):
I. Die Sicherung des Friedens
[57] Bereits der Schuman-Plan, der zur Gründung der EGKS geführt hat, sah in der deutsch-französischen Aussöhnung nicht nur das Kernstück einer neuen europäischen Ordnung, sondern zielte ausdrücklich auf die Schaffung von Bedingungen ab, die jeden Krieg unwahrscheinlich, wenn nicht unmöglich machen sollten. Dies ist mit der Schaffung zunächst der E(W)G und danach der EU gelungen. Mehr als 70 Jahre Frieden in Europa beweisen das. Gewalt in der Form des Krieges ist zwischen den Mitgliedstaaten der EU undenkbar geworden. 2012 wurde die EU für ihren Einsatz für Frieden, Versöhnung, Demokratie und Menschenrechte in Europa mit dem Friedensnobelpreis ausgezeichnet.
Frieden in Europa ist aber keine Selbstverständlichkeit. Vielmehr gilt es über die innerhalb der EU geschaffene Friedenszone hinaus friedensstiftend tätig zu werden. Verbesserte Möglichkeiten sollten sich dafür im Rahmen der Zusammenarbeit der Mitgliedstaaten der EU in der Außen- und Sicherheitspolitik bieten.
II. Die wirtschaftliche Einigung
[58] Die wirtschaftliche Einigung war stets die Triebfeder des europäischen Einigungsprozesses. Die Europäische Gemeinschaft für Kohle und Stahl (EGKS) erfüllte diese Aufgabe bis 2002 im Rahmen der gemeinschaftlichen Verwaltung der Kohle- und Stahlindustrie. Mit Wirkung vom 24. Juli 2002 wurden die Bereiche Kohle und Stahl zunächst den Regeln des EG-Vertrages und später den Regeln der EU- Verträge unterstellt. Zu den Zielen der Europäischen Atomgemeinschaft (EAG) heißt es in Art. 1 des EAG-Vertrages: „Aufgabe der Atomgemeinschaft ist es, durch die Schaffung der für die schnelle Bildung und Entwicklung der Kernindustrien erforderlichen Voraussetzungen zur Hebung der Lebenshaltung in den Mitgliedstaaten und zur Entwicklung der Beziehungen mit den anderen Ländern beizutragen.“ Die Europäische Wirtschaftsgemeinschaft (EWG) ging über den sektoriellen Ansatz der beiden anderen Gemeinschaften hinaus, indem sie die Mitgliedstaaten auf allen Wirtschaftsgebieten zu einer Gemeinschaft zusammenführen sollte.
[59] Als grundlegende Ziele dieser Einigung gelten bis heute:
• die harmonische Entwicklung des Wirtschaftslebens
• eine beständige und ausgewogene Wirtschaftsausweitung
• die Hebung des Lebensstandards
• das Bemühen um ein hohes Beschäftigungsniveau
• die Gewährleistung wirtschafts- und währungspolitischer Stabilität.
Im Mittelpunkt der wirtschaftlichen Einigung stehen dabei (1) die Errichtung eines Gemeinsamen Marktes/Binnenmarktes, (2) die schrittweise Annäherung der Wirtschaftspolitiken der Mitgliedstaaten und (3) die Errichtung einer Wirtschafts- und Währungsunion.
1. Die Errichtung eines Gemeinsamen Marktes/Binnenmarktes
[60] Was mit der Errichtung eines Gemeinsamen Marktes gemeint war, wird deutlich, wenn man die zur Herstellung des Gemeinsamen Marktes notwendigen Maßnahmen betrachtet:
• die Abschaffung der Zölle und mengenmäßigen Beschränkungen bei der Ein- und Ausfuhr von Waren sowie aller sonstigen Maßnahmen gleicher Wirkung zwischen den Mitgliedstaaten
• eine gemeinsame Handelspolitik gegenüber dritten Ländern
• die Beseitigung der Hindernisse für den freien Waren-, Personen-, Dienstleistungs- und Kapitalverkehr zwischen den Mitgliedstaaten
• die Errichtung eines Systems, das den Wettbewerb innerhalb des Gemeinsamen Marktes vor Verfälschungen schützt
• die Angleichung der innerstaatlichen Rechtsvorschriften, soweit dies für das Funktionieren des Gemeinsamen Marktes erforderlich ist.
[S. 73]
[61] Neben dem Begriff des Gemeinsamen Marktes ist durch die EEA der Begriff des Binnenmarktes eingefügt worden. Nach Art. 26 Abs. 2 AEUV umfasst der Binnenmarkt „... einen Raum ohne Binnengrenzen, in dem der freie Verkehr von Waren, Personen, Dienstleistungen und Kapital ... gewährleistet ist.“ Die Konzeption des Binnenmarktes54 orientiert sich inhaltlich an der des Gemeinsamen Marktes und soll die gleichen Ziele verwirklichen, bedeutet jedoch eine qualitative Verbesserung von Marktfreiheits- und Gleichheitsrechten55.
2. Die schrittweise Annäherung der Wirtschaftspolitik der Mitgliedstaaten und die Errichtung der Wirtschafts- und Währungsunion
[62] Nach Art. 119 AEUV umfasst die Tätigkeit der Mitgliedstaaten und der EU im Rahmen der wirtschaftlichen Einigung:
„(1) ... die Einführung einer Wirtschaftspolitik, die auf einer engen Koordinierung der Wirtschaftspolitik der Mitgliedstaaten, dem Binnenmarkt und der Festlegung gemeinsamer Ziele beruht und dem Grundsatz einer offenen Marktwirtschaft mit freiem Wettbewerb verpflichtet ist.
(2) Parallel dazu umfasst diese Tätigkeit ... eine einheitliche Währung, den Euro, sowie die Festlegung und Durchführung einer einheitlichen Geld- sowie Wechselkurspolitik, die beide vorrangig das Ziel der Preisstabilität verfolgen und unbeschadet dieses Zieles die allgemeine Wirtschaftspolitik in der Union unter Beachtung des Grundsatzes einer offenen Marktwirtschaft mit freiem Wettbewerb unterstützen sollen.
(3) Diese Tätigkeit der Mitgliedstaaten und der Union setzt die Einhaltung der folgenden richtungweisenden Grundsätze voraus: stabile Preise, gesunde öffentliche Finanzen und monetäre Rahmenbedingungen sowie eine dauerhaft finanzierbare Zahlungsbilanz.“
III. Die politische Einigung
[63] Die politische Einigung Europas sollte nach den Vorstellungen der Gründungsväter der früheren EWG zwangsläufig aus dem wirtschaftlichen Integrationsprozess hervorgehen. Die wirtschaftliche Einigung, auf die man sich zunächst in konkreter Form verständigt hatte, war zu keiner Zeit Selbstzweck, sondern lediglich ein Zwischenstadium auf dem Weg zur politischen Einigung. In der Präambel zum EGKS-Vertrag wird dies mit den Worten zum Ausdruck gebracht, durch „konkrete Leistungen“ sei zunächst eine „tatsächliche Verbundenheit“ zu schaffen, und die „Einrichtung einer wirtschaftlichen Gemeinschaft“ solle „den ersten Grundstein für eine weitere und vertiefte Gemeinschaft unter Völkern legen“. Die Präambel des EWG-Vertrages spricht den festen Willen aus, „die Grundlagen für einen immer engeren Zusammenschluß der europäischen Völker zu schaffen“.
[S. 74]
[64] Bereits zu Beginn der 60er Jahre zeigte sich jedoch im Scheitern der Fouchet-Pläne, dass auch ein erfolgreiches Wirken der Wirtschaftsgemeinschaft nicht automatisch in die Qualität einer unauflöslichen politischen Gemeinschaft umschlägt. Dies vor allem deshalb nicht, weil zwar über die Grundlagen der wirtschaftlichen Einigung ein mehr oder weniger breiter Konsens unter den Mitgliedstaaten bestand, eine gemeinsame „europäische Philosophie“ im Hinblick auf Struktur und Inhalt der künftigen politischen Gemeinschaft aber selbst unter den ursprünglichen sechs Mitgliedstaaten nicht vorhanden war. Die später vollzogenen Beitritte haben diese Situation noch verschärft. Die zunächst vorherrschenden Integrationsvorstellungen der europäischen Föderalisten, für die eine europäische politische Gemeinschaft nur in Form eines Europäischen Bundesstaates denkbar war, wurden vor allem durch den vom französischen Staatspräsidenten de Gaulle vorgetragenen Gedanken eines „Europa der Vaterländer“, das auf der Zusammenarbeit souveräner Nationalstaaten beruht, zurückgedrängt. Seine konkreten Vorstellungen über dieses „Europa der Vaterländer“ umriss de Gaulle am 5. September 1960 auf einer Pressekonferenz wie folgt:
„Die Schaffung Europas, das heißt seine Einigung, ist sicher eine wichtige Sache ... Warum sollte dieser große Herd der Zivilisation, der Stärke, der Vernunft und des Fortschrittes unter seiner eigenen Asche erlöschen? Allerdings darf man auf einem solchen Gebiet nicht Träumen nachhängen, sondern muss die Dinge so sehen, wie sie sind. Welches sind die Realitäten Europas und die Eckpfeiler, auf denen man weiterbauen könnte? In Wirklichkeit sind es die Staaten ... Es ist eine Schimäre, zu glauben, man könne etwas Wirksames schaffen und dass die Völker etwas billigen, was außerhalb oder über dem Staat stehen würde ... Gewiss trifft es zu, dass, bevor man das Europa-Problem in seiner Gesamtheit behandelt hat, gewisse mehr oder weniger supranationale Einrichtungen geschaffen werden konnten. Diese Einrichtungen haben ihren technischen Wert, aber sie haben und können keine Autorität und politische Wirksamkeit besitzen ... Frankreich hält die Gewährleistung der regelmäßigen Zusammenarbeit der europäischen Staaten für wünschenswert, möglich und praktisch auf dem Gebiet der Politik, der Wirtschaft, der Kultur und der Verteidigung ... Das erfordert ein organisiertes, regelmäßiges Einvernehmen der verantwortlichen Regierungen und die Tätigkeit von den Regierungen unterstellten Spezialorganisationen auf jedem der gemeinsamen Gebiete.“
[65] Erst nach dem Rücktritt de Gaulles konnten der politischen Einigung auf den Gipfelkonferenzen der Staats- und Regierungschefs in Den Haag Ende 1969 und den Pariser Konferenzen von 1972 und 1974 wieder neue Impulse gegeben werden. Der hier begonnene Neuanfang der politischen Einigung wurde sehr behutsam vorbereitet, da auch Frankreich unter Staatspräsident Pompidou grundsätzlich an der Idee des Europas der Vaterländer festhielt. Deshalb versuchte man auch nicht die ideologischen Fragen der europäischen Einigung zu lösen, sondern die Staats- und Regierungschefs beschränkten sich unter Bekräftigung ihres „Glaubens an die politischen Zielsetzungen, die der Gemeinschaft ihren ganzen Sinn und ihre Tragweite verleihen“[S. 75] auf die Proklamierung einer noch nicht näher definierten „Europäischen Union“ als Fernziel für die achtziger Jahre56.
[66] Diesen Gedanken von der „Europäischen Union“ nahm die Einheitliche Europäische Akte (EEA) von 1986/1987 auf, indem sie in ihrer Präambel den Willen der Staats- und Regierungschefs der damals bereits 12 Mitgliedstaaten bekundet, die Gesamtheit der Beziehungen zwischen den Mitgliedstaaten in eine Europäische Union umzuwandeln. Der Einstieg in diese Europäische Union ist schließlich mit dem am 1. November 1993 in Kraft getretenen „Vertrag über die Europäische Union“ vollzogen worden. Der frühere Unionsvertrag verstand sich als „eine neue Stufe bei der Verwirklichung einer immer engeren Union der Völker Europas [...], in der die Entscheidungen möglichst bürgernah getroffen werden“ (ex-Art. 1 UAbs. 2 EUV).
[67] Mit dem Vertrag von Lissabon ist der politische Bereich weiter gestärkt und ausgebaut worden. Konkrete politische Aufgaben sind der EU dabei im Zusammenhang mit der Unionsbürgerschaft, der Politik für justizielle Zusammenarbeit in Strafsachen sowie der Gemeinsamen Außen- und Sicherheitspolitik übertragen worden. Mit der Unionsbürgerschaft wurden die Rechte und Interessen der Staatsangehörigen der Mitgliedstaaten innerhalb der EU weiter gestärkt57. Im Bereich der Justiziellen Zusammenarbeit in Strafsachen geht es vor allem um die Wahrnehmung von Aufgaben durch die EU, die im gemeinsamen europäischen Interesse liegen. Dazu gehören insbesondere die Bekämpfung der organisierten Kriminalität und des Menschenhandels sowie die Strafverfolgung58. Im Rahmen der Gemeinsamen Außen- und Sicherheitspolitik kommen der EU insbesondere folgende Aufgaben zu: (1) Wahrung der gemeinsamen Werte, der grundlegenden Interessen und der Unabhängigkeit der EU, (2) Stärkung der Sicherheit der EU und ihrer Mitgliedstaaten, (3) Wahrung des Weltfriedens und Stärkung der internationalen Sicherheit, (4) Förderung der internationalen Zusammenarbeit, (5) Förderung von Demokratie und Rechtsstaatlichkeit sowie Wahrung der Menschenrechte und Grundfreiheiten, (6) Aufbau einer gemeinsamen Verteidigung.
IV. Die soziale Dimension
[68] Die europäische Einigung enthält schließlich auch eine soziale Komponente. Ziel der EU ist die Sicherung des sozialen Fortschritts und die Verbesserung der Lebens- und Arbeitsbedingungen sowie die Stärkung des sozialen Zusammenhalts. Die EU bekämpft soziale Ausgrenzung und Diskriminierung und fördert soziale Gerechtigkeit und sozialen Schutz, die Gleichstellung von Frauen und Männern, die Solidarität[S. 76] zwischen den Generationen und den Schutz der Rechte der Kinder (Art. 3 Abs. 3 EUV).
Die soziale Dimension ist im Laufe der Jahre immer weiter gestärkt worden. Setzte man ursprünglich auf das Wirken des Gemeinsamen Marktes, der gleichsam automatisch zu einer Angleichung der nationalen Sozialordnungen führen und damit letztendlich die soziale Identität der EU hervorbringen sollte, so wurden vor allem im Zuge der Verwirklichung des Binnenmarktes und der Schaffung der Europäischen Union die Befugnisse der EU im sozialpolitischen Bereich erheblich erweitert. Während bis dahin die Sozialpolitik weitgehend Sache der Mitgliedstaaten war, kann die EU nunmehr die sozialpolitischen Tätigkeiten in geteilter Zuständigkeit mit den Mitgliedstaaten wahrnehmen (Art. 4 AEUV)59.
B. Die Methode der europäischen Einigung
[69] Die europäische Einigung wird geprägt von zwei unterschiedlich angelegten Konzeptionen der Zusammenarbeit der europäischen Staaten. Sie lassen sich durch die Begriffe Kooperation und Integration kennzeichnen. Daneben hat sich als weitere Methode die Verstärkte Zusammenarbeit herausgebildet.
I. Kooperation der Staaten
[70] Das Wesen der Kooperation besteht darin, dass die Nationalstaaten zwar über ihre nationalen Grenzen hinweg zur Zusammenarbeit mit anderen Staaten bereit sind, dies jedoch nur unter prinzipieller Aufrechterhaltung ihrer nationalstaatlichen Souveränität. Das auf einer Kooperation beruhende Einigungsbemühen richtet sich dementsprechend nicht auf die Schaffung eines neuen Gesamtstaates, sondern beschränkt sich auf die Verbindung souveräner Staaten zu einem Staatenbund, in dem die nationalstaatlichen Strukturen erhalten bleiben (Konföderation). Dem Prinzip der Kooperation entspricht die Arbeitsweise im Rahmen des Europarats und der OECD.
II. Das Konzept der Integration
[71] Das Integrationskonzept durchbricht das traditionelle Nebeneinander von Nationalstaaten. Die überkommene Auffassung von der Unantastbarkeit und Unteilbarkeit der Souveränität der Staaten weicht der Überzeugung, dass die unvollkommene Ordnung des menschlichen und staatlichen Zusammenlebens, die eigene Unzulänglichkeit des nationalen Systems und die in der europäischen Geschichte zahlreichen Machtübergriffe eines Staates auf andere (sog. Hegemonie) nur überwunden werden können, wenn die einzelnen nationalen Souveränitäten zu einer gemeinsamen Souveränität zusammengelegt und auf höherer Ebene in einer übernationalen Gemeinschaft verschmolzen werden. Das Ergebnis dieser Operation ist die Existenz[S. 77] eines Europäischen (Bundes-)Staates, in dem unter Bewahrung der Eigenheiten der in ihm zusammengeschlossenen Nationen die Geschicke der Menschen von Gemeinschaftsgewalten gelenkt und ihre Zukunft gesichert wird (Föderation).
Die EU ist eine Schöpfung dieses Integrationskonzeptes, auch wenn es aufgrund des Beharrungsvermögens der Mitgliedstaaten hinsichtlich ihrer nationalen Souveränität einer Modifikation bedurfte. Die Mitgliedstaaten waren nämlich nicht bereit, die nach dem Zweiten Weltkrieg wiedererlangte und gerade verfestigte Struktur ihres Nationalstaates zugunsten eines Europäischen Bundesstaates preiszugeben. Es musste also abermals ein Kompromiss gefunden werden, der – ohne einen Europäischen Bundesstaat errichten zu müssen – mehr als eine bloße Kooperation der Staaten gewährleistete. Die Lösung bestand darin, den Mitgliedstaaten nicht die vollständige Preisgabe ihrer Souveränität abzuverlangen, sondern lediglich die Aufgabe des Dogmas von ihrer Unteilbarkeit. Es ging also zunächst nur darum, festzustellen, auf welchen Sachgebieten die Mitgliedstaaten bereit waren, auf einen Teil ihrer Souveränität zugunsten einer ihnen allen übergeordneten Gemeinschaft freiwillig zu verzichten. Das Ergebnis dieser Bemühungen spiegeln die drei Gründungsverträge der EGKS, der EWG und der EAG wider.
In ihnen und den heutigen Unionsverträgen sind diejenigen Gebiete im Einzelnen aufgeführt, auf denen der EU Hoheitsrechte übertragen worden sind. Dabei wird der EU und ihren Organen keine generelle Befugnis zum Erlass der zur Verwirklichung der Vertragsziele erforderlichen Maßnahmen erteilt, sondern Art und Umfang der Befugnisse zum Tätigwerden ergeben sich aus den jeweiligen Vertragsvorschriften (Prinzip der begrenzten Ermächtigung). Auf diese Weise bleibt der Verzicht auf eigene Befugnisse für die Mitgliedstaaten überschaubar und kontrollierbar.