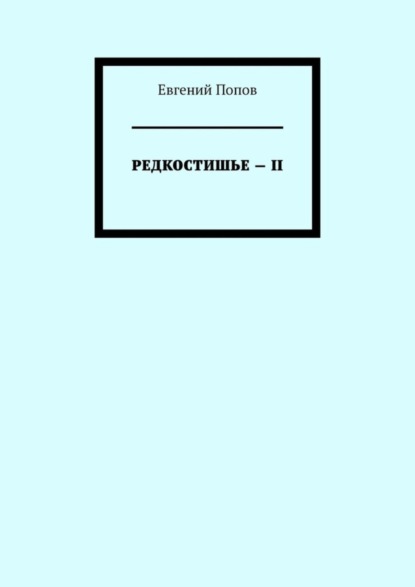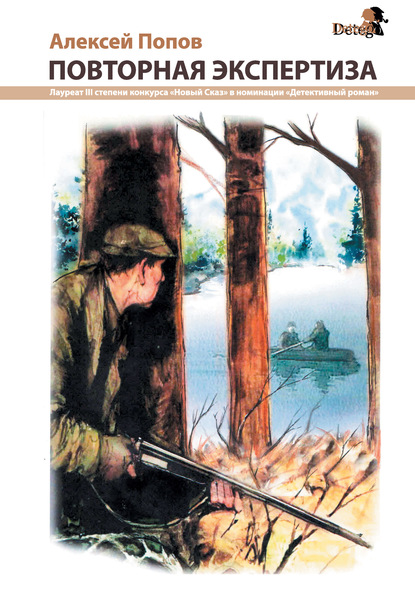Die rechtlichen Grundlagen der Europäischen Union
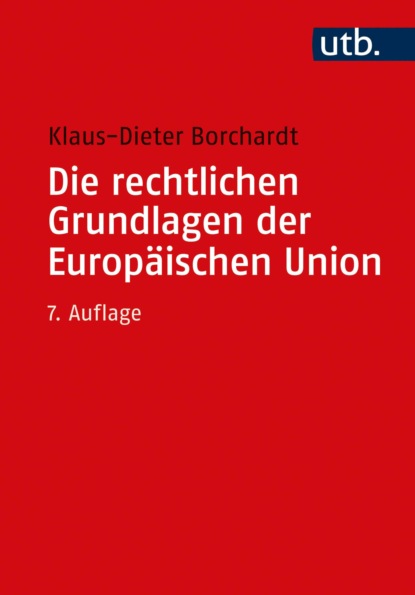
- -
- 100%
- +
III. Verstärkte Zusammenarbeit
[72] Mit dem Instrument der verstärkten Zusammenarbeit wird die Grundlage für die Umsetzung der Idee von der Integration mit verschiedenen Geschwindigkeiten geschaffen. Es soll auch kleineren Kreisen von Mitgliedstaaten die Möglichkeit gegeben werden, auf einem bestimmten Gebiet, das in die Zuständigkeit der EU fällt, in der Integration fortzuschreiten, ohne dabei durch die zögernden oder ablehnenden Mitgliedstaaten gehindert zu werden.
[73] Nachdem die Bedingungen und Verfahren für die Nutzung dieses Instruments ursprünglich (Vertrag von Amsterdam) noch sehr streng gehalten waren, wurden sie im Hinblick auf die Erweiterung der EU auf damals 27 Mitgliedstaaten etwas offener gestaltet (Vertrag von Nizza). Der Vertrag von Lissabon bündelt die bisherigen Vorschriften zur Verstärkten Zusammenarbeit in Art. 20 EUV (Rahmenbedingungen) und in den Art. 326–334 AEUV (ergänzende Bedingungen, Beitritt, Verfahren, Abstimmungsregeln).
[S. 78]
[74] Die Regelungen für eine verstärkte Zusammenarbeit können wie folgt zusammengefasst werden:
• Eine derartige Zusammenarbeit kann nur im Rahmen der bestehenden Kompetenzen der EU genutzt werden und muss der Verwirklichung der Ziele der EU dienen und den europäischen Integrationsprozess fördern (Art. 20 EUV). Sie ist deswegen nicht geeignet, die in der EU-Vertragsarchitektur angelegten Defizite der Wirtschafts- und Währungsunion abzubauen. Die verstärkte Zusammenarbeit darf den Binnenmarkt und den wirtschaftlichen und sozialen Zusammenhalt der EU nicht beeinträchtigen. Zudem darf sie zu keiner Behinderung, zu keiner Diskriminierung im Handel zwischen den Mitgliedstaaten sowie zu keiner Verzerrung des Wettbewerbs führen (Art. 326 AEUV). Die Zuständigkeiten, Rechte, Pflichten und Interessen der nicht an der Zusammenarbeit beteiligten Mitgliedstaaten müssen beachtet werden (Art. 327 AEUV).
• Die verstärkte Zusammenarbeit muss allen Mitgliedstaaten offenstehen. Außerdem muss es den Mitgliedstaaten gestattet sein, sich jederzeit der Zusammenarbeit anzuschließen, vorausgesetzt, die betroffenen Mitgliedstaaten kommen den im Rahmen der verstärkten Zusammenarbeit gefassten Beschlüssen nach. Die Kommission und die Mitgliedstaaten tragen dafür Sorge, dass sich eine möglichst große Zahl von Mitgliedstaaten an der verstärkten Zusammenarbeit beteiligt (Art. 328 AEUV).
• Eine verstärkte Zusammenarbeit kann nur als letztes Mittel in Anspruch genommen werden, wenn der Rat zu dem Schluss gelangt ist, dass die mit dieser verstärkten Zusammenarbeit angestrebten Ziele unter Anwendung der einschlägigen Bestimmungen der Verträge nicht in einem vertretbaren Zeitraum verwirklicht werden können. Die Mindestschwelle für eine verstärkte Zusammenarbeit beträgt neun Mitgliedstaaten (Art. 20 Abs. 2 EUV).
• Die im Rahmen einer verstärkten Zusammenarbeit angenommenen Rechtsakte sind nicht Teil des Besitzstandes der EU. Diese Rechtsakte haben nur in den Mitgliedstaaten, die sich an der Beschlussfassung beteiligen, unmittelbare Geltung (Art. 20 Abs. 4 EUV). Die Mitgliedstaaten, die sich nicht daran beteiligen, stehen deren Durchführung allerdings nicht im Wege.
• Die sich aus einer verstärkten Zusammenarbeit ergebenden Ausgaben werden mit Ausnahme der Verwaltungskosten von den beteiligten Mitgliedstaaten finanziert, sofern der Rat nicht nach Anhörung des Europäischen Parlaments durch einstimmigen Beschluss etwas anderes beschließt (Art. 332 AEUV).
• Rat und Kommission müssen sicherstellen, dass die im Rahmen einer verstärkten Zusammenarbeit durchgeführten Maßnahmen mit dem sonstigen politischen Handeln der EU im Einklang stehen (Art. 334 AEUV).
[75] Für die Einhaltung des Verfahrens für eine verstärkte Zusammenarbeit gelten mit Ausnahme der Gemeinsamen Außen- und Sicherheitspolitik folgende allgemeine Regeln (Art. 329 Abs. 1 AEUV): Die Mitgliedstaaten, die in diesen Bereichen eine verstärkte Zusammenarbeit zu begründen beabsichtigen, richten einen Antrag an[S. 79] die Kommission, die dem Rat einen entsprechenden Vorschlag vorlegen kann. Auf Vorschlag der Kommission erteilt der Rat die Ermächtigung mit qualifizierter Mehrheit nach Zustimmung des Europäischen Parlaments. Über einen Antrag eines Mitgliedstaats, sich einer verstärkten Zusammenarbeit anzuschließen, entscheidet die Kommission.
In der Praxis ist auf dieses Instrument bisher in drei Fällen zurückgegriffen worden: Erstmals in der Geschichte der EU bedienten sich 14 Mitgliedstaaten Mitgliedstaaten (Belgien, Bulgarien, Deutschland, Frankreich, Italien, Lettland, Luxemburg, Malta, Österreich, Portugal, Rumänien, Slowenien, Spanien und Ungarn) des Verfahrens der verstärkten Zusammenarbeit, um eine Regelung zu treffen, die Ehepaaren unterschiedlicher Staatsangehörigkeit bei einer Scheidung die Wahl des anwendbaren Rechts überlässt. Das Ergebnis ist in der Verordnung (EU) Nr. 1259/2010 des Rates vom 20. Dezember 2010 über die Umsetzung der verstärkten Zusammenarbeit im Bereich des bei Scheidung und Trennung anwendbaren Rechts niedergelegt60. Ein zweiter Anwendungsfall betrifft die Schaffung eines einheitlichen Patentschutzes in Europa, der es Unternehmen oder Privatpersonen ermöglichen, ihre Erfindungen in 25 Mitgliedstaaten mit einem einzigen Europäischen Patent schützen zu lassen (nur Spanien und Kroatien unterstützen diese Initiative nicht)61 Für die Durchführung der verstärkten Zusammenarbeit hat die Kommission zwei Verordnungsvorschläge vorgelegt62, die Bestimmungen zu den Voraussetzungen für den Erhalt eines einheitlichen Patentschutzes, zu seiner Rechtswirkung und zu den anzuwendenden Übersetzungsregelungen enthalten. Ergänzt werden diese Vorschläge durch ein Abkommen über die Errichtung eines europäischen Patentgerichts. Sobald das Abkommen von mindestens 13 Mitgliedstaaten ratifiziert worden ist, können diese Regelungen in Kraft treten. Ein dritter Anwendungsfall betrifft die Einführung einer Finanztransaktionssteuer, die von insgesamt 11 Mitgliedstaaten (Belgien, Deutschland, Estland, Griechenland, Spanien, Frankreich, Italien, Österreich, Portugal, Slowenien und Slowakei) unterstützt wird63.
[76] Im Bereich der Gemeinsamen Außen- und Sicherheitspolitik (GASP) gelten spezifische Anwendungsregeln (Art. 329 Abs. 2 AEUV). Eine verstärkte Zusammenarbeit im Bereich der GASP hat zum Ziel, die Werte der EU zu wahren und ihren[S. 80] Interessen zu dienen, insbesondere unter Achtung der Grundsätze, der Ziele, der allgemeinen Leitlinien und der Kohärenz der GASP sowie der Zuständigkeiten der EU und der Kohärenz zwischen der Unionspolitik insgesamt und dem außenpolitischen Handeln der EU. Die Mitgliedstaaten, die eine verstärkte Zusammenarbeit zu begründen beabsichtigen, richten einen Antrag an den Rat. Dieser Antrag wird dem Hohen Vertreter der EU für die GASP, der insbesondere zur Kohärenz der beabsichtigten verstärkten Zusammenarbeit mit der GASP Stellung nimmt, sowie der Kommission, die insbesondere zur Kohärenz der beabsichtigten verstärkten Zusammenarbeit mit der EU-Politik Stellung nimmt, übermittelt. Der Antrag wird ferner dem Europäischen Parlament zur Unterrichtung übermittelt. Die Ermächtigung zur Einleitung der verstärkten Zusammenarbeit erfolgt durch den Rat, der einstimmig entscheidet. Dabei können alle Mitglieder des Rates an den Beratungen teilnehmen, aber nur die Mitglieder des Rates, die an der verstärkten Zusammenarbeit teilnehmen, sind stimmberechtigt. Einstimmigkeit bezieht sich deshalb auch nur auf die Stimmen der Vertreter dieser Mitgliedstaaten (Art. 330 AEUV).
C. Die Akteure der europäischen Einigung
I. Die Rolle der Mitgliedstaaten
[77] Die Mitgliedstaaten sind nach wie vor die Verfassungsgeber. Sie sind die „Herren der Verträge“64. Sie bestimmen bis zur Übertragung auch der verfassungsgebenden Gewalt auf die Union über die Grundlagen und Wesenszüge sowie über Fortschritte und Veränderungen der europäischen Einigung. Dies geschieht in Form des Abschlusses völkerrechtlicher Verträge. Ausdruck dieser verfassungsgebenden Gewalt sind neben den Gründungsverträgen der Europäischen Gemeinschaften (EGKS, EWG, EAG) etwa auch die Einheitliche Europäische Akte und die Verträge über die Europäische Union (Verträge von Maastricht, Amsterdam, Nizza und zuletzt Lissabon).
[78] Auch die der EU übertragenen Kompetenzen sind nicht genereller Natur, sondern beziehen sich auf mehr oder weniger klar umrissene Regelungsbereiche, die den Organen der EU zur Wahrnehmung überantwortet wurden. Dies geschieht im Wesentlichen im Wege der Gesetzgebung. Der Vollzug dieser Gesetze liegt hingegen weitgehend in den Händen der Verwaltungen und Gerichte der Mitgliedstaaten. Damit hängt zugleich die Lebensfähigkeit der EU entscheidend von den Mitgliedstaaten ab. In Kenntnis dieser Abhängigkeit haben sich die Mitgliedstaaten deshalb selbst gewisse rechtliche Bindungen auferlegt. In erster Linie ist hier der Grundsatz der Unionstreue zu nennen. Danach treffen die Mitgliedstaaten alle geeigneten Maßnahmen, um ihre unionsrechtlichen Verpflichtungen zu erfüllen. Sie unterstützen die Organe der EU bei der Erfüllung ihrer Aufgaben und unterlassen alle Maßnahmen, die die Verwirklichung der Ziele der EU gefährden könnten (Art. 4 Abs. 3 EUV).
[S. 81]
II. Die Rolle des Europäischen Rates
[79] Die Aufgabe des Europäischen Rates besteht vor allem darin, die für die weitere Entwicklung erforderlichen Impulse zu geben und die allgemeinen politischen Zielvorstellungen und Prioritäten hierfür festzulegen (Art. 15 Abs. 1 EUV). Dies geschieht durch den Erlass politischer Grundsatzentscheidungen oder die Formulierung von Richtlinien und Aufträgen für die Arbeit des Rates der EU und der Kommission. Derartige Anstöße sind vom Europäischen Rat etwa für die Wirtschafts- und Währungsunion, die Direktwahlen des Europäischen Parlaments sowie für sozialpolitische Aktivitäten und Beitrittsfragen ausgegangen. Der Präsident des Europäischen Rates nimmt die Außenvertretung der EU in Angelegenheiten der Gemeinsamen Außen- und Sicherheitspolitik wahr.
III. Die Rolle der anderen Unionsorgane
[80] Den anderen EU-Organen kommt vor allem die Aufgabe zu, den durch die Mitgliedstaaten vorgegebenen Integrationsrahmen durch unionseigene Rechtsetzung auszufüllen. Die Hauptakteure im Rechtsetzungsverfahren sind das Europäische Parlament, der Rat der EU, die Europäische Kommission sowie zwei beratende Ausschüsse in Gestalt des Wirtschafts- und Sozialausschusses und des Ausschusses der Regionen65. Nur in Ausnahmefällen, wie etwa im Bereich des Wettbewerbsrechts, treten die EU-Organe, allen voran die Europäische Kommission, auch als Vollzugsorgane auf. Die Wahrung des Rechts durch diese Organe bei der Erfüllung ihrer Aufgaben sichert der Gerichtshof der EU. Über die Rechtmäßigkeit und Ordnungsgemäßheit der Einnahmen und Ausgaben der EU sowie über die Wirtschaftlichkeit der Haushaltsführung wacht der Rechnungshof. Die einheitliche Währung, der Euro, liegt in den Händen der Europäischen Zentralbank.
Weiterführende Literatur: Behrens, Integrationstheorie, RabelsZ 1981, S. 8; von Bogdandy (Hrsg.), Die Europäische Option, 1993; Everling, Reflections on the Structure of the European Union, CMLRev. 1992, S. 1053 ff.; ders., Vom Zweckverband zur Europäischen Union – Überlegungen zur Struktur der Europäischen Gemeinschaft, FS für Ipsen, 1988, S. 596; Fischer/Kommer, Verstärkte Zusammenarbeit der EU. Ein Modell für Kooperationsfortschritte in der Wirtschafts- und Sozialpolitik?, Friedrich Ebert Stiftung, 2011; von der Groeben, Ziele und Methoden der Europäischen Integration, 1972; Hallstein, Die Europäische Gemeinschaft, 5. Aufl. 1979; Merten (Hrsg.), Föderalismus und Europäische Gemeinschaften, Berlin 1990; Oppermann, Die Europäische Gemeinschaft als parastaatliche Superstruktur – Skizze einer Realitätsbeschreibung, FS für Ipsen, 1988, S. 685–699; Zuleeg, Die Europäische Gemeinschaft als Integrationsverband, FS für Carstens, 1984, S. 289.
[S. 82]
§ 3 Die Rechtsquellen des Unionsrechts
[81] Der Begriff „Rechtsquelle“ hat eine zweifache Bedeutung. In seiner ursprünglichen Wortbedeutung umschreibt er den Entstehungsgrund des Rechts, d.h. die Motivation zur Schaffung des Rechts. In diesem Sinne wäre Rechtsquelle des Unionsrechts die internationale Solidarität und der Wille, ein einiges Europa im Wege wirtschaftlicher Verflechtung zu schaffen. Im juristischen Sprachgebrauch wird unter dem Begriff „Rechtsquelle“ dagegen die Herkunft und Verankerung des Rechts verstanden. In diesem Sinne bilden die Rechtsquellen in ihrer Gesamtheit die Unionsrechtsordnung. Sie können unterschieden werden nach geschriebenen Rechtsquellen, ungeschriebenen Rechtsquellen und Absprachen zwischen den Mitgliedstaaten.
A. Geschriebene Rechtsquellen
I. Das primäre Unionsrecht
[82] Als primäres Unionsrecht wird das unmittelbar von den Mitgliedstaaten geschaffene Recht bezeichnet. Es enthält die grundlegenden Rechtssätze über die Zielsetzungen, die Organisation und die Funktionsweise der EU sowie Teile des Wirtschaftsrechts. Das primäre Unionsrecht gibt damit die verfassungsrechtlichen Rahmenbedingungen der EU vor, die von den dazu eigens mit legislativen und administrativen Befugnissen ausgestatteten Unionsorganen im Unionsinteresse auszufüllen sind.
Zum primären Unionsrecht gehören die Unionsverträge (dazu unter 1.), die an diesen Verträgen vorgenommenen Änderungen und Ergänzungen (dazu unter 2.) sowie die Beitrittsverträge (dazu unter 3.).
1. Die Unionsverträge
[83] Als geschriebene Quellen des Unionsrechts sind zunächst die beiden jüngsten Unionsverträge (einschließlich der den Verträgen beigefügten Anhänge, Anlagen und Protokolle) zu nennen, die durch den am 1. Dezember 2009 in Kraft getretenen Vertrag von Lissabon neu gestaltet bzw. neu geschaffen wurden:
• Der Vertrag über die Europäische Union („EUV“), der aus dem Vertrag zur Gründung der EU (Vertrag von Maastricht) hervorgegangen ist.
• Der Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union („AEUV“), der aus dem Vertrag über die Errichtung der Europäischen Gemeinschaft hervorgegangen ist.
• Der EU-Vertrag und der AEU-Vertrag haben den gleichen rechtlichen Stellenwert. Diese ausdrückliche rechtliche Klarstellung ist nötig, da der neue Titel des früheren EG-Vertrags („Vertrag über die Arbeitsweise der EU“) und die Art der Regelungsdichte in beiden Verträgen den falschen Eindruck erwecken können, dass es sich beim EU-Vertrag um eine Art Grundgesetz oder Grundlagenvertrag handelt,[S. 83] während der AEU-Vertrag eher als Durchführungsvertrag konzipiert erscheint. EU-Vertrag und AEU-Vertrag haben keinen formellen Verfassungscharakter.
• Daneben besteht weiterhin der Vertrag zur Gründung der Europäischen Atomgemeinschaften („EAGV“ – EURATOM) vom 25. März 1957 – „Römischer Vertrag“.
Den Unionsverträgen gleichgestellt ist die Charta der Grundrechte der Europäischen Union (vgl. Art. 6Abs. 1 EUV).
2. Änderungs- und Ergänzungsverträge
[84] Die Gründungsverträge von EGKS, EWG und EAG sahen bereits Bestimmungen zur Fortbildung und Änderung des primären Gemeinschaftsrechts vor. Im EU-Vertrag sind die Regeln über die Fortbildung und Änderung des primären Unionsrechts nunmehr einheitlich in Art. 48 EUV niedergelegt. Von der Möglichkeit der Änderung und Ergänzung der Verträge ist bereits häufig Gebrauch gemacht worden. Erwähnung verdienen vor allem das Abkommen über die Einsetzung Gemeinsamer Organe für die Europäischen Gemeinschaften vom 25. März 1957 (l. Fusionsvertrag), das Abkommen zur Einsetzung eines gemeinsamen Rates und einer gemeinsamen Kommission der Europäischen Gemeinschaften vom 8. April 1965 (2. Fusionsvertrag) einschließlich des Protokolls über die Vorrechte und Befreiungen der EG sowie die Verträge zur Änderung bestimmter Haushalts- und Finanzvorschriften der Gründungsverträge vom 22. April 1970 bzw. vom 22. Juli 1975, die Einheitliche Europäische Akte (EEA) vom Februar 1986 (am 1. Juli 1987 in Kraft getreten), der Vertrag über die Europäische Union vom 7. Februar 1992 („Maastricht-Vertrag“ – am 1. November 1993 in Kraft getreten) mit seinen Änderungsverträgen von Amsterdam (am 1. Mai 1999 in Kraft getreten) und von Nizza (am 1. Februar 2003 in Kraft getreten) sowie zuletzt die Verträge über die EU und die Arbeitsweise der EU („Lissabon-Vertrag“ – am 1. Dezember 2009 in Kraft getreten).
3. Beitrittsverträge
[85] Zum primären Unionsrecht gehören schließlich auch die im Zuge der Erweiterung der EG/EU geschlossenen Beitrittsverträge von 1972 (l. Erweiterung 1973: Dänemark, Irland und Vereinigtes Königreich)66, von 1979 (2. Erweiterung 1981: Griechenland)67, von 1985 (3. Erweiterung 1986: Spanien und Portugal)68, von 1994 (4. Erweiterung 1995: Österreich, Finnland und Schweden)69, von 2004 (5. Erweiterung: Estland, Lettland, Litauen, Malta, Polen, Slowakische Republik, Slowenien, Tschechische Republik, Ungarn, Zypern), von 2007 (6. Erweiterung: Rumänien und Bulgarien) und von 2013 (7. Erweiterung: Kroatien), einschließlich der Akte über[S. 84] die Beitrittsbedingungen und die Anpassungen der Verträge, soweit sie Vorschriften des primären Unionsrechts betreffen.
II. Das sekundäre Unionsrecht
[86] Das sekundäre Unionsrecht umfasst das von den Organen der EU aufgrund der Verträge geschaffene Recht. Es besteht aus Rechtsakten mit Gesetzescharakter, Rechtsakten ohne Gesetzescharakter (einfache Rechtsakte, delegierte Rechtsakte, Durchführungsrechtsakte), unverbindlichen Rechtsakten (Empfehlungen und Stellungnahmen) sowie sonstigen Rechtshandlungen, die keine Rechtsakte sind70.
Die Schaffung des sekundären Unionsrechts erfolgt allmählich und fortschreitend. Durch seinen Erlass wird das primäre Unionsrecht, das durch die Unionsverträge gebildet wird, mit Leben erfüllt und die europäische Rechtsordnung im Laufe der Zeit verwirklicht und vervollständigt.
III. Völkerrechtliche Abkommen der EU
[87] Diese dritte Rechtsquelle hängt mit der Rolle der EU auf internationaler Ebene zusammen. Als einer der Anziehungspunkte in der Welt kann Europa sich nicht darauf beschränken, nur seine eigenen inneren Angelegenheiten in die Hand zu nehmen, sondern muss sich vor allem auch um seine wirtschaftlichen, sozialen und politischen Beziehungen zu anderen Ländern in der Welt bemühen. Zu diesem Zweck schließt die EU mit den „Nichtmitgliedstaaten“ der EU (sog. Drittländern) und anderen Internationalen Organisationen völkerrechtliche Abkommen, die von Verträgen über eine umfassende Kooperation auf handelspolitischem, industriellem, sozialpolitischem oder technischem Gebiet bis zu Abkommen über den Handel mit einzelnen Produkten reichen (Art. 207, 217, 218 AEUV).
Drei Formen vertraglicher Beziehungen zu den Drittstaaten sind hervorzuheben:
1. Assoziierungsabkommen (Art. 217 AEUV)
[88] Die Assoziierung geht über die Regelung rein handelspolitischer Fragen weit hinaus und ist auf eine enge wirtschaftliche Kooperation mit weitreichender finanzieller Unterstützung des Vertragspartners durch die EU ausgerichtet71. Zu unterscheiden sind drei Formen von Assoziierungsabkommen:
[S. 85]
a) Abkommen zur Aufrechterhaltung der besonderen Bindungen einiger Mitgliedstaaten der EU zu Drittländern (Art. 198 AEUV)
[89] Anlass für die Schaffung des Instruments der Assoziierung waren insbesondere die außereuropäischen Länder und Gebiete, die mit Belgien, Dänemark, Frankreich, Italien, den Niederlanden und dem Vereinigten Königreich als deren ehemalige Kolonien besonders enge Wirtschaftsbeziehungen unterhielten. Da die Einführung eines gemeinsamen Außenzolls in der EU den Handelsaustausch mit diesen Gebieten erheblich gestört hätte, waren Sonderregelungen notwendig. Ziel der Assoziierung dieser Länder und Hoheitsgebiete ist deshalb die Förderung ihrer wirtschaftlichen und sozialen Entwicklung und die Herstellung enger Wirtschaftsbeziehungen zwischen ihnen und der gesamten Union (Art. 198 AEUV). So besteht eine ganze Reihe von Präferenzregelungen, die die Einfuhren von Waren aus diesen Ländern und Hoheitsgebieten zu einem ermäßigten oder Null-Zollsatz ermöglichen. Die finanzielle und technische Hilfe der EU wird über den Europäischen Entwicklungsfonds abgewickelt.
[90] Das in der Praxis mit Abstand wichtigste Übereinkommen ist das EU-AKP-Partnerschaftsabkommen, das die EU mit 77 Staaten Afrikas, der Karibik und des Pazifiks verbindet. Es wurde am 23. Juni 2000 in Cotonou (Benin) unterzeichnet72 und gilt bis 2020. Dieses Abkommen wird zurzeit in Wirtschaftliche Partnerschaftsabkommen (Economic Partnership Agreements) zwischen jeweils einer der sieben regionalen AKP-Ländergruppen (Westafrika, Zentralafrika, Ostafrika, Südostafrika, Südliches Afrika, Karibik, Pazifik) und der EU überführt. Dieser Prozess ist inzwischen für die pazifischen und karibischen Länder, das südliche Afrika und Ostafrika erfolgreich abgeschlossen worden, hingegen noch nicht für Südostafrika, Westafrika und Zentralafrika.73 Ziel dieser Abkommen ist die Schaffung einer Freihandelszone, die den AKP-Staaten schrittweise den freien Zugang zum europäischen Binnenmarkt gewährt, die regionale Integration fördert sowie Handel für Wachstum und nachhaltige Entwicklung nutzt74.
[91] Darüber hinaus hat die EU im Rahmen der Östlichen Partnerschaft Assoziierungsabkommen mit der Ukraine (Inkrafttreten 1.9.2017), der Republik Moldawien (Inkrafttreten 1.7.2016) und Georgien (Inkrafttreten 1.6.2016) abgeschlossen.
[S. 86]
b) Abkommen zur Vorbereitung eines möglichen Beitritts (Art. 217 AEUV)
[92] Daneben wird die Assoziierung auch zur Vorbereitung eines möglichen Beitritts eines Landes zur EU eingesetzt75. Sie ist gleichsam eine Vorstufe des Beitritts, auf der eine Annäherung der wirtschaftlichen Bedingungen eines Beitrittskandidaten an die EU angestrebt wird.76
c) Abkommen über den Europäischen Wirtschaftsraum „EWR“
[93] Das Abkommen über den EWR erschließt den (Rest-)EFTA-Staaten (Norwegen, Island und Liechtenstein) den EU-Binnenmarkt und stellt durch die Übernahmeverpflichtung von beinahe zwei Dritteln des Unionsrechts eine sichere Grundlage für einen möglichen späteren Beitritt dieser Länder zur EU dar77.
2. Kooperationsabkommen (Art. 218 AEUV)