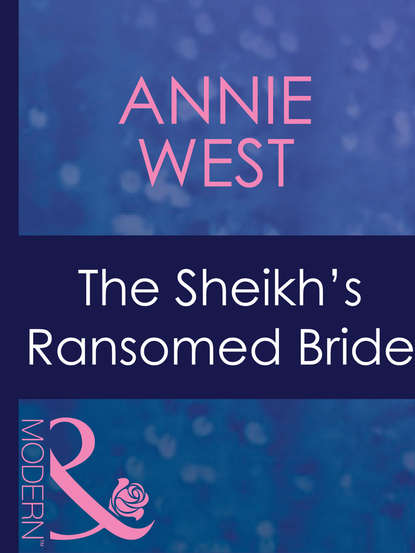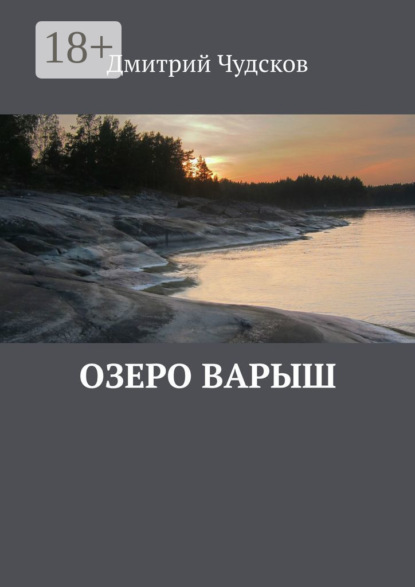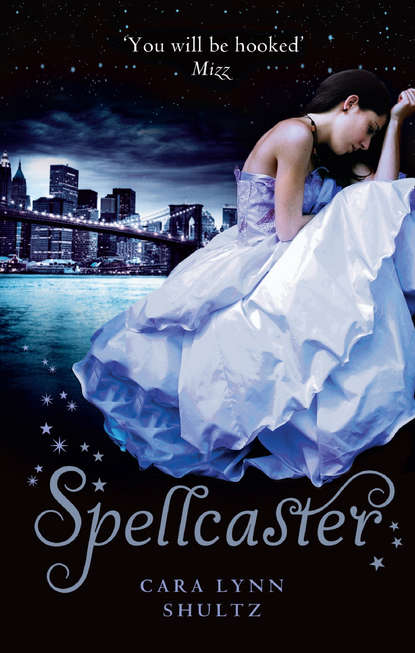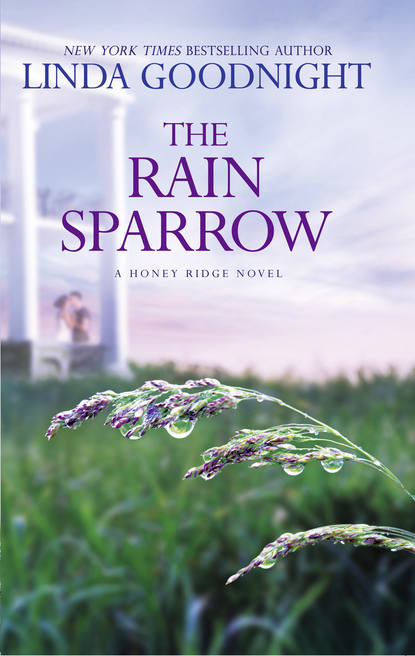Das Geheimnis vom Oranienburger Thor
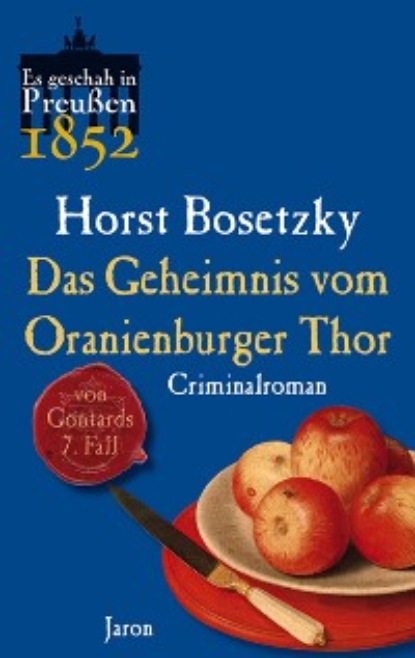
- -
- 100%
- +
So geschah es, und Paul Quappe konnte nach einiger Zeit berichten, dass er bei der Rückkehr vom Schneider einen Einbrecher überrascht habe und von diesem mit einer Keule niedergeschlagen worden sei.
Charles Corduans Vorfahren gehörten zu den zwanzigtausend Hugenotten, die nach dem Edikt von Potsdam, das der Große Kurfürst Friedrich Wilhelm von Brandenburg am 29. Oktober 1685 erlassen hatte, nach Brandenburg-Preußen gekommen waren. Sie hatten einige Schwierigkeiten gehabt, in Berlin Fuß zu fassen, denn Hof, Adel und die geistige Elite hatten die Hugenotten zwar freudig begrüßt, galt doch das Französische als Maß der Hochkultur, die einfachen Berliner aber hatten sie abgelehnt. Sie verstanden die Sprache der Hugenotten nicht, und die Franzosen waren ihnen zu wesensfremd. Die Nachkommen der Einwanderer wurden jedoch inzwischen akzeptiert, und in vielen Berufen waren die französischstämmigen Berliner sehr erfolgreich, insbesondere im Textilgewerbe sowie bei den Confituries, Pâtissiers und Cafetiers.
Corduan war Kürschner und hatte sein Geschäft in der Jägerstraße, unweit der Friedrichstraße. Seine Frau war vor Jahren gestorben. Nun besorgte ihm eine Magd, Susanna, den Haushalt. Außerdem war seine Nichte Caroline zur Stelle, wenn dringend etwas erledigt werden musste. Zwei Gesellen halfen ihm bei der Arbeit.
Der eine war gerade dabei, Galonleder mit dem Kürschnermesser zuzuschneiden, der andere hatte den Grotzenstecher in die Hand genommen, um die Fellmitte, den Grotzen, anzuzeichnen, als Oberst-Lieutenant Christian Philipp von Gontard in den Laden trat. Charles Corduan selbst war so darin vertieft, ein Fell auf eine hölzerne Unterlage zu nageln, dass er ihn gar nicht bemerkte.
»Bonsoir, Maître, ne vous laissez pas interférer avec le travail!«, sagte Gontard, um auf sich aufmerksam zu machen.
Der Kürschnermeister konnte das Gesagte zwar verstehen, sprach aber selbst kaum noch Französisch, so dass er Gontard auf Deutsch antwortete. »Von Ihnen lasse ich mich gern bei der Arbeit stören, denn Sie sind bestimmt gekommen, um sich einen neuen Pelz zu kaufen.«
»Es hat sich wohl schon herumgesprochen, dass bei mir eingebrochen wurde und man mir einiges gestohlen hat, darunter auch meinen Pelzmantel.« Gontard lachte. »Dann waren Sie das also, damit Ihr Umsatz ordentlich in die Höhe schnellt.«
»Sie haben mich ertappt! Aber das eigentlich Empörende ist, dass ich Ihnen jetzt Ihren Pelz als angeblich nagelneues Stück zum zweiten Mal verkaufe.«
Gontard wurde ernst. »Was können Sie mir empfehlen?«, fragte er.
»Grundsätzlich würde ich zu einem Tier raten, das vollständig oder zumindest zeitweilig im Wasser lebt, weil dann das Fell besonders üppig und strapazierfähig ist. Ferner gilt, dass der Pelz umso dichter und seidiger wird, je kälter der Lebensraum des Tieres ist. Mit Winterfellen liegen sie immer richtig.«
Gontard lachte. »Mit einem Eisbärenfell durch Berlin zu laufen, fände ich für meine Reputation nicht eben förderlich.«
»Dann dürften auch Maulwurf, Nasenbär oder Waschbär für Sie nicht in Frage kommen.«
»So ist es.«
Charles Corduan zeigte auf einige fertige Exemplare. »Hier haben wir einen Mantel aus russischem Desmanfell.«
»Was ist ein Desman?«, wollte Gontard wissen.
»Ein Tier, so groß wie ein Hamster.«
»Nein danke.«
»Aber dies wäre etwas für Sie, Herr von Gontard: ein Stück, fein und seidig, genäht aus Fellen von Edelmardern. Bewundern Sie mit mir dieses glänzende Braun mit seinen Übergängen zu Nuss und Kastanie!«
Wieder winkte Gontard ab. »Das wäre eher etwas für meine Frau.«
Charles Corduan war ein geschickter Verkäufer und wusste sich zu steigern. »Wie wäre es mit dem herrlichen Fell eines Kodiakbären?«
»Wunderbar!« Gontard war begeistert. »Das wird mein neuer Pelzmantel. Fangen Sie bitte sofort damit an! Ich lasse ihn mir auch einiges kosten.«
Corduan verbeugte sich. »Sehr gern.«
Ernst Curtius hatte sich als Hauslehrer des Prinzen Friedrich Wilhelm, des späteren Kaisers Friedrich III., und als außerordentlicher Professor an der Friedrich-Wilhelms-Universität einen Namen gemacht. Am 10. Januar 1852, einem Sonnabend, wollte er in der Sing-Akademie einen Vortrag über das antike Olympia halten. Gontard und Kußmaul saßen in der Dorotheenstraße beisammen und überlegten, ob sie sich den Beitrag anhören sollten.
»Eigentlich hatte ich Henriette versprochen, mit ihr Schach zu spielen«, sagte Gontard.
»Und ich wollte mit meiner Frau ins Konzert gehen«, fügte Kußmaul hinzu. »Aber Olympia ist ein wichtiges Thema. Stell dir vor, wir bekommen die Olympischen Spiele der Antike zurück und unsere Jugend übt fleißig, um den Lorbeerkranz des Siegers zu erringen. Du weißt, was das für Preußen bedeuten könnte?«
»Ja, wir würden an die Ideen unseres Turnvaters Friedrich Ludwig Jahn anknüpfen, und die Menschen würden fleißig ihren Leib trainieren.«
»Genau. Ich hätte weniger Kranke in der Praxis, und du verfügtest über Soldaten, die in zukünftigen Kriegen – und es sind etliche zu erwarten – mit mehr Ausdauer kämpfen könnten.«
»Was schließen wir daraus? Es sei mit der Diskussion nun Schluss, / auf zu Herrn Curtius! So würde dessen Freund Emanuel Geibel bestimmt reimen.«
»Gut. Auch der König soll zugegen sein.«
Die Sing-Akademie hatte seit 1827 ein eigenes Konzertgebäude am Festungsgraben, so dass sie es von der Dorotheenstraße aus nicht weit hatten. Als Gontard und Kußmaul ins Foyer traten, kam ihnen der Theaterdichter Ernst Raupach mit seiner Frau entgegen. Gontard erschrak, denn der Schöpfer des Hohenstaufen-Zyklus sah ziemlich elend aus und hustete so sehr, dass die Umstehenden zurückwichen.
»Die Lunge«, erklärte Raupach, als sie sich begrüßt hatten.
»Wenn er doch nur meinem Rat folgen und sich schonen würde!«, seufzte seine Frau. »Tag und Nacht sitzt er an seinem neuen Stück. Es heißt Die Giftmischerin.«
Gontard ging durch den Kopf, dass er selbst auch gerne ein Stück schreiben würde, eines über den Polizeipräsidenten von Hinckeldey. Ein Giftmord käme darin wohl auch vor … Er behielt diesen Gedanken lieber für sich.
Da erschien der König mit seiner Entourage. Die Anwesenden brachen in Jubel aus. Friedrich Wilhelm IV. hatte für alle, die ihm persönlich bekannt waren, ein Lächeln übrig. Auch für Gontard, obwohl sein Blick zu sagen schien: Ich weiß genau, dass du auf den Barrikaden gestanden hast – die Abrechnung folgt!
Gontard trug es mit Fassung. Vielleicht hatte er es sich auch nur eingebildet. Ihm blieb immer noch die Möglichkeit, nach Österreich oder nach Russland zu gehen.
Kußmaul und er warteten, bis der König den Saal betreten und sich in der Ehrenloge niedergelassen hatte, dann begaben sie sich auf die ihnen zugewiesenen Plätze.
Pünktlich trat Ernst Curtius ans Podium. Er war ein sehr ansehnlicher Mann, weshalb Gontard nicht ganz verstehen konnte, warum er eine Witwe geheiratet hatte. Als hätte sich keine Jungfrau für ihn gefunden! Nun gut, er ging auf die vierzig zu, und die besagte Witwe war vorher mit dem Buchhändler Wilhelm Besser verehelicht gewesen, was auf ein gewisses geistiges Niveau schließen ließ.
»Was wissen wir über die Olympischen Spiele der Antike?«, begann Ernst Curtius, nachdem er alle Gäste, allen voran natürlich Seine Majestät, gebührend begrüßt hatte. »Sie nahmen vermutlich um 880 vor Christi Geburt ihren Anfang und fanden bis in das vierte nachchristliche Jahrhundert alle vier Jahre in der Landschaft Elis auf dem Peloponnes statt. Der Anlass für die Austragung der Wettkämpfe kann nicht zweifelsfrei festgestellt werden. Höchstwahrscheinlich handelte es sich um kultische Feste, die zu Ehren einer Gottheit, möglicherweise Herakles, abgehalten wurden. Andere Deutungen gehen davon aus, dass der König Pelops sie als Wiedergutmachung ins Leben rief, nachdem er bei einem Wagenrennen den König Oinomaos durch Betrug besiegt und anschließend getötet hatte. Weitere Forschung ist vonnöten. Unser Wissen um die Art der Wettkämpfe ist ebenfalls nicht umfassend. Zuerst soll es nur einen Wettlauf über eine Stadionlänge gegeben haben, dann sind Wagenrennen und Disziplinen wie Weitsprung, Gymnastik, Ringen, Boxen und Pankration, eine Mischung aus Ringen und Boxen, dazugekommen. Etwa 1300 Jahre später, so nehmen wir an, erlosch das olympische Feuer erst einmal. Kriege unter den griechischen Stämmen mögen ein Grund dafür gewesen sein, auch eine zunehmende Unlust am Treiben der Athleten oder Geldmangel sind vorstellbar. Genaueres wissen wir bis heute nicht. Fest steht nur, dass der Tempel des Zeus, an dem die Spiele stets mit einem Schwur der Sportler begannen, im sechsten Jahrhundert nach Christi Geburt durch schwere Erdbeben zerstört wurde. Meterdicke Schlamm- und Schuttschichten liegen seitdem über den olympischen Wettkampfstätten. Der englische Archäologe Richard Chandler war es, der im 18. Jahrhundert die Erinnerung an Olympia im Rahmen seiner Griechenlandreisen wachgerufen und den Ort recht eigentlich neu entdeckt hat. Hier sollte Preußen anknüpfen, denn mit Ausgrabungen in Olympia hätten wir die einmalige Gelegenheit, eine kulturelle Großtat zu begehen, für die uns die zivilisierte Welt dankbar umarmen wird. Zugegeben, ein solches Vorhaben würde viele hundert Millionen preußische Reichsthaler verschlingen, aber es wäre die Sache wert.«
»Das Geld sollte man lieber in unsere Schulen und Universitäten stecken«, brummte Raupach.
»Die Griechen würden mit Sicherheit darauf bestehen, das Eigentumsrecht an den Fundstücken aus Olympia zu behalten«, fuhr Curtius fort. »Aber wenn Preußen alle Kosten des Projekts übernähme, dann würden wir das Recht fordern, von allen ausgegrabenen Gegenständen Kopien herstellen zu dürfen. Die könnten wir dann hier in Berlin präsentieren.«
Kußmaul kommentierte ironisch: »Welch Entzücken, einen Lorbeerkranz zu bestaunen, der einem Dioxipoppulus einst über den Kopf gestülpt wurde!«
»Kulturbanause!«, zischte Gontard. »Nichts wäre für die körperliche Ertüchtigung unserer jungen Soldaten besser geeignet als das Pankration.«
»Damit sie die Kraft haben, eure Geschütze aus dem Morast zu ziehen.«
Als sie nach dem Vortrag auf die Straße traten, fror Gontard in seinem dünnen Militärmantel erbärmlich und dachte sofort an seinen Kürschner. »Hoffentlich hat Corduan meinen neuen Pelz bald fertiggenäht!«
Charles Corduan gab sich alle Mühe, Gontards Ansprüchen gerecht zu werden. Es ging schon auf Mitternacht zu, und die Gesellen hatten sich längst in ihre Schlafkammern zurückgezogen, da saß er noch immer in der Werkstatt und beugte sich über das gute Stück. Aber irgendwann begannen seine Hände zu zittern und seine Augen zu tränen, so dass er für diesen Tag aufgeben musste. Doch ins Bett gehen mochte er noch nicht, denn ihn begann ein plötzlicher Heißhunger zu plagen. So eilte er über den Flur zur Kammer seiner Dienstmagd und klopfte an die Tür. »Susanna, Pardon, aber ich möchte gern noch nachtmahlen.« Den Ausdruck hatte er von österreichischen Freunden.
»Wat denn, mitten in die Nacht möchten Sie noch mahlen? Mehl – oder wat?«, kam es von drinnen.
»Ich möchte etwas essen«, erklärte ihr Charles Corduan. »Ein kleines Nachtmahl zu mir nehmen.«
»Die Küche is schon kalt.«
»Ach was!«, entgegnete der Kürschner. »Etwas Glut ist immer im Herd. Es wird dir doch wohl glücken, mir schnell eine Bohnensuppe zuzubereiten!«
»Na jut, wenn et unbedingt sein muss. Et is ooch noch von dem Bohneneintopp von neulich wat übrich.«
»Gut, dann wärme den bitte auf und bringe ihn mir auf die Stube!«
Seit Corduan seine Frau begraben hatte, waren in dem Zimmer das Sofa und die Stühle unter Schonbezügen verschwunden. Am Ende des langen Esstisches hatte er sich ein Sitzmöbel aus der Werkstatt hingestellt, auf dem er ab und an Platz nahm, um sich vorzustellen, Eugenie sei noch an seiner Seite und speise gemeinsam mit ihm.
Endlich kam Susanna mit dem aufgewärmten Eintopf. Charles Corduan schaufelte ihn in sich hinein, obwohl er heute etwas seltsam schmeckte. Als Corduan sich satt gegessen hatte, ging er schlafen. Nach zwei Stunden aber wachte er auf, weil ihn starke Leibschmerzen plagten. Als ihm auch noch übel wurde, zog er sich an und eilte auf den Hof hinaus, wo sich der Abort befand. Er erbrach sich, und sein Durchfall wollte kein Ende mehr nehmen. Wadenkrämpfe kamen hinzu. Corduan lief zurück ins Haus, um auf der Diele zusammenzubrechen. Er wollte sich noch an der Garderobe festhalten, riss sie aber im Stürzen mit sich.
Der Lärm weckte Susanna. Als diese ihren Dienstherrn bewusstlos in der Diele vorfand, rief sie nach den Gesellen. »Los, lauft nach einem Doktor!«
»Mitten in der Nacht?«
»Ja, sonst stirbt er uns!«
Es dauerte eine Weile, bis man einen Arzt gefunden hatte. Als der Mediciner schließlich beim Kürschner Charles Corduan eintraf, war der bereits verstorben.
Zwei
Oberst-Lieutenant Christian Philipp von Gontard stand zwar gerne im Hörsaal der Vereinigten Artillerie- und Ingenieurschule, doch des Lehrinhaltes seines Hauptfaches – Physik unter besonderer Berücksichtigung der Ballistik – wurde er langsam ein wenig überdrüssig. Jahraus, jahrein den jungen Offizieren zu erklären, worin sich die Wurfparabel von einer ballistischen Kurve unterschied, unterforderte einen intelligenten Menschen wie ihn.
»An der Tafel sehen Sie oben die Flugbahn eines Körpers beim sogenannten schiefen Wurf in einem homogenen Schwerefeld bei Vernachlässigung des Luftwiderstandes. Darunter habe ich die Parabel gezeichnet, wie sie sich aus einem schiefen Wurf mit Stokes-Reibung ergibt. Wer war Stokes?«
Der etwas vorlaute Lieutenant Eike von Flieth, der sich zu gerne selbst reden hörte, nutzte sofort die Gunst der Stunde. »Ein Mann aus Stoke in England.«
»Irrtum! Sir George Gabriel Stokes, geboren am 13. August 1819 in Skreen, in der Provinz Connaught, ist gebürtiger Ire und hat als Mathematiker und Physiker Weltruhm erlangt. Ich darf Ihnen seine berühmte Formel über die Reibungskraft an die Tafel schreiben.«
Die jungen Lieutenants seufzten einvernehmlich, und Gontard war froh, als er die Stunde endlich hinter sich gebracht hatte. Umso mehr freute er sich auf seine zweite Lehrveranstaltung an diesem Tage, die der brandenburgisch-preußischen Militärgeschichte gewidmet war.
»Ich möchte Ihnen, meine Herren, in den nächsten Wochen bedeutende Heerführer Brandenburg-Preußens nahebringen«, waren seine ersten Worte. »Leider muss ich mit einem Österreicher beginnen, einem Manne, der am 20. März 1606 in Neuhofen an der Krems zur Welt gekommen ist: Georg von Derfflinger. Er war Sohn protestantischer Eltern und wuchs in Armut auf. Sie werden sich nun sicher fragen, wie er es bis zum Heerführer geschafft hat, zumal er nicht die geringste Schulbildung vorweisen konnte. Nun, als Soldat hatte er das Glück, in der Blüte seiner Jahre an den Schlachten des Dreißigjährigen Krieges teilnehmen zu können. Er trat in die Dienste verschiedener Herren und stieg im schwedischen Heer bis zum Reiter-Oberst im Generalsrang auf. Das ist eine beachtliche Leistung. Danach verpflichtete er sich dem Großen Kurfürsten Friedrich Wilhelm von Brandenburg. Derfflinger schuf eine völlig neue brandenburgische Armee, wobei sein Augenmerk der Kavallerie und der Artillerie galt. Der Sieg von 1675 über die Schweden, die unter Karl XI. kämpften, war zum größten Teil sein Verdienst. Es ist als genial zu bezeichnen, wie er den Handstreich gegen Rathenow ausgeführt und die Feinde anschließend verfolgt und über das Kurische Haff gejagt hat.«
Wieder meldete sich Eike von Flieth zu Wort. »Was haben wir unter dem Handstreich gegen Rathenow zu verstehen, Herr Oberst-Lieutenant?«
Gontard musste weit ausholen. »Das Ereignis trug sich am 15. Juni 1675 zu. Der Große Kurfürst und seine Mannen hatten in Erfahrung gebracht, dass der schwedische Oberst Wangelin mit sechs Kompanien seines Dragonerregiments zur Verstärkung der schwedischen Besatzung in der Stadt Rathenow eingerückt war. Wangelin sollte über Rathenow auf dem kürzesten Weg nach Magdeburg vorstoßen und die Stadt einnehmen. Für den Großen Kurfürsten gab es nur eine Lösung: Sein Regiment musste Rathenow unbedingt vor dem Eintreffen des schwedischen Hauptheeres erobern. Doch die Stadt an der Havel wies starke Befestigungen auf, man hätte sie im Kampf niemals erstürmen können. Deshalb wurde eine List ersonnen. Derfflinger, der aufgrund seiner Zeit beim schwedischen Heer gut Schwedisch sprach, ritt mit einigen wenigen Dragonern auf die hochgezogene Brücke der Stadt zu. Dort angekommen, wurde er von der schwedischen Wache angehalten, die nur aus einem Unteroffizier und sechs Mann bestand. ›Wie Volk?‹, wurde er gefragt. Man wollte also wissen, wer er sei und woher er komme. Derfflinger machte den Schweden weis, er sei ein schwedischer Lieutenant vom Regiment Bülow und befinde sich auf der Flucht vor den brandenburgischen Truppen. ›Ich muss dennoch erst Oberst Wangelin fragen, ob Ihr einrücken dürft‹, kam es von jenseits des Grabens. ›Das ist nicht nötig!‹, rief Derfflinger zu den Schweden hinüber. ›Oberst Wangelin ist ein guter Freund von mir, und wenn ich nicht sofort in die Stadt darf, riskiere ich, von den nachrückenden Brandenburgern gehängt zu werden.‹ Da wurde die Zugbrücke tatsächlich herabgelassen. Derfflinger ritt mit seinen Dragonern auf die Wache zu, hieb sie nieder – und Rathenow konnte alsbald vom Großen Kurfürsten eingenommen werden.«
Die jungen Lieutenants in dem Hörsaal brachen in Hurrarufe aus, was bei den Ausführungen zur Ballistik nie geschah, und so konnte Gontard mit dem Gefühl einer tiefen inneren Befriedigung die Stunde beenden.
Auf dem Flur begegnete ihm der Apotheker Gustav Rosengarth, der in diesem Jahr vertretungsweise das Fach Chemie übernommen hatte und sich in Berlin, besonders in der Gegend um das Oranienburger Thor, eines guten Rufes erfreute. Rosengarth war hochgewachsen, hatte ein schmales Gesicht und trug seine Haare lang wie ein Gelehrter. Gontard kannte ihn seit Jahren, und zwischen beiden war eine gewisse Vertrautheit entstanden. »Nun«, fragte Gontard, nachdem sie sich begrüßt hatten, »sind Sie auch auf dem Wege nach London?« Das war eine Anspielung auf Rosengarths Apothekerkollegen Theodor Fontane, von dem es hieß, er siedle Anfang April für einige Zeit auf die britische Insel über.
»Nein.« Rosengarth lachte. »Ich bin nichts weiter als ein einfacher Apotheker – und kein Schriftsteller und Correspondent bei der Centralstelle für Preßangelegenheiten wie Fontane.«
»Es ist meiner Meinung nach ganz schön, wenn man neben seinem Brotberuf noch etwas anderes mit Leidenschaft betreibt«, erklärte Gontard. »So wie ich gern den Criminal-Comissarius spiele.«
»Und Sie haben ja auch schon einige Erfolge aufzuweisen.« Rosengarth schaute auf seine Stiefelspitzen. »Womit könnte ich mich wohl in meiner arbeitsfreien Zeit vergnügen?«
Gontard dachte einen Augenblick nach. »Sammeln Sie etwas, oder erfinden Sie etwas! Als Apotheker könnten Sie doch eine neue Arznei kreieren. Es gibt Hunderte von Krankheiten, welche die Ärzte noch nicht heilen können.« Rosengarth seufzte. »Wenn das so einfach wäre!«
Sie unterhielten sich noch einen Moment und gaben dann ihrer Hoffnung Ausdruck, dass das neue Jahr etwas aufregender werde als 1851, das so unglaublich langweilig gewesen sei. Danach eilte Rosengarth zu seiner Lehrveranstaltung und Gontard zum Kürschner Corduan, um zu sehen, ob sein neuer Pelzmantel schon zur Anprobe auf dem Garderobenständer hing. Doch als er den Laden in der Jägerstraße betrat, war nicht der Kürschner, sondern einer der Gesellen gerade dabei, den rechten Ärmel an den Mantel zu nähen.
»Nanu!«, wunderte sich Gontard und fragte, wo der Meister sei. »Er hat sich doch höchstpersönlich um meinen neuen Pelz kümmern wollen!«
»Herr Corduan ist in der Charité«, antwortete der andere Geselle höchst lakonisch.
»Ist er plötzlich krank geworden?«
»Nein, viel schlimmer. Er ist in der vergangenen Nacht plötzlich zusammengebrochen und gestorben. Es heißt, der Schlag habe ihn getroffen. Jetzt liegt er da, wo die Leichen aufgeschnitten werden.«
Es gab Verlierer der gescheiterten Märzrevolution von 1848 – und es gab Gewinner. Zu Letzteren schien der Jurist Dr. Wilhelm Stieber zu gehören. Am 3. Mai 1818 in Merseburg zur Welt gekommen, wurde er schon als Schüler nach Berlin geschickt, wo er das Abitur am angesehenen Gymnasium zum Grauen Kloster ablegte. Anschließend studierte er an der Friedrich-Wilhelms-Universität Rechtswissenschaften. Er war ab 1844 als Auskultator, also Referendar, beim Berliner Criminalgericht tätig und ging bald – mit einigem Erfolg – gegen politische Oppositionelle vor. Zwar musste er seinen Dienst 1847 quittieren, weil er bei seiner Arbeit mitunter ein wenig gegen Recht und Gesetz verstoßen hatte, doch gerade das sicherte ihm die Gunst einflussreicher Männer, und so durfte er 1850 als Assessor ins Polizeipräsidium einrücken und die Ermittlungen gegen den Bund der Kommunisten leiten. Er war gerade dabei, gemeinsam mit Karl Georg Ludwig Wermuth Steckbriefe für das sogenannte Schwarze Buch zusammenzustellen, dessen voller Titel lautete: Die Communisten-Verschwörungen des neunzehnten Jahrhunderts. Im amtlichen Auftrage zur Benutzung der Polizei-Behörden der sämmtlichen deutschen Bundesstaaten. Erster Theil. Enthaltend: Die historische Darstellung der betreffenden Untersuchungen. Wermuth war der Königliche Hannöversche Polizeidirektor, dem man ein besonders gutes persönliches Verhältnis zu König Georg V. von Hannover nachsagte.
Stieber und Wermuth saßen in Stiebers Bureau im Berliner Polizeipräsidium beisammen, um zu beraten, welche Personen noch ins Schwarze Buch aufzunehmen seien.
»Ich hätte einen ganz interessanten Kandidaten«, begann Dr. Stieber.
»Schießen Sie los!« Dr. Wermuth war gespannt.
»Oberst-Lieutenant Christian Philipp von Gontard von der Vereinigten Artillerie- und Ingenieurschule.«
Dr. Wermuth zeigte sich erstaunt. »Wieso ausgerechnet den? Gontard war öfter zu Gast bei unseren Manövern im Hannoverschen und hat stets einen ausgezeichneten Eindruck hinterlassen.«
»Mag sein, aber das ist alles nur Tarnung. Er präferiert die Staatsform der amerikanischen Republik, und er ist Leuten wie Virchow kordial verbunden.«
»Und dennoch ist er vor nicht allzu langer Zeit zum Oberst-Lieutenant avanciert?« Dem Polizeidirektor aus Hannover fehlte angesichts dieser Informationen das Verständnis für die Beförderung.
»So ist es«, bestätigte Dr. Stieber. »Jemand am Hofe muss seine Hand schützend über ihn halten.«
»Denken Sie an Seine Majestät selbst?«
Dr. Stieber schüttelte den Kopf. »Nein, ich vermute eher, dass es eine der Hofdamen ist, möglicherweise sogar die Königin.«
Beide schwiegen erst einmal, denn was ihnen durch den Kopf ging, war zu heikel, um es auszusprechen. In Berlin wurde schon seit langem gemunkelt, dass Christoph Wilhelm Hufeland, der wohl bedeutendste Arzt der preußischen Residenz, beim König bereits in jungen Jahren eine unheilbare Impotenz diagnostiziert habe. Ob dieses Gerücht nun stimmte oder nicht, Tatsache war, dass die Ehe zwischen Friedrich Wilhelm IV. und seiner Frau Elisabeth kinderlos geblieben war. Und wenn die Königin nun ein Verhältnis mit dem Oberst-Lieutenant von Gontard hatte?
Dr. Stieber beendete das Schweigen. »Gontard soll sich im Jahre 1836 mit Karl Marx getroffen haben.«
»Das ist sechzehn Jahre her«, murmelte Dr. Wermuth.
»Was will das schon heißen? 1836 war Karl Marx an der Friedrich-Wilhelms-Universität eingeschrieben und hat nicht nur Vorlesungen von Friedrich Carl von Savigny, Carl Ritter und Bruno Bauer gehört, sondern auch von Eduard Gans, der Criminalrecht und Preußisches Landrecht gelehrt hat.«
»Und?« Dr. Wermuth konnte sich noch immer keinen Reim auf die Ausführungen Dr. Stiebers machen.
»Eduard Gans und Gontard sind entfernte Verwandte. Es ist also nicht ganz unwahrscheinlich, dass Gontard mit Karl Marx zusammengetroffen ist und sich von dessen staatsfeindlichem Gedankengut hat anstecken lassen.«
Dr. Wermuth wollte keine Entscheidung fällen. »Darf ich vorschlagen, dass wir das mit Gontard vorerst noch offenlassen?«
Gontard hatte an diesem Vormittag eine Verabredung im Café Stehely, zu der er auf keinen Fall zu spät kommen wollte. Schnell fuhr er mit dem rechten Fuß in seinen Stiefel. In derselben Sekunde hallte ein Schmerzensschrei durch das Haus in der Dorotheenstraße, der für einen Soldaten wenig heldenhaft war.