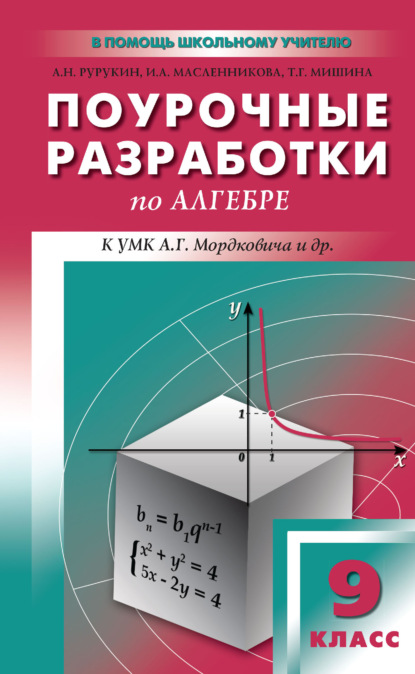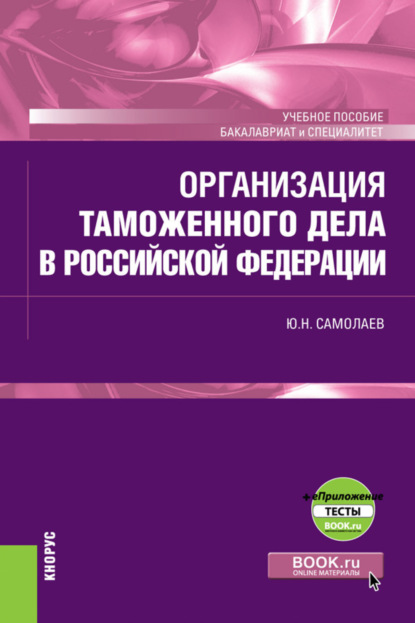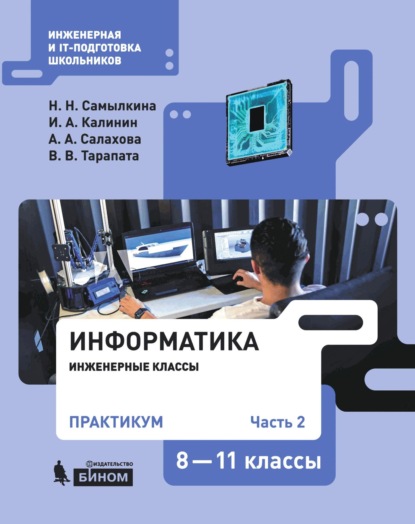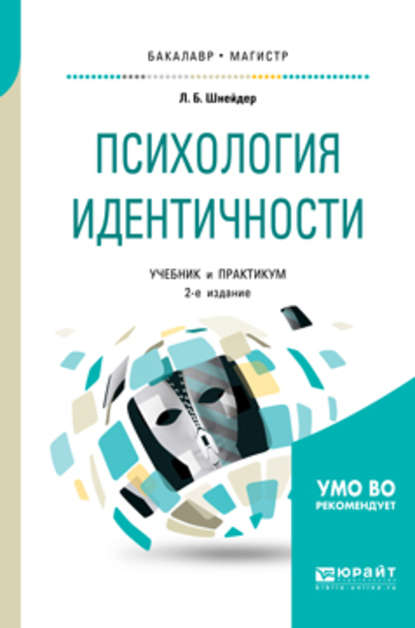Das Geheimnis vom Oranienburger Thor
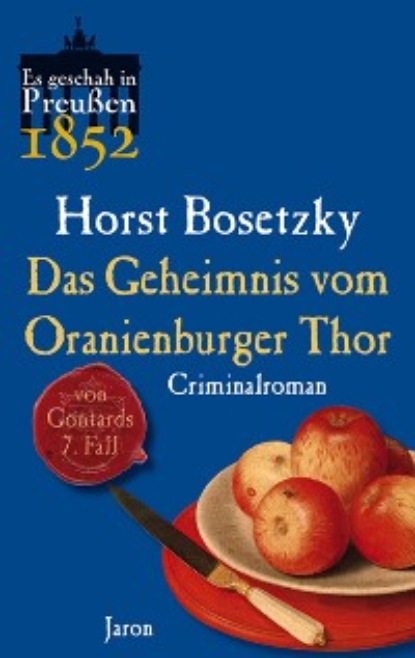
- -
- 100%
- +
Henriette eilte sofort in die Diele. »Hat dir jemand ins Bein geschossen?«
»Es fühlt sich zumindest so an.« Gontard zog den Fuß wieder aus dem Stiefel. »Da, bitte!« Blut tropfte aus der grauen Socke.
Es stellte sich heraus, dass Paul Quappe die reparaturbedürftigen Stiefel nicht zum Schuster gebracht, sondern sich selbst ans Werk gemacht hatte. Dabei hatte er allerdings viel zu lange Nägel verwendet.
»Das ist ein Mordversuch«, brummte Gontard. »Man müsste den Burschen sofort standrechtlich erschießen.«
»Ach was, das war doch keine Absicht!«
»Mag sein, aber Paul Quappe hat einfach zwei linke Hände und sorgt tagtäglich für ein fürchterliches Durcheinander.« Derzeit lag Gontards Bursche allerdings in seiner Kammer und kurierte seine Gehirnerschütterung aus. »Wenn Kußmaul sagt, dass es eine Gehirnerschütterung ist, wissen wir wenigstens, dass Quappe über so etwas wie ein Gehirn verfügt«, stellte Gontard fest, während er seine Wunde am rechten Fußballen mit einem Stück Mullbinde versorgte und gleichzeitig, auf dem linken Bein humpelnd, nach einem anderen Paar Schuhe suchte.
»Hat man denn den Kerl schon gefunden, der Paul niedergeschlagen hat?«, wollte Henriette wissen.
Gontard schüttelte den Kopf. »Nein. Werpel wartet sicherlich, bis der Mann zwei Dutzend Einbrüche begangen hat – und womöglich noch einen Mord –, damit er umso mehr Ruhm erntet, wenn er den Übeltäter gefangen hat.«
»Du sprühst heute geradezu vor Ironie«, stellte Henriette fest.
Gontard lachte. »Ich hoffe, das bleibt den ganzen Tag so.« Dann küsste er Henriette und machte sich auf den Weg zum Gensdarmen-Markt. Er sah sich dabei mehrfach um, denn er hielt es nicht für ausgeschlossen, dass ihn einer von Dr. Stiebers Leuten verfolgte. Schließlich würde er einen Mann treffen, der in Preußen ganz sicherlich als Staatsfeind galt: Benedikt Waldeck.
Waldeck war am 31. Juli 1802 in Münster geboren worden, hatte in Göttingen studiert, unter anderem bei Jakob Grimm, war ein hervorragender Jurist geworden und 1844 als Obertribunalrath an das höchste preußische Gericht nach Berlin gekommen. Viele Denker seiner Zeit hatten ihn beeinflusst, unter ihnen auch der französische Autor Henri de Saint-Simon.
»Ich gelte zwar als Anführer des fortschrittlichen Lagers, aber das entspricht nicht ganz der Wahrheit«, gestand er Gontard, als sie sich im Café Stehely gegenübersaßen. »Ich bin nie dafür eingetreten, die amerikanische Verfassung auf Deutschland zu übertragen, ich war immer für die konstitutionelle Monarchie. Meiner Meinung nach sollten alle adeligen Privilegien aufgehoben und die Presse- und Versammlungsfreiheit gewährleistet werden, aber mit einem König an der Spitze.«
»Wie passt das zusammen?«, fragte Gontard.
»Wir müssen die Welt so nehmen, wie sie ist, und alles daransetzen, dass sich unser Volk nicht selbst zerfleischt«, erklärte Waldeck. »Darum bin ich auch zur gemäßigten demokratischen Fraktion gestoßen und habe alles getan, um weitere gewalttätige Auseinandersetzungen zu verhindern.«
Gontard nickte. »Ich weiß, zum Beispiel beim Streik der Kanalarbeiter im vergangenen Jahr.«
Waldeck seufzte. »Dreh- und Angelpunkt ist für mich das Parlament. Ich ziehe die Redeschlachten dort den Straßenschlachten allemal vor. Und ein Gefängnis ist auch nicht gerade eine Stätte bürgerlicher Gemütlichkeit.«
Waldeck war im Mai 1849 verhaftet und eingesperrt worden, weil man ihm unter anderem vorgeworfen hatte, ein Attentat auf den König geplant zu haben. Das Gericht hatte ihn allerdings freigesprochen, nicht zuletzt deswegen, weil sich Hinckeldey als Zeuge in Widersprüche verwickelt hatte. Waldeck war anschließend von der Menge frenetisch gefeiert worden und hatte auf seinen Dienstposten beim Obertribunal zurückkehren können.
»Und nun?«, fragte Gontard. »Wie stehen Sie zur Deutschen Frage?«
Waldeck zögerte nicht mit einer Antwort. »Ich halte noch immer nicht viel von der provisorischen Regierung in Frankfurt und glaube, dass wir Preußen das Volk sind, das in Deutschland an der Spitze stehen sollte. Deshalb können nur wir die Einheit Deutschlands herbeiführen, wobei ich Österreich ausschließe. Auch wenn es deswegen Krieg geben sollte.«
Gontard war anderer Meinung, äußerte sich aber nicht, da er an einem der Nebentische einen Spitzel Dr. Stiebers entdeckte hatte. Darum sagte er jetzt so laut, dass der Spitzel es hören musste: »Goethe hat recht, die Politik ist wirklich ein garstiges Lied. Ich mache es so wie Sie, lieber Waldeck, und ziehe mich aus der Öffentlichkeit zurück. Es lebe das Private!«
Franz Böttschendorf war eigentlich Barbier, übte aber auch den traditionellen Beruf des Baders aus, zog also Zähne und versuchte sich bei armen Leuten, für die der Besuch einer Arztpraxis zu teuer war, als Mediciner. Sehr zum Ärger seiner Frau Dorothea. »Wir haben überall Schulden, und du verplemperst deine Zeit mit Leuten, die auf dem Kirchhof besser aufgehoben wären!«
Böttschendorf blieb gelassen. »Der Herr wird’s mir schon einmal danken.«
»Das denkst du! Ich glaube nicht daran.« Doch Böttschendorfs Frau sollte sich geirrt haben …
An einem Freitag suchte Böttschendorf den Kunstmaler und Kupferstecher Martinus Michels auf, um ihn zur Ader zu lassen. Ein Aderlass sollte den Körper von schlechtem Blut befreien, das durch übermäßiges Essen, Sorgen, Ängste oder Enttäuschungen entstanden sein konnte. Böttschendorf glaubte zwar nicht daran, aber mit dem Aderlass ließ sich noch immer Geld verdienen.
Michels hauste in einem verwahrlosten Gebäude in der sogenannten Parochialritze, der äußerst schmalen Parochialstraße, in einem Raum, der gleichzeitig als Atelier sowie als Wohn- und Schlafzimmer diente. Fast hätte man denken können, Carl Spitzweg sei 1839 hier zu Besuch gewesen, um sich Anregungen für sein wunderbares Gemälde Der arme Poet zu holen, nur dass Martinus Michels nicht dichtete, sondern malte. Manche hielten ihn für ein Genie, nur kaufen wollte niemand, was er auf die Leinwand brachte. Auch seine Radierungen und Federzeichnungen fanden keine Abnehmer.
Während Böttschendorf den Schröpfschnepper hervorholte, mit dem er die Haut an Michels linkem Arm anritzen würde, warf er einen Blick auf einige Federzeichnungen, die der Künstler an der Wand befestigt hatte, wohl, um sich an die Barrikadenkämpfe im März 1848 zu erinnern. »Haben Sie selbst auf den Barrikaden gekämpft?«, wollte Böttschendorf wissen.
Voller Stolz fuhr Michels auf. »Selbstredend! Immer mittenmang. Sehen Sie nicht, da stehe ich doch!« Er deutete auf eine der Zeichnungen.
Böttschendorf hätte sich schnell wieder seiner Profession zugewendet, wenn er nicht in diesem Augenblick neben Martinus Michels ein bekanntes Gesicht auf dem Gemälde entdeckt hätte. »Das darf doch nicht wahr sein!«, rief er aus.
»Was ist?«, wollte Michels wissen.
»Ach, nichts.« Böttschendorf sah keinen Anlass, Michels auf die Nase zu binden, dass er einen der lebensecht gezeichneten Barrikadenkämpfer erkannt hatte. Es war kein Geringerer als der Königliche Oberst-Lieutenant Christian Philipp von Gontard, verkleidet als Totengräber! Diese Entdeckung konnte Gold wert sein, und so kaufte Böttschendorf die Federzeichnung März 1848 – Barrikade am Alexanderplatz – Vor dem ersten Schusswechsel für so viel Geld, dass es Michels vorkam, als fielen Ostern und Pfingsten auf denselben Tag. Beide waren so glücklich wie schon lange nicht mehr.
Als Gontard am nächsten Morgen zum Rasieren und Haareschneiden zu Böttschendorf kam, holte der die Federzeichnung aus einer Schublade hervor und hielt sie seinem Kunden unter die Nase.
»Das ist der Beweis, Herr Oberst-Lieutenant, der Sie Kopf und Kragen kosten kann. Wie viel ist er Ihnen wert?«
Drei
Ein Institut für Pathologie gab es im Jahre 1852 an der Berliner Charité noch nicht, aber man verfügte seit 21 Jahren über eine Prosektur, in der zur Aufklärung von Todesursachen regelmäßig Obduktionen durchgeführt wurden.
An diesem Tag lag der Kürschner Charles Corduan auf dem Seziertisch, da sein plötzlicher Tod einige Fragen aufgeworfen hatte. Zu Johann Ludwig Casper, dem Inhaber des Lehrstuhls der praktischen Unterrichtsanstalt für die Staatsarzneikunde, der sich gerade mit einem jungen Kollegen daranmachte, den Leib des Kürschners zu öffnen, hatte sich ein Mann gesellt, der erst Mitte dreißig sein mochte, in Berlin jedoch bereits eine sehr hohe Reputation genoss. Es handelte sich um Emil du Bois-Reymond, den Spross einer Hugenottenfamilie. Er hatte in Berlin Medicin studiert und im Jahre 1846 mit der Arbeit Über die saure Reaktion der Muskelsubstanz nach ihrem Tode seine Habilitation abgeschlossen. Entscheidende Anregungen hatte er von dem Anatomen und Physiologen Johannes Peter Müller erhalten, dessen Handbuch der Physiologe des Menschen für Vorlesungen als Meilenstein in der Medicin angesehen wurde. Seit 1849 war du Bois-Reymond Assistent am Berliner Anatomischen Museum. Am liebsten aber stellte er sich immer wieder selbst an den Seziertisch, denn er strebte an, Professor für Physiologie zu werden und Müllers Nachfolge anzutreten.
»Wie ist dieser Mann gestorben?«, wollte du Bois-Reymond wissen.
»Es hat ihn nach dem Nachtmahl erwischt«, hatte Johann Ludwig Casper in Erfahrung bringen können. »Er litt wohl an Übelkeit, Erbrechen und wässrigem Durchfall. Schließlich hat die Atmung ausgesetzt.«
»Hm …« Emil du Bois-Reymond richtete seine Aufmerksamkeit auf die Haut des Toten, die aschfahl war. »Es scheint mir fast, als sei der Mann mit Arsen vergiftet worden. Die Hautfarbe und die geschilderten Symptome sprechen jedenfalls dafür.«
Casper winkte ab. »Seitdem man mit der Marsh’schen Probe Arsentrioxyd nachweisen kann, ist das Gift ein bisschen aus der Mode gekommen.«
»Sie sollten dennoch eine Marsh’sche Probe in Betracht ziehen«, wandte du Bois-Reymond ein.
»Ich habe sie bereits veranlasst. Das Ergebnis liegt inzwischen bestimmt im Laboratorium.«
Man schickte einen Boten los. Und tatsächlich war der Kürschner Charles Corduan mit Arsen getötet worden. »Wir haben also eine Giftmörderin in der Stadt. Berlin, nimm dich in Acht!«, rief Emil du Bois-Reymond. Bei Giftmorden dachte man wie selbstverständlich an eine Frau als Täterin. Womöglich lag das daran, dass die Literatur seit der Antike zumeist von weiblichen Giftmördern berichtete.
Criminal-Commissarius Waldemar Werpel saß mit seiner Frau am Frühstückstisch und ließ seiner schlechten Laune freien Lauf. »Der Winter allein ist schon schlimm genug, aber nun muss ich auch noch einen Giftmord aufklären! Und so ’ne richtige Giftmischerin lässt doch nicht locker, bevor sie nicht ’nen halben Friedhof gefüllt hat. Ich wünschte, ich würde eine Influenza kriegen! Andere Menschen werden doch auch immerzu krank.«
»Waldemar, versündige dich nicht!«
»Ist doch wahr! Und befördert worden bin ich immer noch nicht.«
Seine Frau zeigte auf den Spruch, der am heutigen Tag auf dem Abreißkalender stand:
Auch aus Steinen, die einem in den Weg gelegt werden, kann man Schönes bauen.
Werpel reagierte gereizt. »Besonders aus meinen Nierensteinen!«
In diesem Augenblick wurde am Klingelzug gerissen. Minna Werpel zog die Küchengardine zurück und sah auf die Straße hinunter. »Es ist Krause.«
Das war der Constabler, der Werpel bei seiner Arbeit assistierte. Der Commissarius, dem Krause vorher zugeteilt gewesen war, hatte einmal gesagt, dieser Mann sei zum Scheißen zu dämlich. Werpel war der Letzte, der dem widersprechen wollte. Mit Krause war er wirklich gestraft. Andererseits ersparte ihm sein Constabler den Weg ins Theater, denn ein komisches Schauspiel erlebte er mit dem oft genug.
»Wat liejt’n heute an?«, fragte Krause, nachdem Werpel, dick bekleidet, auf die Straße getreten war. Der Constabler kam sich sehr bedeutsam vor, seit die Uniformen der Schutzpolizei der des Militärs angepasst worden waren.
»Was heute anliegt?«, wiederholte Werpel, der das Gefühl hatte, sein Gehirn arbeite bei dieser Kälte langsamer. »Der Giftmord am Kürschnermeister Corduan aus der Jägerstraße. Da sollten wir auch gleich hingehen.«
»Könn’ wa nich über die Krausenstraße jehn?«, fragte der Constabler.
Werpel sah ihn staunend an. »Warum sollten wir das tun? Das ist doch ein gehöriger Umweg.«
»Ja, aba ick freue ma imma, wenn ick det Straßenschild lesen, weil ick denn denke, det die Straße nach mia benannt is.«
Werpel fasste sich an die Stirn. »Die heißt schon sehr lange so, mindestens seit 1720. Ein Mann namens Krause soll ein Haus in dieser Straße besessen haben.« Dann lachte er. »Es haben eben nicht alle so viel Glück wie ich.«
»Wieso? Et jibt doch jar keene Werpelstraße in Berlin.«
»Nein, aber ein kleiner Pilz heißt wie ich: die zierliche Verpel.« Dass man den Pilz vorn mit einem V schrieb, verschwieg Werpel. Man spreche das V wie ein W, hatte ihm ein Pilzsammler verraten.
Krause prustete los. »Mit die zierliche Werpel kann aba nich Ihre Frau jemeint sint!«
Darauf wusste Werpel nichts zu erwidern. Der Constabler hatte schon recht, denn seine Minna war in den vergangenen Jahren wirklich ein wenig in die Breite gegangen.
Krause war an diesem Morgen in Plauderstimmung. »Wenn wir bei die Indiana am Amazonas wär’n, denn hätten wa et einfacha«, fand er.
Werpel konnte ihm nicht folgen. »Wieso das?«
»Die schießen mit Jiftpfeile, und wo ’n Pfeil is, da is ooch ’n Bogen und damit ’n Beweis.«
»Wenn nicht alles trügt, ist Corduan an einem vergifteten Bohneneintopf gestorben«, stellte Werpel fest.
Sie brauchten nicht lange, bis sie ihr Ziel erreicht hatten. Krause konnte kaum lesen und schreiben, war aber in der Lage, das Wort Pelze auf dem Ladenschild von Charles Corduan zu entziffern. »Ick hab manchmal so ’n pelzigen Jeschmack im Mund, vielleicht hätte ick Kirschna wer’n soll’n.«
Werpel zögerte nicht, den Constabler zu vergackeiern. »Da hätten Sie aber kräftig Kirschen essen müssen.«
»Schade, Kirschen hatten wa keene im Jarten.«
Jetzt galt es, den nötigen Ernst an den Tag zu legen. Zuerst befragte Werpel die beiden Gesellen, aber die konnten nichts zur Klärung des Falles beitragen. »Wir haben oben in unseren Kammern geschlafen. Erst als Susanna geschrien hat, sind wir nach unten gerannt, aber da lag unser Meister schon am Boden.«
»Und in den Tagen zuvor ist Ihnen nichts aufgefallen?«
»Nein. Was hätte uns denn auffallen sollen?«
Werpel verdrehte die Augen. »Zum Beispiel, dass jemand ums Haus geschlichen ist oder sich in anderer Weise verdächtig verhalten hat.«
»Nee, tut uns leid.«
Blieb nur noch Susanna, die Dienstmagd. Die fanden Werpel und Krause in der Küche, in Tränen aufgelöst. »Et is allet so furchtbar, Herr Commissarius, aba ick war et nich, det schwöre ick bei Gott und allen Heilijen. Dazu habe ick doch zu sehr an ihm jehang’n.«
Werpel wurde hellhörig. Vielleicht war die Magd auf eine Heirat aus gewesen, und Corduan hatte sie abgewiesen. Das Arsen im Eintopf könnte die Rache für die Zurückweisung gewesen sein. Werpel beschloss, unverzüglich zu handeln. »Wir müssen Ihre Kammer, den Keller und die Küche nach Spuren des verwendeten Gifts durchsuchen. Sie folgen uns bitte, damit wir Sie im Auge behalten können!«
»Ick war et nich, Herr Commissarius!«, wiederholte Susanna.
Die Durchsuchung der genannten Räume erbrachte nichts. Aber was mochte das schon besagen? Die Dienstmagd hatte alle Zeit der Welt gehabt, sämtlich Beweise aus dem Haus zu schaffen. Man nahm die Angaben zu ihrer Personen auf, denn verdächtig blieb sie auf alle Fälle. Anschließend machte sich Werpel auf den Weg ins Polizeipräsidium, denn der Polizeipräsident von Hinckeldey höchstpersönlich hatte ihn sprechen wollen. Krause sollte indessen eine Apotheke nach der anderen aufsuchen und sich von den Inhabern aufschreiben lassen, ob in letzter Zeit jemand Arsen erworben hatte. An einen so außergewöhnlichen Kauf konnten sich die Apotheker bestimmt erinnern.
Das Polizeipräsidium war im alten Stadtvogtei-Gebäude am Molkenmarkt No. 1 untergebracht. Werpel hatte also nicht weit zu laufen. Nachdem er die Jägerstraße hinter sich gelassen hatte, überquerte er erst den Werderschen Markt und dann an der Unterwasserstraße einen der Spreearme, um schließlich vom Schloßplatz in die Breite Straße abzubiegen und über den Mühlendamm den Molkenmarkt zu erreichen.
Selbstverständlich hatte Werpel über eine Viertelstunde im Vorzimmer des Polizeipräsidenten zu warten. Das gehörte zum Ritual. So wollte Hinckeldey seine Untergebenen einschüchtern. Werpel wusste, dass von Hinckeldey aus der Nähe von Wasungen kam und bei den Demokraten und Barrikadenkämpfern von 1848 wegen seiner Geheimpolizei verhasst war, aber auch viele Feinde im Adel hatte, weil er sich nicht beeinflussen ließ. Andererseits hatte der Polizeipräsident, der ein Günstling des Königs war, in Berlin bereits einiges vorangebracht. So hatte er die Einführung von Straßenreinigung und Kanalisation veranlasst und den Bau des ersten Berliner Wasserwerkes angeregt. Zudem ließ er Volksküchen und Badeanstalten sowie Altersheime einrichten und brachte gerade die Aufstellung einer Berufsfeuerwehr sowie die Reorganisation der Polizeiverwaltung auf den Weg. Auch öffentliche Pissoirs waren auf seine Weisung hin errichtet worden, was die Berliner ihm mit einem Spottlied dankten, in dem sie ihn Pinkelbey nannten.
Als Werpel zu seinem obersten Vorgesetzten vorgelassen worden war, gab der sich überaus leutselig. »Nehmen Sie Platz, Herr Criminal-Commissarius, und berichten Sie mir, was Sie im Falle des Kürschners Corduan bereits herausgefunden haben!«
Werpel folgte der Aufforderung, anfangs noch etwas stockend, dann aber doch recht flüssig, und schloss damit, dass er Angst habe, in Berlin werde nun eine zweite Gesche Gottfried ihr schauriges Handwerk betreiben.
Hinckeldey staunte. »Wer ist das?«
»Gesche Gottfried war die Tochter eines Schneidermeisters aus Bremen. Zuerst dachte man, sie tut nur Gutes und opfert sich für alle auf, in Wahrheit hat sie aber fünfzehn Menschen mit Arsen vergiftet. Im Jahre 1831 ist sie überführt und hingerichtet worden.«
Hinckeldey lächelte. »Was ausschließt, dass sie auch unseren wackeren Corduan ermordet hat. Das Tragische an der Geschichte ist, dass Seine Majestät ihn in den nächsten Tagen zum Hoflieferanten machen wollte. Der König hat also ein ganz besonderes Augenmerk auf diesen Fall gelegt. Werpel, geben Sie nicht nur Ihr Bestes, sondern übertreffen Sie sich selbst, und verhindern Sie um Gottes willen, dass noch weitere Berliner vergiftet werden! Damit ist unser Gespräch beendet.«
Caroline Schlitt war Witwe. Manche Nachbarn in der Brüderstraße, in der sie mehrere Häuser besaß, waren überzeugt, dass sie ihren Mann aus Habgier umgebracht hatte. Sie bestritt das energisch und hatte auch schon Prozesse gegen diejenigen angestrengt, die diese Behauptung in der Öffentlichkeit kundtaten. Immer wieder erklärte sie, dass ihr Mann, der überaus erfolgreiche Tuchfabrikant und -händler Ludwig Schlitt, beim Verzehr eines Stücks Rindfleisch erstickt sei. Man glaubte ihr nicht, denn der Bolustod, ausgelöst durch einen im Kehlkopf feststeckenden Gegenstand, war noch nicht bekannt.
Nun war Caroline Schlitt wirklich keine herzensgute Frau. Im Gegenteil, sie stänkerte gern und bereitete anderen Leuten mit Vorliebe Schwierigkeiten, vor allem ihren Mietern. Man behauptete, sie habe beim Eintreiben der Miete stets eine kleine Pistole in ihrer Handtasche. Das stimmte zwar nicht, wäre ihr aber durchaus zuzutrauen gewesen. Als sie einmal eine Familie auf die Straße gesetzt hatte, weil sie die heftigen Hustenanfälle des an Tuberkolose erkrankten Mannes in ihrer Nachtruhe gestört hatten, war mit Kreide an ihre Wohnungstür geschrieben worden:
DU HEXE SOLLTEST VERBRANNT WERDEN!!!
Sie störte das nicht sonderlich, denn sie genoss die Macht, die sie dank ihres Eigentums über andere Menschen hatte.
Eigentlich hatte sie an diesem Tag gute Laune, denn durch den Tod ihres Onkels Charles Corduan erbte sie eine ganze Menge. Gerade hatte sie sich zu einem Mittagsschläfchen auf ihrem Canapé wohlig ausgestreckt, da wurde an ihre Wohnungstür geklopft. Sie fühlte sich in ihrer Ruhe gestört. »Wer ist denn da?«, fragte sie ungehalten.
»Magdalena Gnie.«
»Lassen Sie mich in Ruhe!«
»Ich bitte noch um einen Tag Aufschub«, kam es vom Treppenhaus in flehentlichem Ton. »Meine Schwester kommt morgen nach Berlin und wird mir das Geld für die ausstehende Miete leihen.«
»Kommt nicht in Frage! Packen Sie Ihre Sachen! In einer Stunde steht ein Fuhrwerk vor der Tür, das Ihren Krempel abholt.« Caroline Schlitt wusste, dass sie nun so schnell keinen Schlaf finden würde, und setzte sich an ihr Klavier, um die Réminiscences des Huguenots von Franz Liszt zu spielen. Das war ihre andere Seite: Sie war eine glänzende Solistin und eine begehrte Klavierlehrerin.
Der Constabler Krause hatte natürlich vergessen, in den Berliner Apotheken nach auffälligen Käufen von Arsen zu fragen. Seine Begründung war einleuchtend: »Ick hab nu mal ’n Jedächtnis wie ’n Sieb, det weeß doch jeda.«
Also war Werpel selbst losgezogen. Jetzt stand er am Oranienburger Thor und sah auf seine Liste. In der Rosengarth’schen Apotheke war er eben gewesen, nun kam die von Ernst Schering an die Reihe. Der Apotheker 1. Klasse kam aus Prenzlau, das wusste Werpel, hatte in der Apulius’schen Apotheke, der besten Berlins, gelernt und dann in Berlin Pharmazie studiert. Obwohl Schering keine dreißig Jahre alt war, hatte er es schon weit gebracht. Er galt als außerordentlich kundig und kam auf immer neue Ideen. Frauen etwa beglückte er mit »Schering’s bekömmlicher Speisenwürze«, mit der man Suppen und Eintöpfe, die schon etwas angegangen waren, noch genießbar machen konnte. Immer mehr Kunden sagten ihrem alten Apotheker ade, um sich ihre Salben und Medikamente fortan aus der »Grünen Apotheke« zu holen. Auf diesen Namen hatte Schering, der Naturliebhaber, die Schmeisser’sche Apotheke nach ihrem Ankauf umgetauft. Sie lag in der Chausseestraße No. 21, nahe dem Oranienburger Thor.
Schering konnte sich denken, warum der Criminal-Commissarius ihn aufsuchte. »Sie kommen wegen des Kürschners Corduan, oder?« Offenbar hatte sich schon herumgesprochen, dass Corduan mit Arsen vergiftet worden war.
Werpel nickte. »In der Tat. Haben Sie einen Augenblick Zeit für mich?«
»Ja, obwohl ich gerade sehr beschäftigt bin, denn ich möchte mir hinter dem Verkaufsraum ein eigenes kleines Laboratorium einrichten. Ich träume schon lange davon, Medikamente nach einem standardisierten Verfahren herzustellen. Kommen Sie, hinten stehen zwei Stühle, dort sind wir ungestört.«
Werpel wollte so schnell wie möglich Feierabend machen und legte keinen großen Wert auf eine Plauderei. »Ich möchte Sie wirklich nicht lange stören. Sie wissen ja, worum es geht, Herr Schering. Wir müssen herausfinden, wer sich das Arsen, mit dem Corduan vergiftet wurde, wann und wo beschafft hat.«
Der Apotheker holte weit aus. »Arsen ist ein weißes und gut in Wasser lösliches Pulver, das etwas nach Knoblauch riecht.«
»Was aber die Leute, die gern Knoblauch essen, davon nicht abhalten wird«, warf Werpel ein.
»Nein, das ist es ja. Die tödliche Dosis beim Menschen dürfte, je nach Körpergewicht, zwischen 60 und 170 Milligramm Arsenik liegen, schätze ich«, fuhr Schering fort. »Diese Menge lässt sich leicht in eine Mahlzeit mischen, ohne dass es auffällt.«
»Man muss das Gift aber erst einmal haben, um das zu tun«, merkte Werpel an.
»Arsen zu erwerben ist gar nicht so einfach«, gab Schering zu Protokoll. »Die Zeiten, in denen es jeder als Fliegengift kaufen konnte, sind vorbei.«
»Trotzdem kann es noch in vielen Haushalten vorhanden sein.«
»Das stimmt. Heute jedenfalls darf ich keinem Mehlhändler, Bierbrauer, Bäcker oder Müller Arsen verkaufen, wenn Fliegen, Schaben, Mäuse oder Ratten ausgerottet werden sollen. Dafür gibt es inzwischen andere Methoden. So soll verhindert werden, dass das Arsen durch Unachtsamkeit in die Nahrungsmittel gelangt. Kammerjäger meinen außerdem, dass Ratten und Mäuse das Gift leicht in Gefäße mit Mehl, Malz oder Graupen speien können.« Werpel schüttelte sich. »Wem dürfen Sie überhaupt noch Arsen verkaufen?«