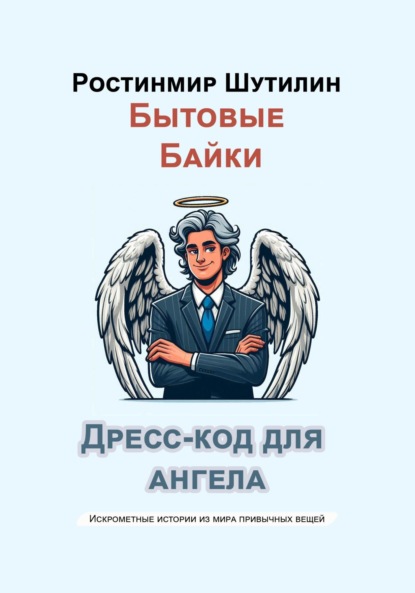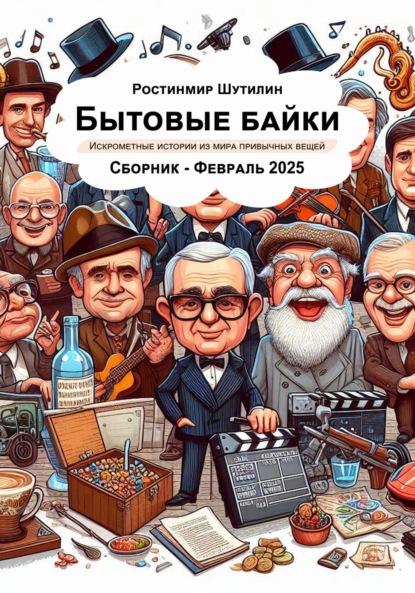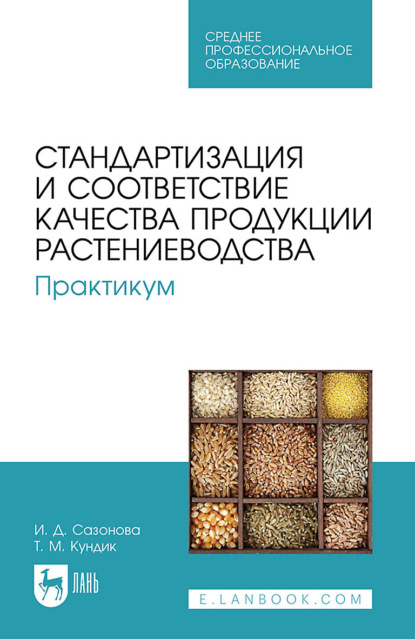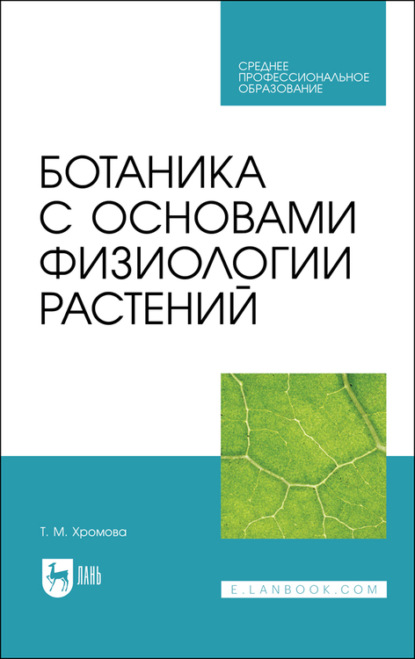- -
- 100%
- +
Von Breslau nach Nieder-Pontwitz, das im Fürstenthum Oels gelegen war, brauchten sie bei bitterer Kälte und auf teils noch vereisten Straßen mit der Kutsche, die sie sich geliehen hatten, mehr als drei Stunden, und sie kamen gerade vor der Dorfkirche an, als der Pfarrer zur Rede ansetzte.
»Wir sind traurig, Herr, denn wir müssen für immer Abschied nehmen von einem Menschen, der uns so vertraut war wie niemand sonst. Mit seinem Tod geben wir auch einen Teil von uns selbst dahin.«
Da schossen dem Jungen die Tränen in die Augen. Zwar war in den Tagen der Napoleonischen Kriege viel vom Sterben die Rede gewesen, aber immer hatte es nur die anderen getroffen, und es war Mitleid gewesen, aber nicht Leid. Seine Großmutter war auch einmal so jung gewesen wie er, ein gesundes und kraftvolles Mädchen … Nun lag sie im Sarg, und auch er würde am Ende seiner Tage in einem solchen Sarg liegen, während die anderen trauerten. In diesen Sekunden begriff August Borsig, dass auch er sterblich war, und das war für ihn eine furchtbare Erkenntnis. Zugleich schoss ihm der Gedanke durch den Kopf, dass es Menschen gab, die unsterblich waren, Friedrich II. von Preußen oder dieser Kaiser Nero beispielsweise. Nur wer Großes leistete, konnte damit rechnen, unsterblich zu werden.
Der Rest des Februars und der März 1817 verliefen ohne Ereignisse, die sich im Gedächtnis der Jungen festgesetzt hätten, und das Gleichmaß der Tage wurde erst mit den Ostertagen beendet. Der Ostersonntag fiel in diesem Jahr auf den 6. April, und am Karfreitag kam seine Tante Anna, die fünf Jahre jüngere Schwester seines Vaters, für ein paar Tage zu Besuch. Sie war in Trebnitz bei einem hohen Offizier in Stellung. Anna Borsig galt als etwas verschroben, »nerrsch«, wie die Schlesier sagten, und glaubte an gute wie an böse Geister. Schon am ersten Abend erschreckte sie die Kinder mit ihren Erzählungen.
Der Vater musterte seine Schwester. »Nu, mein Madla, du siehst mir gar nicht gut aus. So blass und dünne.«
»Ja, da magst du recht haben, Johann, das kommt von diesem dreimal verfluchten Czaja!«
Die Breslauer staunten, denn Joachim Czaja, ihr Verlobter, ein Kürassier aus Steinau an der Oder, war schon seit über zwanzig Jahren tot. Er war kurz vor der geplanten Heirat vom Pferd gefallen und hatte sich den Hals gebrochen.
»Trauerst du noch immer um ihn?«, fragte Susanna Borsig, ihre Schwägerin.
»Nein, das nicht. Aber er ist ein Nachzehrer.«
Was das war, wusste August: ein Toter, der unter der Erde liegt oder sitzt und seinen Hinterbliebenen die Lebenskraft absaugt. Im Gegensatz zum Vampir kam er niemals aus seinem Grab heraus.
»Das mit dem Nachzehrer, das ist doch Mumpitz!«, rief der Vater.
»Das ist es nicht!«, beharrte die Tante. »Als er beerdigt worden ist, haben wir vergessen, etwas auf seine Brust zu legen, das ihn gebannt hätte, ein Messer oder eine Schere.«
Als Anna Borsig am Ostersonnabend mit ihrem Neffen durch die Breslauer Innenstadt schlenderte, entdeckte sie in der Nähe der St.-Elisabeth-Kirche die Stube einer Wahrsagerin.
»Das kann ich mir nicht entgehen lassen, mein Jingla!«, rief sie. »Und du kommst mit!«
»Nein, ich …«
Sie zog ihn mit sich zur Haustür. »Sei kein Plotsch!«
Ein Plotsch, ein Dummkopf, wollte er nicht sein, also ging er mit. Auch damit er seinem Freund Walter Rawitsch etwas zu erzählen hatte. Die Wahrsagerin erinnerte ihn stark an die Hexe aus Hänsel und Gretel. Er begann sich zu fürchten. Seine Tante aber plauderte ganz unbefangen mit ihr, und so widerstand er dem Impuls davonzulaufen.
»Mein Neffe zuerst!«, sagte Anna Borsig. »Ich bin mal gespannt, was aus ihm werden wird.«
Die Wahrsagerin starrte in ihre Kristallkugel, in der sich das Licht einer dicken Kerze brach. August zitterte nicht gerade vor Erwartung, aber gespannt war er doch, sosehr er das alles für Humbug hielt.
»Ich sehe eine Menge … Du bist ein Liebling der Götter, hoch sollst du steigen – aber mit einem Schlag kann alles aus sein.«
Schien es in Breslau, als würde die Welt auf ewig bleiben, wie sie gerade war, so geschah anderswo vieles, was sie völlig verändern sollte. Man brauchte das Eisen nicht mehr, um Kanonenrohre zu gießen, es konnte zu anderem verwendet werden. Es begann die große Stunde der Tüftler und Erfinder. Auch bildete sich – vor allem in England – ein Menschentyp heraus, der Neues schaffen wollte und viel damit verdiente, dass er andere für sich arbeiten ließ: der moderne Unternehmer. Erfüllt von der puritanischen Idee, dass nur harte Arbeit Gott gefiel, man aber das verdiente Geld nicht verprassen durfte – denn jede Lust, insbesondere die des Fleisches, war Sünde –, häuften diese Männer so viel Kapital an, dass sie neue Unternehmen gründen und neue Märkte erobern konnten.
John Wilkinson, 1728–1808, genannt Iron Mad Wilkinson, der aus einer Familie von Eisenhüttenleuten kam, baute 1747 in Lancashire seinen ersten Hochofen und erfand eine Präzisionsbohrmaschine zum Ausbohren von Kanonenrohren. Obwohl ihn ganz England auslachte, schuf er das erste Schiff aus Eisen. Er war so besessen von diesem Werkstoff, dass er sich sogar in einem gusseisernen Sarg begraben ließ.
Benjamin Huntsman, 1704–1776, von Hause aus Uhrmacher, experimentierte so lange, bis er flüssigen Stahl, Gussstahl, herstellen konnte.
James Watt, 1736–1819, gelernter Mechaniker, verbesserte den Wirkungsgrad der alten Wasserhebe-Dampfmaschinen in den englischen Gruben und machte sie zum Prototyp der modernen Maschine.
Aber auch in Deutschland begann es sich zu regen: Friedrich Krupp, 1787–1826, gründete 1810 mit dem Geld, das er von seiner Großmutter geerbt hatte, die »Firma Friedrich Krupp zur Verfertigung des Englischen Gußstahls und aller daraus resultierenden Fabrikationen«.
Eine Ahnung von dieser modernen Welt sollte August Borsig bekommen, als er Meister Ihle und seinen Vater bei einer Reise nach Tarnowitz begleiten durfte. Das lag 170 Kilometer südöstlich von Breslau, nahe an der Grenze zum sogenannten Congresspolen, das Teil des russischen Zarenreichs geworden war. Sie waren, da Ihles Fuhrwerk mit einigen Ersatzteilen schwer beladen war, mehrere Tage unterwegs. Mit der Schule nahm das keiner so genau, und wenn August ein paar Stunden versäumte, machte das nichts.
Der Junge hatte gestaunt. »Was hat denn ein Zimmermann mit einer Dampfmaschine zu tun? Die ist doch aus Eisen – was soll er da reparieren?«
Die beiden Männer erklärten ihm die Sache: Beim Bau der ersten Dampfmaschinen taten sich Zimmerleute, Schmiede, Schlosser, Eisengießer und Feinmechaniker zusammen, und bei ihren Konstruktionen war noch viel Holz im Spiel. So bestand der – neben dem Dampfzylinder – wichtigste Teil der Maschine, der unförmige und viele Zentner schwere Schwingbaum, aus Eichenholz, das heißt aus mehreren splitterfesten Balken, die in sauberer Zimmermannsarbeit aneinandergefügt worden waren. Diese Arbeit hatte Ihle vor Jahren auf der Friedrichsgrube in Tarnowitz für einen gewissen Friedrich Wilhelm Holtzhagen ausgeführt, dem inzwischen die Aufsicht über alle Dampfmaschinen der Berg- und Hüttenwerke Ober- und Niederschlesiens übertragen worden war.
»Jetzt sind einige Balken zu erneuern, und da hat uns Holtzhagen nach Tarnowitz gerufen«, schloss Ihle.
Als August Borsig vor der ersten Kolbendampfmaschine seines Lebens stand, empfand er sie im ersten Augenblick als ebenso geheimnisvoll wie bedrohlich. Klein kam er sich vor und so verletzlich wie eine Ameise, die auf den Amboss eines Schmiedes geklettert war. Langsam aber begriff er, dass sie Menschenwerk war und von Menschen kontrolliert wurde. Was ihn am meisten beeindruckte, waren die ungeheuren Kräfte, die mit dieser Maschine erzeugt und in Arbeit umgesetzt wurden. Dabei war alles ganz einfach: Man nahm Kohle und erhitzte damit das Wasser so weit, dass es zu Dampf wurde. Und in diesem Dampf – wurde er gebändigt und in richtige Bahnen gelenkt – steckte mehr Energie, als Hunderte von Menschen und Dutzende von Pferden aufzubringen vermochten. Holz und Eisen gehörten auch noch dazu, eine Menge Handwerker und natürlich einer, der sich das alles ausdachte und auf große Bögen zeichnete. Genau so hatte es ihnen Mistek beim Bau eines Hauses erklärt. So etwas zu können steckte im Menschen, wie es in den Bienen steckte, sich ihre Waben und Stöcke zu bauen. Im Menschen? Nein, nicht in allen, nur in einigen.
Dass er zu diesen wenigen Menschen gehörte, war August Borsig an diesem Tag von Tarnowitz zu keiner Sekunde bewusst. Er sah in diesen Jahren nur alles, nahm nur auf, was ihm begegnete, und speicherte es irgendwo im Gedächtnis, ohne dass das eine mit dem anderen zusammenkam. Seine Großmutter hatte immer gesagt: »Mit den Augen kann man stehlen« – also stahl er ununterbrochen. Er hatte jedoch keine Absicht, dies irgendwann einmal zu benutzen – es war der reine Spaß am Stehlen, der ihn trieb.
Nun gut, manchmal kramte er etwas hervor, wenn in der Schule nach bestimmten Sachen gefragt wurde. So wollte Mistek kurz vor den Sommerferien wissen, wo die Oder entspringt.
»In Polen!«, riefen alle.
»Falsch.«
»Im Kaiserthum Oesterreich«, sagte August Borsig. Das hatte ihm Meister Ihle auf der Fahrt nach Tarnowitz erklärt.
»Wieso entspringt die?«, fragte Walter Rawitsch. »Die Oder ist doch kein Sträfling.«
»Rawitsch, die Finger!« Der Lehrer holte seine Haselrute hervor.
Augusts Freund nahm das Züchtigungsritual klaglos hin. Seine Rache bestand darin, dass er Mistek an einem der nächsten Tage scheinbar arglos fragte, ob sein Name vom Englischen mistake – Fehler – herkäme. Darauf hatte ihn sein Vater gebracht.
Mistek blickte böse, entschloss sich dann aber, nicht aus der Haut zu fahren, sondern die Sache mit Humor zu nehmen. »Richtig! Ich bin in London geboren worden und war Hauslehrer der englischen Prinzen. Als ich nach Breslau gekommen bin, haben sie den Namen Mistake dann eingedeutscht in Mistek.« Dass viele seiner ehemaligen Schüler ihn Miststück nannten, wusste er nicht.
Endlich war die Schule aus. Auf dem Nachhauseweg kamen August und Walter an einer Glaserei vorbei, die sich nebenbei darauf spezialisiert hatte, Ölbilder einzurahmen und zum Verkauf auszustellen. Diese Gemälde wurden ihr von berufsmäßigen Kunstmalern, aber auch Amateuren zugeliefert. Die Auswahl an Motiven war nicht eben groß. Da war die Oder und nochmals die Oder, dann gab es röhrende Hirsche und balzende Auerhähne im schlesischen Bergland und schließlich das Breslauer Rathaus und die Naschmarktseite des Ringes. Das alles interessierte August Borsig nur mäßig, ein Bild aber beschäftigte ihn Tag und Nacht und tauchte sogar in seinen Träumen auf: der Anblick eines Südsee-Atolls. Ein Schoner ankerte unter üppigen Palmen. Bougainville vor Tahiti stand auf dem Schildchen, das am Rahmen klebte.
»Palmen!«, rief Borsig. »Ich liebe Palmen über alles!«
»Dann kauf dir doch den Schinken, und häng ihn dir übers Bett«, riet ihm Walter Rawitsch.
»Das würde ich ja gern, aber was das kostet! Woher soll ich das Geld nehmen?« Von seinen Eltern bekam er kein Geld dafür, und sich das Palmenbild zum Geburtstag oder zu Weihnachten zu wünschen hatte auch keinen Zweck, da gab es zum Geschenk immer nützliche Sachen.
Nach einigem Hin und Her trauten sie sich in den Laden, um mit dem Glasermeister zu handeln, doch der ließ sich nicht erweichen und blieb bei einem Preis, der den Jungen astronomisch hoch erschien. Auch wenn er jeden Groschen sparte, den er ab und an von Meister Ihle und seinem Vater bekam, nachdem er ihnen bei der Arbeit geholfen hatte, er hätte lange Monate gebraucht, bis er das Bild hätte kaufen können – zu lange, denn bis dahin war bestimmt jemand gekommen und hatte es ihm weggeschnappt.
Wie konnte man als Junge zu Geld kommen? Sosehr er sich auch den Kopf darüber zerbrach, er fand keinen Weg … Bis sein Blick eines Tages, als er seinem Vater beim Bau eines Dachstuhls in der Berliner Straße geholfen hatte, auf einen Haufen abgesägter Sparren, Balken und Bretter gefallen war. Es war der ganze Abfall, den Meister Ihle irgendwann mit seinem Pferdefuhrwerk abholen ließ, um ihn hinten im Hof verrotten zu lassen. Wenn nun Walter und er diese Reste mit Beil und Säge zerkleinerten und den Leuten als Anmachholz verkauften, dann …
»Mensch, das ist die Idee!«, rief der Freund am nächsten Morgen, denn auch im Sommer brauchte man Kleinholz zum Feueranmachen. In jeder Küche stand ja ein Herd, auf dem sieben Tage in der Woche gekocht werden musste.
Sie machten sich ans Werk, und August Borsig hatte den richtigen Riecher gehabt: Sie nahmen so viel ein, dass er schon bald an den Kauf des Palmenbildes denken konnte.
»Das werde ich mir selbst zum Geburtstag schenken!«, rief er.
Doch bevor es so weit war, erschien der Polizei-Commissarius in der Neudorfstraße, um seinen Vater zur Rede zur stellen. »Der Rentier Chalupka aus der Berliner Straße bezichtigt Ihren Sohn des Holzdiebstahls.«
August hatte nicht bedacht, dass der Abfall strenggenommen nicht Meister Ihle oder seinem Vater gehörte, sondern dem Bauherrn, und der war kein großzügiger Mensch, sondern einer, der sich wegen jeder Kleinigkeit mit seinen Nachbarn stritt.
Der Vater, der von der Geschäftsidee seines Sohnes nichts gewusst hatte, sah ein, dass er am kürzeren Hebel saß, und ersetzte Chalupka den Schaden. Große Schelte gab es nicht, denn die Eltern fanden es gut, was ihr Sohn da versucht hatte – aber sein geliebtes Palmenbild, das konnte August nun für immer und ewig vergessen.
Sein dreizehnter Geburtstag am 23. Juni stand ins Haus. Als wäre seine Existenz nicht Beweis genug, zeigte ihm seine Mutter kurz vor diesem Tag den Taufschein.
Militaria
Ein Tausend acht hundert und vier (1804) den dreiundzwanzigsten Junius ist zu Breslau dem Cairassier im Regiment v. Dollfs bei der 4. Leib-Eskadron, Johann George Bursig von seiner Ehefrau Susanna geb. Werner, EIN SOHN geboren worden, welcher den sechsundzwanzigsten desselben Monats getauft worden ist und die Namen erhalten hat Johann Friedrich August.
Solches wird hierdurch aufgrund des Kirchenbuches obengenannten Regiments von Amts wegen attestiert.
S. G. Böhm, Garnisonspfarrer
August staunte, dass da nun noch eine weitere Variante seines Nachnamens zu finden war, nämlich Bursig. Wie auch immer – Borsig gefiel ihm am besten.
Als er am Morgen des 23. Juni seinen Geburtstagstisch sah, stieß er einen Jubelschrei aus, denn was mitten auf ihm prangte, war das heißbegehrte Palmenbild. Was er in diesem Augenblick fühlte, war das Urvertrauen in die Welt: Alles war gut, auch das, was noch kommen sollte, das Leben war ein großes Geschenk Gottes.
Zum Geburtstagskaffee kamen seine Tante Anna aus Trebnitz, sein Großvater George Burzik und sein Onkel Christian Borsig, beide aus Nieder-Pontwitz, sowie sein Freund Walter Rawitsch. Man sprach weithin »Schläsch«, sagte also nicht schmatzen, sondern katschen, Lorke zum dünnen Kaffee, Koochmannla zu den Pfifferlingen, Muppa statt Mund und Tschelotka für die Verwandtschaft.
Friedrich, der Onkel, führte das große Wort. Er hatte mit seinen 36 Jahren schon viel erlebt, war als Zimmermannsgeselle auf der Walz gewesen und durch halb Europa gezogen und hatte seine Militärzeit im Leib-Kürassier-Regiment Großer Kurfürst in Berlin verbracht. Sprach er von der preußischen Residenz, dann geriet er ins Schwärmen.
»Ich habe ja viele Städte gesehen, aber nichts geht mir über Berlin!«, rief er enthusiastisch. »Wie gern war ich Unter den Linden! Das Opernhaus ist das schönste der Welt, und daneben steht die Königliche Bibliothek. Und nicht zu vergessen das Schloss, das Cadettenhaus in der Neuen Friedrichstraße, den Gensdarmen-Markt, die vielen Kirchen, die vielen Theater … Alles unbeschreiblich!«
Er warf einen Blick auf das Geburtstagskind. Sein Neffe hatte ihm mit großen Augen zugehört. Nein, der August sollte um Gottes willen in Breslau bleiben, denn Berlin war nichts für ihn. Für die Residenz war er viel zu zach und zögerlich, da würde er nur untergehen und sich selbst ins Elend stürzen.
Kapitel zwei 1819
Meister Georg Ihle hatte schon so manchen Zimmermannslehrling unter seinen Fittichen gehabt, aber einem solch begabten Schüler wie August Borsig war er noch nie begegnet.
»Der Junge hat die Hände an der richtigen Stelle«, sagte er zu Hinke, seinem Polier. »Manche haben ja zwei linke Hände …«
»Kein Wunder«, brummte Hinke, »Sie wissen doch, das liegt dem Borsig im Blut … Der Großvater, der Vater, der Onkel – alles Zimmerleute.«
»Im Blut wird es weniger liegen, eher hat er sich alles bei seinem Vater abgesehen – und bei mir.«
»Nee, Meister, das ist der Instinkt bei dem. Entweder man hat’s, oder man hat’s nicht – und der Borsig hat es.«
Es war wirklich eine Freude, August zuzuschauen, wie unglaublich geschickt er mit Axt, Säge, Stemmeisen und Fuchsschwanz hantierte. Und alles, was neu war, erfasste er im Nu. Was er in Angriff nahm, gelang ihm, und nichts musste weggeworfen werden, egal, ob mit der Axt Balken zu behauen waren oder er Schrägen und Gehrungen zu sägen hatte. Und die Nuten und Zapfen, die mit dem haarscharf geschliffenen Stechbeitel herzustellen waren, passten immer. Auch wenn es galt, für einen Bauherrn etwas zu zeichnen, war er schnell bei der Hand und brachte etwas zu Papier, mit dem sich arbeiten ließ.
Auch Johann George Borsig waren die Talente seines ältesten Sohnes nicht entgangen. Bei jedem Besuch hatte er mit seinem Vater darüber gesprochen, der gänzlich seiner Meinung gewesen war. Noch auf dem Totenbett – gestorben war er am 22. März 1819 – hatte George Burzik in dem Gedanken Trost gefunden, dass sein Enkel in ihm weiterleben und mehr erreichen würde als alle anderen Burziks und Borsigs zuvor.
»Aber von nichts kommt nichts«, sagte Johann Borsig zu seiner Frau. »So begabt unser August auch ist, er hat mir zu wenig Träume.«
Susanna Borsig winkte ab. »Träume sind Schäume.«
»Ach, komm! Als ich so alt war wie er, da habe ich davon geträumt, nach Amerika zu segeln und dort in den Wäldern ein großes Sägewerk zu bauen.«
Seine Frau lachte. »Und wie weit bist du gekommen? Gerade mal bis Stettin.«
»Ich hatte ja auch nicht die Gaben, die August hat«, wandte Johann Borsig ein. »Aber aus ihm kann mehr werden als ein simpler Zimmermann.«
Seine Frau nickte. »Ja, natürlich, ein Meister wie Ihle mit einer kleinen Werkstatt.«
»Nein, mehr. Wenn ich mir ansehe, was er alles gezeichnet hat …« Er holte einen Stapel Blätter seines Sohnes aus dem Spind. »Schau dir das mal an, hier … Da hat er eine riesige Kuppel konstruiert – nur aus hölzernen Dreiecken, die aneinandergefügt sind.«
»Das würde doch alles gleich einstürzen. Kuppeln muss man doch aus steinernen Bögen bauen.«
»Aber wir sind nun mal Zimmerleute!«, rief Johann Borsig. »Und ich bewundere den Jungen. In dem steckt was Großes, das weiß ich.«
»Johann, das ist doch nichts weiter als dein Ehrgeiz. Du willst, dass er aufsteigt und Baumeister wird, am Hofe womöglich, nicht er. August kommt nach mir, und mir reicht das, was ich habe. August ist ein Fluss, der träge durch die Wiesen fließt, August ist kein stürmisches Meer.«
Johann Borsig seufzte. »Da magst du recht haben, dass er gar nicht weiß, was alles in ihm steckt, und von sich aus nichts tun wird, um etwas anderes zu werden als ein guter Zimmermann. Solchem Menschen wie ihm muss man auf die Sprünge helfen, das sind wir ihm als seine Eltern schuldig.«
»Und wenn er dadurch nur unglücklich wird?«, fragte Susanna Borsig.
»Er wird glücklich werden!«, rief Johann Borsig. »Und du weißt doch, der Volksmund hat immer recht: Wer nicht wagt, der nicht gewinnt.«
Zwei Tage nach diesem Gespräch, als man wegen des schlechten Wetters nicht arbeiten konnte, machte sich Johann Borsig auf zur Königlichen Provinzial-Kunst- und Bauhandwerksschule, um dort im Lehrerzimmer dem Hofrath Professor Bach und dem Regierungsarchitekten Hirt seinen Sohn August ans Herz zu legen.
»Als Zimmermann steckt er jetzt schon die meisten Gesellen in den Sack«, pries er ihnen August an. »Aber er hat auch noch ganz andere Talente, und die müssen hier bei Ihnen gefördert werden, denn der König braucht tüchtige Leute, soll Preußen vorankommen und nicht hinter anderen Ländern zurückstehen. Sehen Sie sich nur einmal seine Zeichnungen an! Ob das nun gewaltige Dachstühle, hölzerne Brücken oder Kuppeln sind.«
Hirt besah sich die Blätter. »Hm, das ist alles noch ziemlich kindlich, unbeholfen und unvollkommen …«
Johann Borsig hörte es mit einigem Schmerz, sein Gesicht hellte sich aber sofort wieder auf, als der Architekt hinzufügte, dass eine gewisse Begabung nicht zu übersehen sei.
Der Hofrath ließ sich die Zeichnungen reichen, setzte die Brille auf und studierte eine nach der anderen. Johann Borsig schlug das Herz so schnell und hart, dass er die rechte Hand auf die Brust pressen musste. Nicht nur das Schicksal seines Sohnes entschied sich in diesen Sekunden, auch seines.
»Nun denn, es sei«, brummte Bach. »Der Zimmerlehrling August Borsig möge am 14. April, wenn unser neues Semester beginnt, mit Skizzenheften und Zeichengerät bewaffnet durch unsere Tore schreiten. Er soll uns herzlich willkommen sein!«
»Im Sommer«, pflegte Meister Ihle zu seinen Lehrlingen zu sagen, »fangen wir Zimmerleute schon an zu arbeiten, bevor wir aufgestanden sind, und machen durch, bis es dunkel wird.«
So rasselte in August Borsigs Kammer jeden Morgen um vier Uhr der altertümliche Wecker, den er von seinem Großvater geschenkt bekommen hatte, manchmal weckte ihn auch der Hahn des Nachbarn, der beim Krähen immer irgendwie ins Stottern kam. Gerade brachen die ersten Sonnenstrahlen durch die Krone der Birke hinter ihrem Haus. Er wusch sich kurz unter der Pumpe im Hof, aß eine Schmalzstulle, trank ein Glas frisches Wasser und eilte zur Baustelle in der Gabitzstraße. Dort band er sich seine blaue Schürze um, griff zum Werkzeugkasten und kletterte, fröhlich pfeifend, Sprosse um Sprosse die steilen Leitern hinauf, die von einem zum anderen Stockwerk führten. Die Sonnenstrahlen tauchten die schon fertigen Sparren in ein wunderbares rötlich goldenes Licht. Breslau war so schön wie eine Stadt aus Tausendundeiner Nacht. Die Gesellen waren schon zur Stelle, und der erste Axthieb des Poliers war das Signal, mit der Arbeit zu beginnen. Borsig wurde angewiesen, einen Balken, der aufgrund eines Rechenfehlers um einiges zu kurz angeliefert worden war, mit ein paar Kunstkniffen zu verlängern, aber so, dass das Anstückeln dem Bauherrn nicht auffallen würde. Er krempelte die Ärmel hoch und beeilte sich, der Weisung nachzukommen.
Die Arbeit machte ihm Spaß, und er liebte es, mit eigenen Händen etwas zu schaffen, das nützlich war und Bestand hatte. Das war eine Erlösung von den Qualen, stundenlang still in der engen Schulbank zu sitzen und nichts zu erschaffen, was man anfassen konnte – einerseits. Andererseits aber war ein Tag wie der andere, und alles drehte sich irgendwie im Leeren. Dazu kam, dass er immer das tun musste, was andere von ihm verlangten, der Polier ebenso wie Ihle.
»Lehrjahre sind keine Herrenjahre«, sagte der Vater, als er ihm von seinen Bedrückungen berichtete. »Aber wer immer strebend sich bemüht, der kann es wohl schaffen, selbst einmal ein Herr zu werden.«
Ein wenig Abwechslung brachten die Bauherren, wenn sie mit besorgter Miene, unbeholfen und ängstlich die Leitern hochkletterten, um zu sehen, ob alles auch vorankam.
»Sagen Sie, Meister, mein Haus bekommt doch noch vor dem Winter sein Dach?«
»Aber ja!«, wurde ihm von Ihle versichert, und der Meister trieb seine Leute mit lauten Zurufen an, noch schneller zu arbeiten.
Nicht, dass die beiden Gesellen besonders derbe Menschen waren – aber das meiste, was sie miteinander besprachen, drehte sich um das andere Geschlecht. Mit welchem Mädchen sie gerade angebandelt hatten, welche Frau zu haben war und bei welcher sie garantiert auf Granit bissen. August Borsig hatte diesem Thema bisher wenig Beachtung geschenkt, denn wie junge Mädchen an sich waren – zwar hübsch anzusehen, aber immer schnippisch und zickig –, das wusste er von seiner Schwester Susanne, und seine Neugierde hielt sich in Grenzen. Wie Frauen »untenherum« gebaut waren, konnte er sich vorstellen, denn er hatte seine jüngeren Schwestern oft genug in den Badezuber steigen sehen, doch wie eine erwachsene Frau nackt aussah, das wusste er nicht. Sah er hübsche Mädchen oder Frauen auf der Straße, suchte er sich immer vorzustellen, wie sie denn ohne Rock und Mieder aussehen würden. So auch bei Henriette, der vielleicht achtzehnjährigen Tochter des Drechslers in der Gabitzstraße, die er von seiner Baustelle aus jeden Tag beobachtete. Der Mann war Ackerbürger und hielt sich Kuh und Schwein, so dass es für die Schöne immer etwas zu tun gab.