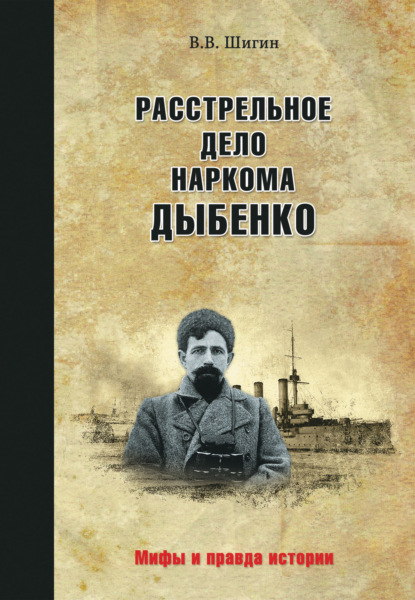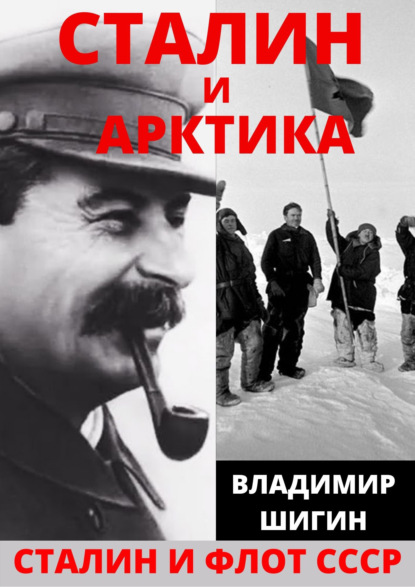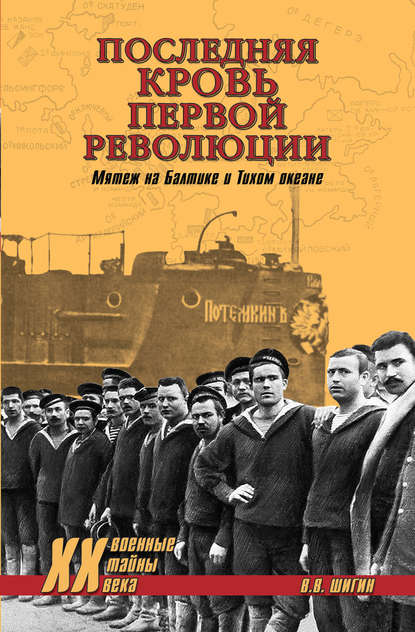- -
- 100%
- +
Eines Morgens nun war er als Erster oben auf dem Dach und nutzte die Gelegenheit, die Spanten des halbfertigen Dachstuhls nach oben zu klettern, um einen Blick in ihre Kammer erhaschen zu können. Aber es sollte noch viel, viel besser kommen, denn im Innenhof stand eine Wasserpumpe … Und zu der ging nun Henriette – und zwar splitterfasernackt …
August beugte sich weit nach vorn … zu weit. Seine wild rudernden Hände fanden keinen Halt mehr, er stürzte in die Tiefe.
Im Fallen hörte er noch die Wahrsagerin murmeln: »Mit einem Schlag kann alles aus sein.«
Am 21. Juli 1819 schuf Friedrich Wilhelm III. per Kabinettsorder ein Amt, das mit seiner Arbeit das Gewerbe und vor allem die Industrie in Preußen aufblühen lassen sollte: die Technische Deputation für Gewerbe. Sie ging zurück auf eine Initiative von Christian Peter Wilhelm Beuth und sollte sein Instrument werden, Preußen voranzubringen und den Rückstand, den man England gegenüber hatte, wirksam zu verringern.
Beuth war am 28. Dezember 1781 in Kleve zur Welt gekommen, der Stadt am Niederrhein, die seit 1815 wieder zu Preußen gehörte. Als Sohn eines Arztes hatte er beste Bedingungen für eine große Karriere, begann 1798 an der Universität Halle/Saale ein Studium der Rechte und Kameralwissenschaften, um 1801 in den preußischen Staatsdienst einzutreten. 1806 wurde er Assessor in Bayreuth, 1809 Regierungsrath in Potsdam und 1810 Geheimer Obersteuerrath im Finanzministerium zu Berlin. Als es dann darum ging, die französische Fremdherrschaft abzuschütteln, war er ins Lützow’sche Freikorps eingetreten – eine bessere Adresse gab es nicht – und als Reiter durch Deutschland, Belgien und Frankreich gezogen. Eine feindliche Kugel hatte ihn niedergeworfen, doch er hatte überlebt und war mit dem Eisernen Kreuz II. Klasse ausgezeichnet worden. Als sich Preußen daranmachte, Lehren aus der Niederlage gegen Napoleon zu ziehen und das Land zu modernisieren, saß er im Büro des Staatskanzlers Karl August von Hardenberg und war Mitglied der Commission für die Steuerreform und für die Reform des Gewerbewesens.
Nun war er, ewig ruhelos, Director der Technischen Deputation für Gewerbe geworden und streifte täglich in seinem altväterlichen blauen Überrock und mit der Soldatenmütze des alten Freiheitskämpfers auf dem Kopf durch die Berliner Straßen, um sich selbst ein Bild davon zu machen, was in den Werkstätten der Residenz geschah. Es reichte ihm nicht, in der Kanzlei zu sitzen und etwas anzuordnen, er musste mit den Männern reden, die an den Ambossen und Werkbänken standen. Wen er für wichtig hielt, den lud er in seine Wohnung in der Klosterstraße ein. Zu diesem Zweck führte er immer kleine Kärtchen bei sich: Wenn ein Mittagessen im Überrock und ohne Ansprüche Ihnen recht ist, so bitte ich Sie, sich am Sonntag, dem … gegen zwei Uhr bei mir einzufinden.
Einer dieser Gäste war auch Franz Anton Egells, geboren am 25. August 1788 im westfälischen Rheine und von Hause aus Kupferschmied. Nachdem sein Versuch, im westfälischen Gravenhorst Dampfmaschinen zu bauen, gescheitert war, war er nach Berlin gekommen und hatte in der Königlich Preußischen Eisengießerei zu Berlin, die im Winkel zwischen Panke und Invalidenstraße gelegen war, als Abteilungsleiter gearbeitet und den Guss von Denkmälern und anderen Kunstwerken überwacht. Er sah sich immer als Mechaniskus und schaffte es, mit der Verbesserung einer Druckluftwaffe, einer sogenannten Windbüchse, Beuth auf sich aufmerksam zu machen. Der hatte ihn dann nach England geschickt, um sich in den englischen Maschinenbau-Anstalten umzusehen. Die waren damals der Nabel der industriellen Welt, und Beuth hatte bei dieser frühen Form der Industriespionage keine Skrupel, hing er doch auch der allgemeinen Maxime an, dass man mit den Augen stehlen dürfe.
Nun war Egells zurück und erstattete Bericht. Was das Gießen von Eisen betraf, da habe man den Engländern gegenüber schon beträchtlich aufgeholt, aber im Hinblick auf die Lokomotiven hinke man ihnen noch erheblich hinterher.
»Schon 1813 hat ein gewisser William Hedley seine Puffing Billy für die Wylam-Zeche konstruiert, und die hat sich so gut bewährt, dass man mittlerweile schon mehrere Lokomotiven dieses Typs gebaut hat. Angeblich soll es schon 1804 eine funktionstüchtige Lokomotive gegeben haben, die war aber zu schwer für die gusseisernen Schienen einer Pferdebahn. Im Augenblick redet alles von George Stephenson, der ausgezeichnete Lokomotiven für die Kohlengruben bei Darlington gebaut hat.«
»Ach ja!« Beuth stieß einen tiefen Seufzer aus. »Während wir gerade mal gelernt haben, vernünftige Dampfmaschinen zu bauen, haben die Engländer längst Dampfmaschinen auf Schienen gesetzt. Und mit diesen Lokomotiven und den vielen angehängten Loren können sie im Handumdrehen ihre Waren an die Küste transportieren und dort auf ihre Dampfschiffe laden, um die Welt mit ihren Produkten zu überschwemmen.« Er richtete die Augen gen Himmel. »Der Herr schenke uns ein Genie, damit wir ihren Vorsprung endlich aufholen können!«
»Wir können das Rad nicht neu erfinden – uns bleibt derzeit nichts anderes übrig, als das englische Rad zu kopieren.«
Beuth stöhnte auf, und Egells tat es ihm nach, denn beide wussten, dass das Kopieren englischer Maschinen auch schiefgehen konnte. So hatte das Brandenburgische Oberbergamt 1814 zwei seiner Beamten, den Oberbergrath Ernst Philipp Ferdinand Eckardt und Johann Friedrich Krigar, den Hütteninspector der Königlich Preußischen Eisengießerei zu Berlin, nach England geschickt, um die dort in Betrieb befindlichen Lokomotiven zu studieren. Sie waren ein Jahr später nach Berlin zurückgekehrt und hatten Pläne des Lokomotivbauers John Blenkinsop mitgebracht. Dabei handelte es sich um eine Zahnradmaschine, da man der Meinung war, der Adhäsionsantrieb sei unzureichend. Die Zahnschiene war nicht zwischen den Gleisen angebracht, sondern neben ihnen. Auf dem Gelände an der Panke entstand nun in den Jahren 1815 und 1816 unter der Leitung Krigars die erste Lokomotive des Blenkinsop-Typs, wenn auch etwas kleiner. Obwohl dieser erste Dampfwagen, wie man in Preußen sagte, in der Minute lediglich fünfzig Meter zurücklegen konnte und nur wenig Zugkraft hatte, wurde er wieder zerlegt und – in fünfzehn Kisten verpackt – auf dem Wasserwege nach Königshütte gebracht, um die Kohlezüge des Bergwerks »Königsgrube« zu ziehen. Leider musste man an Ort und Stelle erkennen, dass die Spurweite der Lokomotive nicht der des vorhandenen Schienenstrangs entsprach und außerdem Kessel und Zylinder nicht dicht waren …
Nach diesem Fiasko war in Berlin eine zweite Lokomotive gebaut und auf dem Seeweg über Amsterdam ins Saarrevier transportiert worden. Am 5. Februar 1819 war sie in Geislautern eingetroffen, um auf einer 2,5 Kilometer langen Versuchsstrecke, dem Friederiken-Schienenweg, ausprobiert zu werden.
»Wir müssen unbedingt nach Geislautern, um zu retten, was zu retten ist«, sagte Beuth.
»Sehr wohl«, sagte Egells und überschlug im Kopf, wie weit es von Berlin nach Völklingen sein würde, der ersten größeren Stadt in der Nähe der Versuchsstrecke. »Ich schätze, bis dahin sind es ungefähr hundert Meilen, und da unsere Postkutschen nur wenig mehr als eine Meile in der Stunde schaffen, werden wir eine ganze Weile unterwegs sein.«
»Dennoch, was sein muss, muss sein.«
Sie machten sich also auf den Weg, doch als sie in Geislautern ankamen, mussten sie feststellen, dass es nicht gelang, die Maschine überhaupt in Bewegung zu setzen. Weder in der ersten noch in der zweiten oder der dritten Woche.
Auf dem Lehrplan standen Zeichnen und Perspektive, Kenntnisse in Grundriss und Aufriss, Planen und Entwerfen und Blick für die Bauten des Altertums und seiner Zeit. Den Schülern der Königlichen Provinzial-Kunst- und Bauhandwerksschule in Breslau wurde also einiges abverlangt, zumal sie gleichzeitig auch bei ihrem Lehrherrn die praktische Arbeit zu verrichten hatten – wobei allerdings der Unterricht in der Hauptsache in den Monaten stattfand, in denen auf den Baustellen nicht viel zu tun war. Langsam gewöhnten sich die kräftigen Handwerkerhände daran, mit dem Bleistift feine Linien auf das gelbliche Papier des Zeichenheftes zu ziehen und zu begreifen, dass die Rechtecke und Quadrate, die man zeichnete, Zimmer und Stuben meinten und sich am Ende zu einem Haus summierten. Aus dem Grundriss wuchs das Werk nach oben, ganz wie in der Wirklichkeit – nur viel schneller und müheloser. Es musste radiert werden, um Türen und Fenstern ihren Platz zuzuweisen.
»Borsig, was du da an Sparren und Pfetten zum Dachstuhl auftürmst, das passt auf den Turmbau zu Babel, aber nicht auf das Wohnhaus eines reich gewordenen Oderschiffers!«, rief Bauinspector Hirt, als er einen Blick auf Augusts Zeichenblatt geworfen hatte. »Und deine Schlangenlinien sind ja fürchterlich!«
Dass August Borsig nur mit Mühe eine gerade Linie zeichnen konnte, lag an seinen immer noch schmerzenden Handgelenken. Die hatte er sich beim Sturz vom Dach verstaucht. Es hätte aber noch alles viel übler ausgehen können, wenn er nicht in einen Misthaufen gefallen wäre. Henriette war zwar schreiend ins Haus gelaufen, als er dicht neben ihr gelandet war, Ihles Gesellen hatten aber schnell mitbekommen, weshalb er in die Tiefe gestürzt war, und hatten nun etwas zum Lästern. Es sei schon etwas ganz Besonderes, mit seiner Liebsten nicht ins Heu oder ins Bett zu gehen, sondern in einen Misthaufen. Harmlos war noch der Reim: Liegt unser August drin im Mist,/ändert sich’s Wetter, oder es bleibt, wie es ist. Nun, er nahm es mit Humor, hätte sich aber doch lieber als tapferen Helden gesehen anstatt als dummen August.
Das Planen und Entwerfen biederer rechteckiger Bürgerhäuser begann ihn bald zu langweilen, und er hätte die Königliche Handwerkerschule verflucht, wenn die Lehrer nicht einen Hang zum Höheren gehabt hätten und das ernst nahmen, was die Buchstaben über dem Eingang verkündeten, nämlich dass hier auch Kunst vermittelt werde. So legte man den Schülern Zeichnungen der griechischen und italienischen Altertümer vor und brachte sie dahin, die Feinheiten einer kannelierten Säule in all ihren Licht- und Schattenwirkungen zu verstehen. Und man machte auch Exkursionen zu den herausragenden Bauwerken Breslaus.
»Obwohl er 1732 in Landeshut geboren worden ist, möchte ich auch Carl Gotthard Langhans zu den Breslauer Künstlern rechnen«, erklärte Hirt. »Warum? Weil er ab 1782 mit seiner Familie das schwiegerelterliche Haus in der Albrechtstraße 18 bewohnt hat und am 1. Oktober 1808 in Grüneiche bei Breslau gestorben ist.« Er blickte in die Klasse. »Und was ist sein berühmtestes Bauwerk?«
Nur einer hob den Arm.
»Ja, Borsig …«
»Das Brandenburger Thor in Berlin.«
»Richtig, sehr gut. Und sein Sohn Carl Ferdinand, hier bei uns in Breslau geboren am 14. Januar 1782, tritt nun in die Fußstapfen seines berühmten Vaters.«
Man zog durch die Stadt, um sich alles anzusehen, was es an architektonischen Prachtstücken gab – angefangen bei der gotischen Sandkirche, die zwischen 1334 und 1440 entstanden war, bis zur Universität und dem Königsschloss aus dem Rokoko –, und hörte sich die Erläuterungen des Lehrers an.
»Wozu brauchen wir ’n das alles?«, fragte leicht maulend ein Klassenkamerad, dem schon bald die Füße weh taten.
Bei Meister Ihle hatte ein Zimmermann angeheuert, Georg Guttentag, der in seinen Wanderjahren auch durch England gezogen war, und als der Polier in der Frühstückspause erzählte, wie sich der Dampfwagen der Königlichen Eisengießerei in Geislautern keinen Fingerbreit von der Stelle bewegt hatte, da lachte er nur.
»Gott, vor elf Jahren war ich in London, und da hat einer … wie hieß er noch mal … Trevithick, ja, Richard Trevithick hat eine Lok mit ein paar Waggons dran immer im Kreis herumfahren lassen, wie im Zirkus. Ihr Name war Catch me who can – was aber keiner geschafft hat.« Er versuchte, ihre Umrisse im lockeren Sand nachzuzeichnen.
»Das verstehe ich nicht«, sagte August Borsig, der die riesige Dampfmaschine auf der Tarnowitzer Grube vor Augen hatte. »Der Kolben im Zylinder geht doch immer senkrecht auf und ab – der Dampfwagen aber rollt doch in der Waagerechten, oder?«
Der Geselle wusste es auch nicht so ganz genau. »Das Ding hatte jedenfalls kein Schwungrad, sondern einen stehenden Zylinder, und der muss über eine Kurbelstange direkt auf die Triebräder gewirkt haben.«
»Was Menschengeist so vermag«, sagte der Polier.
Der Geselle lachte. »Ja, und trotzdem ist Trevithicks Lokomotive eines Tages entgleist und umgestürzt, so dass sich keiner mehr für sie interessiert hat.«
Sie konnten sich nicht länger diesem Thema widmen, denn Meister Ihle erschien in diesem Augenblick und klatschte in die Hände. »Ans Werk, die Herren, von nichts kommt nichts!«
Alle sprangen nun auf, um wieder auf das Dach zu steigen. August Borsig aber wurde vom Meister zurückgehalten.
»Du eilst jetzt zum Schmied Witschel und holst mir ein paar Eisenklammern. Die müssten bald fertig sein.«
Als August Borsig in der Tür der Werkstatt stand, erstarrte er. Es war etwas Archaisches, das er da sah: Der Schmied war Gott, und er stand an einem gewaltigen Vulkan, um die Welt aus glühendem Eisen zu erschaffen. Funken sprühten auf, als er das erhitzte Werkstück mit einer langen Zange aus der Esse zog und zum Amboss trug. Dort stand ein Lehrling mit dem Schmiedehammer, der dem Eisen die Form geben sollte, die Ihle gewünscht hatte. Borsig beneidete diesen Lehrling, und er dachte in diesem Augenblick, dass er viel lieber Schmied geworden wäre als Zimmermann. Aus einer gestaltlosen Masse etwas zu formen, das war das Eigentliche. Man schmiedete das Eisen, das Schicksal, die Zukunft. Das war es, was er wollte: Schmied sein, sich als Schmied fühlen.
»Na, Junge, was treibt dich her?«
Borsig hörte die Stimme des Schmieds wie aus weiter Ferne und brauchte Sekunden, um zu sagen, dass er im Auftrag Ihles gekommen war.
»Der Friedrich ist gleich mit allem fertig.«
Borsig kam mit Friedrich Hermes ins Gespräch, und sie sollten für lange Jahre Freunde werden.
Nachdenklich trug August Borsig die fertigen Teile zur Baustelle. Ein dumpfes Gefühl des Unbehagens und der Enttäuschung erfüllte ihn: Er hatte den falschen Beruf ergriffen.
Kapitel drei 1823
Christian Peter Beuth hatte auch nach dem Fiasko von Geislautern und weiteren Fehlschlägen keine Sekunde daran gedacht zu kapitulieren. Ihm war aber bewusst geworden, dass es nicht ausreichte, die Maschinen und Lokomotiven der Engländer einfach abzuzeichnen und die Pläne nach Preußen zu bringen. Man brauchte auch Männer dafür, Techniker und Handwerker, die in der Lage waren, nach den mitgebrachten Zeichnungen und Skizzen funktionsfähige Maschinen zu bauen. Da kam es manchmal auf Bruchteile von Millimetern an. Aber man musste auch das Wesen einer Maschine verstehen und sie lieben wie seinen eigenen Hund, zu ihr sprechen, sie streicheln und ihr gut zureden, wenn sie nicht anspringen wollte. Und solche Männer gab es in Preußen nicht, Männer, die er Maschinenärzte genannt hätte, wenn er dafür nicht verspottet worden wäre. Dieser James Watt, dem sie die Erfindung der Dampfmaschine zuschrieben, musste ähnlich gedacht haben, als ihm die Idee gekommen war, die Pferdestärke als Maßeinheit für die Leistung einer Dampfmaschine zu wählen. Auch an Fabrikanten mit den nötigen Kenntnissen, mit Weitblick und Wagemut fehlte es. Das alles war nicht weiter erstaunlich, denn alle hatten sich an den langjährigen Protektionismus ihres Staates gewöhnt.
Beuth fasste sich an den Kopf. Da hatte man in den preußischen Universitäten und in Kreisen jüngerer Beamter dem freien Wettbewerb und freien Handel das Wort geredet und dabei übersehen, dass der Rückstand der einheimischen Gewerbetreibenden viel zu groß gewesen war und nun die Engländer mit ihren Waren ungebremst den ganzen Kontinent überschwemmten. Der Schuss war also gründlich nach hinten losgegangen …
Doch Beuth hatte weder resigniert noch die missliche Situation schöngeredet – er hatte gehandelt: Nachdem ihm 1820 die Zuständigkeit für das Gewerbeschulwesen übertragen worden war, hatte er am 1. November 1821 im Gebäude seiner Technischen Deputation in der Klosterstraße 36 eine zweiklassige Gewerbeschule mit zunächst dreizehn Schülern und vier Lehrern eröffnet. Deutlich grenzte er sein Technisches Institut von dem Lehrbetrieb an den Universitäten ab: Wer mehr lernen will, tut es auf der Universität. Dieses Mehr schließe ich von der Technischen Schule aus, weil ich es mehr für eine Zierde als von wesentlichem Einfluß auf das Gedeihen der Gewerbe und ihre Blüte halte. Sein Institut sollte allen Bevölkerungsschichten offenstehen, und zur Aufnahme in die untere Klasse genügten anfangs eine gute Handschrift, die Fähigkeit, dem mündlichen Vortrage zu folgen und das Vorgetragene sprachlich auszuarbeiten, sowie das gewöhnliche Rechnen. Für die obere Klasse wurden vorausgesetzt: Kenntniß der Geometrie (Planimetrie und Stereometrie) ohne Beweise, Kenntniß der gemeinen Arithmetik, des Gebrauchs der Logarithmen, Elementarkenntniß in der Physik und Chemie, Handzeichnen nach aufgestellten Körpern, Maschinenzeichnen nach eigener Aufnahme und geometrische Darstellung.
Das Ganze gedieh prächtig, doch Beuth wollte sich mit dem Erreichten nicht zufriedengeben. Im Gebäude der Technischen Deputation, dem ehemaligen Palais Kreutz, wollte er eine Maschinensammlung, eine Modellsammlung und eine Sammlung fertiger Produkte anlegen, und sogar einen Anbau plante er. Auch ein anderes Projekt, das er gemeinsam mit seinem Freund Karl Friedrich Schinkel angefangen hatte, trieb er kräftig voran.
Schinkel, geboren am 13. März 1781 in Neuruppin, war 1805 von seiner zweiten Italienreise nach Berlin zurückgekommen und hatte 1810 durch Vermittlung Wilhelm von Humboldts eine feste Anstellung gefunden. 1815 war er zum Geheimen Oberbaurath ernannt worden und hatte begonnen, Berlin mit den von ihm erdachten Bauten zu einer europäischen Metropole zu machen, allen voran mit der Königswache, dem Schauspielhaus und dem Königlichen Museum. Er wohnte jetzt mit seiner Familie Unter den Linden 4a und kam gern einmal in die Klosterstraße.
Beuth sprang auf, als Schinkel eingetreten war, und eilte dem Freund entgegen, um ihn herzlich zu umarmen. Beide gaben die Vorbilder für Fabrikanten und Handwerker heraus, eine aufwendig gestaltete Sammlung von vorwiegend antiken Formen und Mustern, an denen sich die Gewerbeschulen wie die Fabrikanten orientieren sollten. Gebrauchsgegenstände sollten nicht nur nützlich, sondern auch schön sein und den Aufstieg der preußischen Industrie befördern.
»Was gibt es Neues?«, fragte Beuth.
Schinkel überlegte einen Augenblick. »Unser Kronprinz Friedrich Wilhelm wird im November seine bayerische Elisabeth zum Traualtar führen, und er wird zur Hochzeit Schloss Stolzenfels am Rhein geschenkt bekommen.«
»Und was hast du damit zu schaffen?«
»Ich soll die Pläne zum Umbau entwerfen.«
Beuth verzog das Gesicht. »Schade, ich sähe es lieber, wenn du dich ganz um Berlin kümmern würdest.«
Schinkel lachte. »Deine Gewerbeschule hier wird doch in Bälde so viele große Köpfe hervorbringen, dass Leute wie ich schnell entbehrlich werden.«
»Dein Wort in Gottes Ohr!«
Als August Borsig am letzten Sonntag im Februar am Ring stand und auf seinen neuen Freund Friedrich Hermes wartete, lief ihm sein alter Klassenkamerad Walter Rawitsch über den Weg. Sie hatten sich ein wenig aus den Augen verloren, dennoch begrüßten sie sich mit einigem Hallo. Beide standen kurz vor ihrer Gesellenprüfung, Walter als Tischler, August als Zimmermann.
»Wir machen also beide unser Glück mit dem Holz«, sagte Walter Rawitsch.
Borsig winkte ab. »Ich bin über meinen Beruf gar nicht mehr so glücklich …«
Walter Rawitsch lachte. »Bist du also sozusagen auf dem Holzweg?«
»Eher in einer Sackgasse.«
»Besser in einer Sackgasse als auf einem Misthaufen.« Walter Rawitsch war immer noch der Alte. »Aber mit der schönen Henriette ist es trotz deines Opfers nichts geworden?«
»Leider nein. Oder Gott sei Dank – ganz wie man will.«
Walter Rawitsch kam ihm mit einer alten Volksweisheit: »Früh gefreit, hat nie gereut.«
»Wir haben ja noch unsere Walz vor uns. Wer weiß, wen ich da kennenlerne …«
Die Walz galt als Voraussetzung, um von der Zunft in den Meisterstand aufgenommen zu werden. Wenn ein Lehrling aus der Lehrzeit entlassen wurde, ging er als Geselle für ein bis drei Jahre, manchmal sogar noch länger, auf Reisen. Als »er-fahrener« und »be-wanderter« Mann sollte er nach abgeschlossener Wanderschaft in die Heimatstadt zurückkehren.
»Wohin treibt es dich denn?«, fragte Walter Rawitsch.
Borsig zuckte mit den Schultern. »Keine Ahnung. Irgendwie habe ich zu nichts mehr richtig Lust. Ein Leben lang nur Zimmermann sein … Ich weiß nicht …«
»Das erinnert mich an Goethes Die Leiden des jungen Werther.« Über diesen Roman hatten sie in der Schule eingehend gesprochen, und Mistek hatte den Gedanken an einen Selbstmord als zutiefst unchristlich und unpreußisch verdammt.
August Borsig winkte ab. »Das nicht, aber …« Ein Vergleich kam ihm in den Sinn. »Manchmal sehe ich mich als Kugel, die Gott auf die Kegelbahn gerollt hat. Ich möchte meinen Lauf gerne ändern, kann es aber nicht. Ich rolle und rolle …«
»Und am Ende deines Lebens heißt es dann: Volltreffer, alle Neune!«
»Oder aber die Kugel rollt von der Bahn und alle schreien: Eine Ratte!«
Nach diesem Gespräch verbrachten sie noch einen sehr angenehmen Tag miteinander, und als sie am Abend adieu sagten, verabredeten sie, sich von nun an öfter zu treffen.
Daraus aber sollte nichts mehr werden, denn am Donnerstag bekam August Borsig die Nachricht, dass Walter Rawitsch bei einem Unfall ums Leben gekommen war. Gemeinsam mit seinem Meister hatte er ein Sägewerk besichtigt, und dabei waren aufeinandergeschichtete Baumstämme ins Rollen gekommen und hatten ihm den Brustkorb zerquetscht. August Borsig trauerte lange um den Freund, und immer wieder musste er an dessen Worte denken: »Wir machen also beide unser Glück mit dem Holz.« Von wegen! Walter Rawitsch hatte das Holz den Tod gebracht, und August fragte sich, ob das ein Wink des Schicksals war, er selbst solle einen anderen Weg nehmen. Aber welchen denn? Die Kugel, die rollte unaufhaltsam … Bei aller Trauer kam ab und an ein Gefühl in ihm auf, dessen er sich furchtbar schämte, das er aber nicht ganz unterdrücken konnte: Gott sei Dank hat es ihn getroffen – und nicht mich! Wer weiß, was der Himmel mit mir noch vorhat? Aber was sollte er schon vorhaben? Zimmermeister zu Breslau würde er werden.
Nun, die erste Etappe auf diesem Weg hatte er am 12. März 1823 zurückgelegt. Da stand er im schwarzen Feiertagsanzug im Festsaal der Innung und bekam den Lehrbrief überreicht. Schnell überflog er die verschnörkelten Buchstaben. Die Alt- und Gildemeister des löblichen Zimmermittels der Haupt- und Residenzstadt Breslau bestätigten ihm, dass er vom Quartal Reminiscere 1820 bis Reminiscere 1823 die Zimmer-Profession bei dem Zimmermeister Georg Ihle gehörig erlernt habe.
Ihle schüttelte ihm zuerst die Hand und war sichtlich gerührt, dann gratulierten ihm auch die Eltern und sein Freund Friedrich Hermes.
Der Zimmermeister Caspar Kiesewetter, einer von den Alt- und Gildemeistern, hatte bei der Freisprechung alle Lehrlinge aufmerksam gemustert, dann hatte er August Borsig freundlich zugenickt und ihn zu sich herangewinkt. »Borsig, Sie gefallen mir von allen am besten, und ich würde mich freuen, wenn ich Sie als meinen Gesellen begrüßen dürfte.«
Was blieb August Borsig da anderes übrig, als sich artig zu bedanken? Aber dass jähe Freude in ihm aufschoss, ließ sich nicht behaupten. Die Kugel, die rollte unaufhaltsam … Offenbar kam alles so, wie es kommen musste.
Das Leben eines Zimmergesellen unterschied sich von dem eines Zimmerlehrlings nicht wesentlich. August Borsig führte immer noch das gleiche Leben. Ein bisschen mehr Rechte kamen ihm zu, und die Arbeiten, die er auszuführen hatte, waren etwas anspruchsvoller, aber der Polier und der Meister konnten ihm weiterhin Anweisungen geben, wie sie wollten – und ihn tadeln, wenn sie es für richtig hielten. Sein eigener Herr war er nun weiß Gott noch immer nicht. Und das lastete ebenso auf ihm wie das Wissen, dass er das Holz nicht mehr liebte, sondern es mehr und mehr verachtete, weil es ein zu simpler Werkstoff war. Man ging ganz einfach in den Wald und fällte einen Baum, dann hatte man es. Wie anders dagegen das Eisen! Wie viel menschlicher Geist und wie viel handwerkliches Geschick waren vonnöten, aus Erz Eisen zu gewinnen!