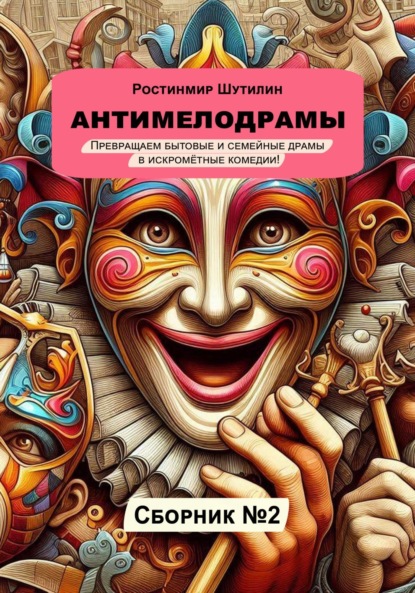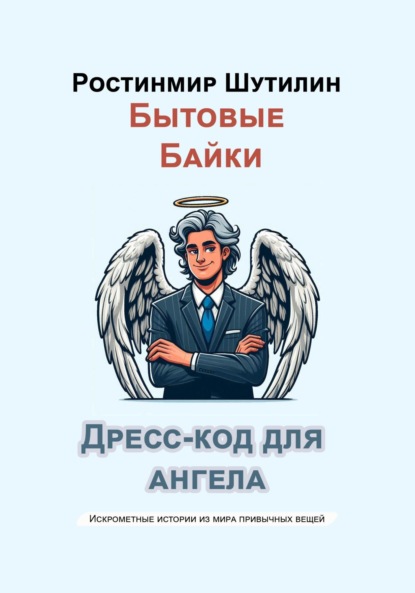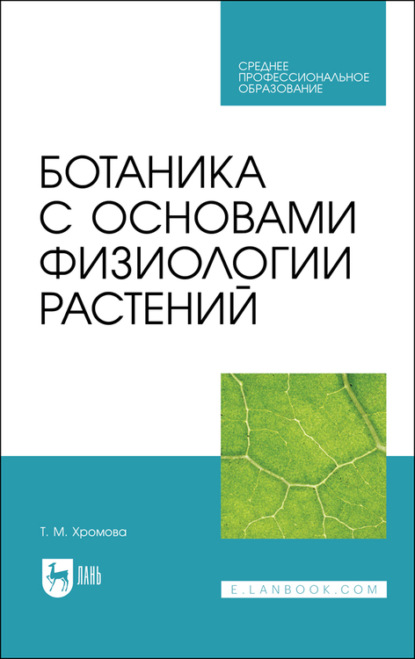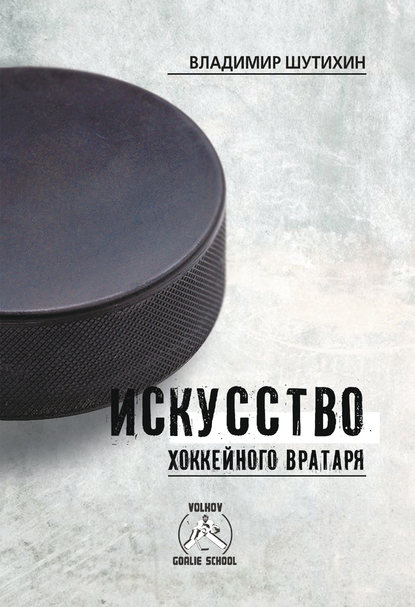- -
- 100%
- +
Friedrich Hermes fand, dass er richtig schwermütig geworden war.
»Du hast gut reden!«, rief Borsig. »Du bist ja Schmied und hast das Eisen als Material. Holz, das ist das Mittelalter – Eisen, das ist die moderne Zeit!«
Friedrich Hermes versuchte sich als Philosoph: »Ein Pferd kann keine Kuh werden – und eine Kuh kein Pferd.«
August Borsig stöhnte auf. Keiner verstand ihn so richtig. Aber wie denn auch, er selbst schaffte es ja auch nicht. Sein verstorbener Freund Walter Rawitsch hätte gesagt: »Der August Borsig ist jetzt bei den Stadtmusikern. – Wie denn das? – Er bläst. – Trompete oder Tuba? – Nein, Trübsal.«
Das Ende der Tristesse kam schlagartig, als er Marie erblickte, die Tochter seines neuen Meisters. Sie war für ein paar Wochen in Liegnitz gewesen, um ihre kranke Großmutter zu pflegen.
Er war jetzt neunzehn Jahre alt, sie mochte etwas jünger sein, und von daher passten sie zusammen. Vielleicht war sie etwas drall, aber das fand er sehr verführerisch, und sie hatte ein liebes rundes Gesicht. Es musste unwillkürlich an die Kolportageromane denken, die langsam in Mode kamen: Tüchtiger Geselle heiratet liebliche Tochter seines Meister, übernimmt später dessen Geschäft, und alle werden froh und glücklich. Märchen, die wahr wurden. Auch Maria schien Feuer gefangen zu haben, denn hatte sie ihn anfangs unschuldig angelächelt, so zuckte sie jetzt, wenn sich ihre Blicke trafen, und ihre Wangen wurden von einer verräterischen Röte überzogen. Und er hatte seine Schwierigkeiten, sich abrupt zu erheben, wenn er sie heimlich angestarrt hatte, denn die Aufwölbung seines Hosenlatzes wäre zu peinlich gewesen. Ab und an saßen der Lehrling und die Gesellen im Hause des Meisters und mit dessen Familie am Mittagstisch, und das waren dann wahre Festtage für August Borsig. Näher aber kam er Marie Kiesewetter nicht.
»Du musst ihr einen Liebesbrief schreiben«, riet ihm sein Freund Friedrich Hermes, als er dem seine Nöte geschildert hatte. »Am besten mit einem Gedicht. Die Frauen lieben so etwas und sind dann ganz gerührt.«
»Das kann ich nicht.«
»Dann machen wir das gemeinsam. Meine ältere Schwester ist mit der Feder so gewandt wie mit der Nähnadel. Außerdem hat sie ein paar von Goethes Gedichten im Poesie-Album stehen.«
So kam dann mit Hilfe von Katharina Hermes Borsigs erster Liebesbrief zustande, veredelt mit den ersten und den letzten Zeilen des Goethe-Gedichtes Nähe des Geliebten:
Ich denke dein, wenn mir der Sonne Schimmer
Vom Meere strahlt;
Ich denke dein, wenn sich des Mondes Flimmer
In Quellen malt.
Ich bin bei dir, du seist auch noch so ferne,
Du bist mir nah!
Die Sonne sinkt, bald leuchten mir die Sterne.
O wärst du da!
Nun war es zwar schwer, von Breslau aus aufs Meer zu blicken, aber das Brieflein tat dennoch seine Wirkung, denn als August Borsig einen Tag später vom Abtritt kam und Marie, die in die Küche wollte, in die Arme lief, fuhr sie nicht etwa erschrocken zurück, sondern umschlang ihn, so dass es geradezu unmöglich war, sie nicht zu küssen. Die Welt um ihn herum versank, und er sagte später, er könnte schwören, stundenlang in enger Umarmung mit ihr im Flur gestanden zu haben. In Wahrheit aber waren es nur Sekunden, denn da tauchte auch schon Kiesewetter auf und trieb sie mit einem harschen »Was soll denn das?!« schnell wieder auseinander.
Der nächste Tag – es war der 22. September 1823 – sollte August Borsigs letzter an der Königlichen Provinzial-Kunst- und Bauhandwerksschule werden. Mit ungewissen Gefühlen, ebenso erleichtert darüber, dass alles vorbei war, wie enttäuscht darüber, dass nun schon alles vorbei war, hockten sie in ihren Bänken und warteten darauf aufgerufen zu werden. Hier wusste man, was einen erwartete, doch die Zukunft war ungewiss, und ob alle Blütenträume reiften, war fraglich, denn Preußen war noch nicht so weit – so schien es ihnen jedenfalls –, dass man sie mit ihrer hohen Qualifikation draußen im Lande wirklich gebraucht hätte.
»Borsig!«
Wie in Trance erhob er sich und schritt nach vorn. Der Bauinspector Hirt nahm sein Abgangszeugnis aus einem blauen Aktendeckel, drückte es ihm aber noch nicht in die Hand, denn zuerst war August Borsig noch die große silberne Medaille für die Konstruktionszeichnung einer hölzernen Kuppel nach italienischen Vorbildern auszuhändigen.
»Der Kuppelbau war ja Ihre große Leidenschaft, Borsig. Gut so!«
August Borsig musste unwillkürlich an Walter Rawitsch denken, der ihm einmal gesagt hatte, wenn er es so mit den Kuppeln habe, solle er doch am besten Kuppler werden. So sah er etwas geistesabwesend aus, als man ihm sein Abgangszeugnis in die Hand drückte.
»Ein guter Anfang, Borsig«, sagte Hirt mit der gebotenen Feierlichkeit. »Und wir freuen uns darauf, später noch viel Gutes von Ihnen zu hören!«
August Borsig bedankte sich und überflog im Zurückgehen das Blatt, das er vorsichtig in den Händen hielt und das vom Hofrath Bach unterschrieben war:
Sein Fleiß und seine Fortschritte in dem Unterricht der schönen und städtischen Baukunst, im Zeichnen alter Säulen, in den vorzüglichen Übungen der Zimmerkunst wie auch im besonderen Unterricht der Mechanik waren besonders lobenswert. Zudem hat der Eleve Borsig mit Eifer und Fleiß die Freihandzeichnungen in verschiedener Art studiert und dabei sehr gute Fortschritte gemacht.
Man feierte das Bestehen in einer nahe gelegenen Schänke, aber als August Borsig dann mit dem Zeugnis in der Hand nach Hause ging, war er etwas schwermütig gestimmt.
»Was hast du denn erwartet?«, fragte ihn Friedrich Hermes. »Dass Friedrich Wilhelm III. höchstpersönlich in einer Kutsche angefahren kommt, um dich als Königlichen Hofzimmermann nach Berlin zu holen?«
»Ja, so in etwa«, brummte Borsig und wurde bitter. »Aber was habe ich denn von der langen Quälerei bei Hirt und Bach? Dieses Zeugnis hier ist doch zu nichts nütze, damit kann ich mir doch den Hintern abwischen!«
Friedrich Hermes suchte, ihn zu beruhigen. »Gott, August, du hast doch in den drei Jahren unheimlich viel gelernt. Das ist doch ein Kapital, mit dem du später einmal wuchern kannst.«
»Ja, ich habe den Kopf voller Wissen und Ideen, aber es ist niemand da, der das alles haben will!«, rief Borsig.
»Sei doch nicht so ungeduldig, du musst nur warten können.«
Am Abend wurde Borsig von Caspar Kiesewetter zu einem Gespräch unter vier Augen gebeten. Er bekam weiche Knie und zitterte am ganzen Körper, denn er erwartete nichts anderes, als dass der Meister ihn bitten würde, förmlich um die Hand seiner Tochter anzuhalten. Aber es sollte ganz anders kommen.
»Borsig, ich kann und ich darf Sie nicht mit Gewalt halten, wenn ich es auch äußerst gern täte. Aber Sie wollen in die Welt, und Sie müssen in die Welt!« Damit bekam er ein Blatt Papier in die Hand gedrückt.
Hierdurch bestätige ich, dass Johann Friedrich Borsig bei mir in Arbeit gestanden und auf sein Ansuchen, weil derselbe, um seine Kenntnisse zu vermehren, reisen will, hiermit entlassen wird. Sein Fleiß und seine Aufführung waren stets so, dass ich ihn jedem meiner Mitmeister empfehlen kann.
»Nicht einmal meinen eigentlichen Vornamen hat er auf diesen Wisch geschrieben«, sagte Borsig später zu seinem Freund Hermes. »Das Ganze hat er doch nur in Szene gesetzt, um mich von seiner Tochter abzutrennen. Marie soll sicher einen reichen Laffen heiraten.«
Friedrich Hermes nickte. »Kann schon sein. Möglich ist aber auch, dass dein Vater dahintersteckt und mit Kiesewetter gesprochen hat, denn es stört ihn mächtig, dass du nicht auf die Walz gehen willst, wie es sich für einen echten Zimmermann gehört.«
»Ich will aber kein echter Zimmermann mehr sein!«, rief Borsig.
Der Hofrath Professor Bach saß am Schreibtisch in der Provinzialregierung und starrte aus dem Fenster – als könnte ihm die matte Herbstsonne zu einer Erkenntnis helfen. Vor ihm lag ein Schreiben aus Berlin, auf das er heute endlich reagieren musste, aber bis jetzt hatte er sich noch nicht zu einer Entscheidung durchringen können. Man beschwerte sich darüber, dass Breslau noch immer keinen Zögling aus Schlesien in die neue Königliche Gewerbeschule in der Klosterstraße geschickt habe. So ginge das nicht – und wenn man den Willen des Königs weiterhin konterkariere, werde das negative Folgen für Breslau haben. Irgendeiner müsse doch auch in Schlesien zu Höherem berufen sein als zu einem schlichten Handwerksmeister. Unterschrieben war das Ganze von einem Christian Peter Wilhelm Beuth, Director der Technischen Deputation für Handel und Gewerbe.
Bach war hin- und hergerissen. Einerseits musste dem Wunsche Berlins entsprochen werden, und er gönnte ja auch jedem Schlesier den Aufstieg – ja, es war ihm eine Herzensangelegenheit, jede Begabung zu fördern –, andererseits aber wollte er verhindern, dass Schlesien austrocknete und seine Provinz mit der zweiten Wahl vorliebnehmen musste. Das war ein unlösbares Dilemma. Schließlich ließ er den Bauinspector Hirt rufen, um sich mit ihm zu beraten.
»Einen müssen wir schicken, lieber Hirt, da kommen wir nicht drum herum. Aber nehmen wir den Besten, dann berauben wir uns selbst, nehmen wir das Mittelmaß, dann blamieren wir uns.«
Hirt dachte nicht lange nach. »Es ist unsere Pflicht vor Gott und den Menschen, den Besten zu schicken, damit er sich in Berlin entwickeln und zu Preußens Größe beitragen kann.«
»Unser Bester, das ist der Borsig …«
»So ist es, Herr Hofrat. Er ist so begabt wie kein Zweiter.«
Bach sah ein, dass es keine andere Lösung gab. »Dann schicken wir einen Boten nach ihm und lassen ihn kommen.«
Eine halbe Stunde später stand August Borsig vor ihnen – und sah nicht sehr begeistert aus, als er erfahren hatte, was sie mit ihm vorhatten. Dass er wegen Marie in Breslau bleiben wollte, konnte er ihnen unmöglich verraten.
»Borsig«, rief der Hofrath, »warum zögern Sie da? Die Lebensbahn eines Handwerkers ist nichts mehr für Sie, Sie sind dafür geschaffen, sich andere Ziele zu setzen, höhere Ziele! Berlin ermöglicht es Ihnen, das Wissen zu erwerben, das Sie befähigt, Großes, Eigenartiges und Wunderbares zu schaffen!«
Kapitel vier 1823
Seit Beginn der Demagogenverfolgung, die nach der Ermordung des Dichters August von Kotzebue – er galt als Gegner demokratischer Freiheiten – am 7. Juli 1819 eingesetzt hatte, stagnierte in Berlin das öffentliche Leben. Die wichtigste Behörde war das Polizeipräsidium. Seit den Befreiungskriegen, in denen man um die zweihunderttausend Menschen in Berlin gezählt hatte, wuchs die Bevölkerungszahl von Jahr zu Jahr, und hinter London, Paris und St. Petersburg stand die preußische Residenz in der Rangliste der europäischen Metropolen an vierter Stelle. Während im politischen Bereich die liberalen Ideen radikal unterdrückt wurden, kamen sie in der Gewerbe- und Wirtschaftspolitik voll zur Geltung. Trotz aller Unterdrückung erlebten Wissenschaft und Bildung, Kunst und Kultur eine ihrer glanzvollsten Epochen. Berlin entwickelte sich langsam zur Industriestadt. Damit wuchsen auch die sozialen Probleme, und 1820 waren vor den Stadtmauern die ersten Mietskasernen entstanden. Der Salon von Karl August und Rahel Varnhagen von Ense galt als geistiger Mittelpunkt der Stadt. Am 3. März 1821 hatte man das von Karl Friedrich Schinkel geschaffene Nationaldenkmal für die Befreiungskriege auf dem Kreuzberg enthüllt. Am 18. Juni 1821 war Carl Maria von Webers romantische Oper Der Freischütz uraufgeführt worden. Im gleichen Jahr hatte Schinkel den Neubau des Schauspielhauses am Gensdarmen-Markt vollendet, und am Oranienburger Thor konnte die Eisengießerei und Maschinenfabrik von Franz Anton Egells ihren Betrieb aufnehmen.
So war das Berlin beschaffen, in das August Borsig am 1. Oktober 1823 seinen Einzug hielt. Am Alexanderplatz stieg er aus der Postkutsche, und das lange Sitzen hatte seine Glieder so steif werden lassen, dass seine ersten Schritte auf dem harten Berliner Pflaster sehr unbeholfen wirkten und er wie ein alter Mann aussah und nicht wie ein junger Spund, der gekommen war, die Welt zu erobern.
Berlin war sicher eine ganz besondere Stadt, aber das ließ ihn nicht vor Ehrfurcht erstarren, denn schließlich kam er aus Breslau und nicht vom Dorfe. Aber die Leute waren doch irgendwie anders.
»Kannst du mir bitte mal sagen, wie ich zur Münzstraße komme?«
Der Schusterjunge, den er angesprochen hatte, grinste. »Klar kann ick det, denn wenn ick det nich könnte, wär ick ja janz schön mit’m Klammerbeutel jepudert. Det is also ’ne Beleidigung, det Se mir det nich zutrau’n.«
Borsig brauchte einen Augenblick, um mit dieser Logik zurechtzukommen. »Muss ich also in diese Richtung?« Er zeigte nach Süden.
»Nee, hier nach Westen. Erst kommt die Alexanderstraße, die ham Se direkt vor da Neese, und dann die Münzstraße.«
Borsig bedankte sich, schulterte die Kiste mit seinen Siebensachen und machte sich auf den Weg. Bald hatte er das zweistöckige Haus der Witwe Järschersky erreicht, in dem ihm die Berliner Schule ein Zimmer reserviert hatte. Der Name irritierte ihn nicht, denn in Breslau gab es viele, die ein -ky am Ende hatten: Brohasky, Ciazynsky, Damretzky, Domschikowsky, Galetschky, Labitzky, Panowsky oder Websky. Es waren eine ganze Menge -ky’s, an die er sich erinnern konnte.
Luise Järschersky ging auf die siebzig zu und kam aus der französischen Kolonie in Berlin, wie sich an ihrem Mädchennamen Grolleau leicht erkennen ließ. Geheiratet hatte sie den Holzhändler Johann Järschersky, der aus Ostpreußen nach Berlin gekommen war. Ihr Vorbild war die stadtbekannte Madame Du Titre, mit der sie auch befreundet war. Beide sprachen noch fließend französisch, liebten aber den urwüchsigen Berliner Dialekt und konnten komisch erzählen. Etwa in der Art, wie Madame Du Titre dem König nach dem Tod seiner Luise ihr Mitgefühl ausgedrückt hatte: »Ja, Majestätken, et is schlimm for Ihnen. Wer nimmt ooch jern een Witwer mit sieben Kinderkens?«
Die Witwe Järschersky hieß August Borsig herzlich willkommen. »Ach du meine Jüte, drei Bonbons in eene Tüte! Sie sind nun schon der dritte Jast aus Breslau, den ick hier bemuttan darf. Erst war et der Friedrich von Gentz, aber der ist ja ab in det jlückliche Österreich, und denn der Herr Schleiermacher, aber wat der so rumspinnt, det is mir allet höchst schleierhaft.« Dann verwies sie auf ihre Nähe zu Madame Du Titre und hatte auch gleich noch eine Anekdote bereit, die man sich von ihrer Freundin erzählte: »Sie hat Joethe schon imma bewundert, und als er vor ’n paar Jahre in Berlin war, hat er ooch von ihr jehört. Als er ihr uff de Straße sieht, da will er ihr verwirren und fragt: ›Kennen Sie mich?‹ Da macht sie janz ehrfürchtich ’n Knicks und ruft: ›Jroßer Mann, wer sollte Ihnen nich kennen: Fest gemauert in der Erden/steht die Form, aus Lehm gebrannt!‹«
Borsig ging es wie ein Mühlrad im Kopf herum, und er zog sich erst einmal in sein Zimmer zurück, um wieder etwas zu sich zu kommen. Erschöpft warf er sich auf das Bett. Seine Gefühle waren höchst zwiespältig. Einerseits fühlte er sich einsam und verlassen und sehnte sich nach seiner Familie, nach Marie, nach Kiesewetters Zimmerei, andererseits aber war er froh und glücklich, ein neues Leben zu beginnen, war er neugierig auf die Preußenresidenz. Er fühlte sich wie ein Schauspieler, der auf der Breslauer Bühne zehn Jahre lang einen Zimmermann gespielt hatte und sich nun freuen konnte, dass es in Berlin andere Rollen für ihn gab.
Er mochte eine Stunde tief und fest geschlafen haben, als jemand an seine Zimmertür klopfte. Es war Wilhelm Järschersky, der Sohn seiner Wirtin, und der wollte ihn fragen, ob er morgen mit ihm durch Berlin spazieren und den Cicerone spielen dürfe.
»Gerne. Aber haben Sie denn die nötige Zeit dafür?«
Wilhelm Järschersky lachte. »Aber ja, ich bin Student, und bei uns hat das neue Semester noch nicht so richtig angefangen – jedenfalls nicht für mich.«
Erst als der Studiosus wieder gegangen war, bemerkte Borsig die Zeichnung, die über seinem Bett hing. Sie zeigte einen jungen Mann, der am Brandenburger Thor aus der Postkutsche stieg und frohgemut Berliner Boden betrat. Darunter stand: Schicksal, ick erwarte dir!
Egells bedauerte zu keiner Zeit, dass er sich vor zwei Jahren mit staatlicher Unterstützung selbständig gemacht hatte. Gemessen an dem, was er in England gesehen hatte, war seine Maschinenanstalt nur eine kleine Klitsche und mehr Manufactur als Fabrik. In der Lindenstraße betrieb er eine kleine Eisengießerei und in der Mühlenstraße, der späteren Obentrautstraße, eine Schlosserwerkstatt. Viel warf das alles noch nicht ab, und immer wieder ging ihm ein Ausspruch seiner Mutter durch den Kopf: »Mühsam ernährt sich das Eichhörnchen.« Er baute alles, was irgendwie denkbar war, und erwarb sich schnell einen guten Ruf als Konstrukteur. Besonderen Erfolg hatte er mit einer gedrungenen und raumsparenden Dampfmaschine, einer sogenannten Bügelmaschine.
Einer seiner besten Leute war Johann Friedrich Ludwig Wöhlert, ein Tischler aus Kiel, der 1818 nach kurzer Wanderschaft nach Berlin gekommen war. Er sah heute Morgen etwas müde aus.
»Na, Wöhlert, gestern wieder zu lange auf den Spuren Ihres Vaters gewandelt?« Der war Brauer.
»Nein, ich habe nur mit geschlossenen Augen nachgedacht. Fragt mich gestern ein Constabler, mit dem ich ins Gespräch gekommen war, ob unsere Bügelmaschine nicht was für seine Frau wäre. ›Wir haben acht Kinder und so viel Wäsche!‹ Da frage ich mich, ob man nicht wirklich etwas bauen kann, das mit heißem Dampf die zerknitterten Wäschestücke glättet …«
»Hm …« Egells dachte nach. »Möglich erscheint mir das schon, aber die Leute müssten dafür statt ihrer Küche kleine Säle zu Hause haben.«
Auch Egells, ansonsten ein rastloser Arbeiter, war heute etwas müde. Schließlich war er jungverheiratet, und seine Anna Elisabeth Sabina, Tochter des Porzellanmalers Peter Angelé, hatte ihm vermittelt, dass ein Bett auch anderem als der bloßen Nachtruhe dienen konnte.
Gegen Mittag ließ sich Beuth in der Lindenstraße sehen. Egells hieß seinen Freund und Förderer herzlich willkommen.
»Na, willst du sehen, ob sich die Gelder, die Preußen hier investiert hat, auch verzinsen werden?«
Beuth lächelte. »Alles, was wir jetzt für die Industrialisierung unseres Landes tun, wird sich später einmal auszahlen. Nein, ich komme, um zu hören, wie es mit dem Umzug in die Chausseestraße vorangeht.«
»Wir werden erst nächstes Jahr alles unter Dach und Fach haben, aber wir kommen mit allem gut voran.«
»Das freut mich zu hören«, sagte Beuth. »Die Königliche Eisengießerei ist ja schon seit nahezu zwanzig Jahren dort zu Hause, und ich hoffe, dass sich in der Gegend nordöstlich des Oranienburger Thores – Chausseestraße, Zollmauer, Garten- und Liesenstraße – bald viele Eisengießereien und Maschinenbau-Anstalten ansiedeln werden. Aus Dutzenden von Schornsteinen sehe ich Rauch in den Himmel steigen.«
Bis der Unterricht in Beuths Institut begann, hatte August Borsig noch zwei Wochen Zeit, sich mit Preußens Residenz vertraut zu machen, und einige Male zog er auch mit Wilhelm Järschersky durch Berlin, das gerade einen wunderbaren Altweibersommer erlebte. Die Damen, die nachmittags Unter den Linden spazieren gingen, hatten zum Teil noch ihre bunten Sonnenschirme aufgespannt, und der Thiergarten zeigte weiterhin ein sattes Grün. Die wenigen Blätter, die von den Linden und Kastanien zu Boden schwebten, fielen nicht weiter ins Gewicht.
Zuerst ging es zum Schloss der Hohenzollern, und Järschersky geriet so ins Schwärmen, dass es Borsig fast zu viel wurde. Denn so recht imponieren wollte ihm das Gebäude nicht, schließlich war auch das Breslauer Schloss keine Hundehütte. Er hörte erst wieder richtig zu, als Järschersky vom Grünen Hut zu erzählen begann.
»Dieser kleine Turm, den du dort oben siehst, ist der Grüne Hut. Er ist ein Überbleibsel der alten Burg, die hier gestanden hat, und diente bis 1648 als Gefängnis. Ganz unten im Turm stand die Eiserne Jungfrau, eine Frauengestalt aus Eisen. Die weitgeöffneten Arme waren als Schwerter ausgebildet, und im Leib befanden sich links und rechts scharfe Messer. Wurde einer zum Tode verurteilt, musste der vor der Eisernen Jungfrau auf eine steinerne Platte treten und sie küssen. Dadurch wurde ein Mechanismus ausgelöst, und die Arme umfingen ihn, pressten ihn gegen die Messer und zerschnitten seinen Körper. Die einzelnen Stücke der Leiche fielen dann durch eine Klappe runter in die Spree – und die Fische und die Krebse hatten was zu fressen.«
Borsig schüttelte sich und war in den kommenden Wochen nur schwer dazu zu bewegen, Fische aus der Spree zu essen. Weniger gruselte ihm vor der Weißen Frau, dem Schlossgespenst der Hohenzollern, bei dem es sich um Anna Sydow handeln sollte, eine Gespielin des Kurfürsten Joachim II. Kaum war der verstorben, beraubte sein Sohn die »schöne Gießerin« all ihrer Güter und Kleinodien und ließ sie auf die Festung Spandau bringen, wo sie nach harter Behandlung verstarb. Sie kam aber im Grab nicht zur Ruhe und wurde zur Todesbotin der Hohenzollern. Jedes Mal, wenn sich ein Landesherr anschickte, einzugehen in die Ewigkeit, erschien sie im Berliner Schloss.
»Da bin ich ja mal gespannt«, sagte Borsig, dessen Liebe zum König sich in Grenzen hielt, hatte sich doch Friedrich Wilhelm III. seiner Meinung nach im Kampf gegen Napoleon am Anfang recht dämlich angestellt.
»Weiter zum Opernhaus«, sagte Järschersky, »mit dessen Bau 1741 begonnen worden ist. Die Pläne stammen von Knobelsdorff, aber Friedrich der Große soll da auch ein Wörtchen mitgeredet haben. 1742 gab es die erste Opernaufführung, später auch Maskenbälle.«
»Ah ja …« Borsig erinnerte sich an Breslau, wo der Geheime Rath Ludger von Krauthausen als Nero gegangen war.
Weiter ging es zum Forum Friedericianum, zur Hedwigskirche und zum Prinz-Heinrich-Palais, wo sie einen Augenblick innehielten.
»Prinz Heinrich ist 1802 gestorben, und aus seinem Palais ist die Berliner Universität geworden, die Alma mater berolinensis, die Friedrich-Wilhelms-Universität. Im Oktober 1810 hat es hier die ersten Lehrveranstaltungen gegeben.«
Borsig lachte. »Das haben wir in Breslau auch, die Schlesische Friedrich-Wilhelms-Universität mit fünf Fakultäten.«
»Und warum hast du nicht versucht, dort zu studieren?«
Borsig winkte ab. »Das ist mir alles viel zu trockenes Zeug.« Nein, in keiner Sekunde seines Lebens hatte er daran gedacht, sich an einer Universität einzuschreiben.
»Das Ende des Forum Fridericianum bildet die Königliche Bibliothek«, sagte Järschersky und zeigte auf ein Gebäude mit einer merkwürdig geschwungenen Fassade. »Weißt du, wie die Berliner sie nennen?«
»Nein, woher denn?«
»Kommode. Weil das Gebäude wie eine Kommode aussieht. Die Leute erzählen sich, dass der König sich mit dem Baumeister Georg Christian Unger über den Neubau gestritten hat, und als sie zu keiner Einigung gekommen sind, hat er auf seine Kommode gezeigt und gesagt: ›So wie das Ding da ist, so will ich, dass Er die Bibliothek errichtet!‹ In Wirklichkeit aber soll die Idee aus Wien stammen, von einem gewissen Erlach.«
Auf der anderen Seite der Straße Unter den Linden gab es die Bauten um den Lustgarten, das Zeughaus und Schinkels Königswache zu bestaunen. Dessen strenge, klare und nüchterne Form faszinierte Borsig.
»Wenn wir Glück haben, kannst du Schinkel sehen«, sagte Järschersky. »Hinten am Lustgarten und an der Spreebrücke arbeiten sie gerade am Fundament seines Museums. Um das Fundament zu gewinnen, wird ein alter Arm der Spree zugeschüttet, und sie rammen viele tausend Pfähle in den Boden. Ein mächtiger Bau soll es werden, mit einer langen, hohen Säulengalerie an seiner Front.«
Sie liefen hin und hatten Glück, denn der Oberbaurath Schinkel stand tatsächlich gerade mit einigen Aufsehern zusammen und erklärte denen anhand eines riesigen Planes, was zu tun war. Stumm und anbetend stand Borsig da. Ein Mann, der sich anschickte, so etwas Großartiges zu schaffen wie ein Museum, das den Bauten Griechenlands in nichts nachstehen würde, der war ein Gott für ihn.