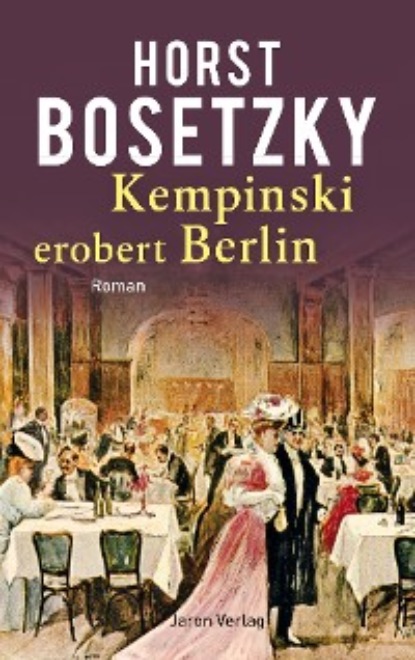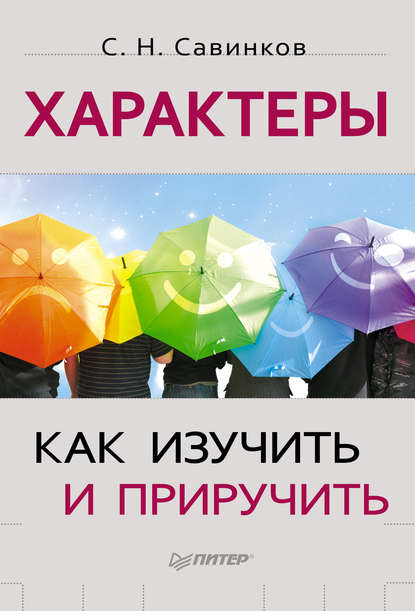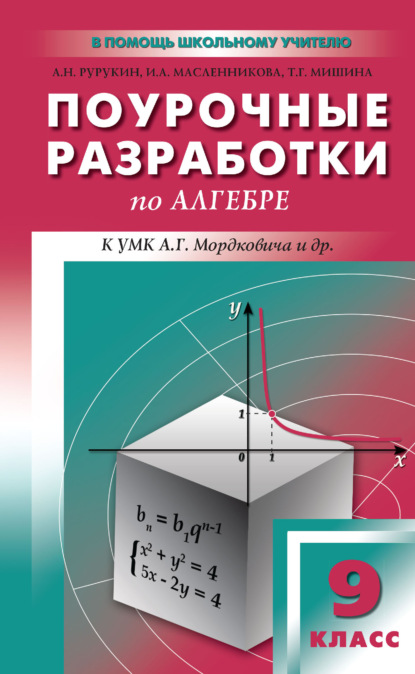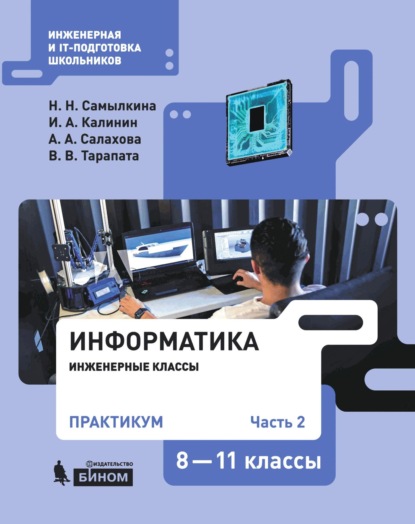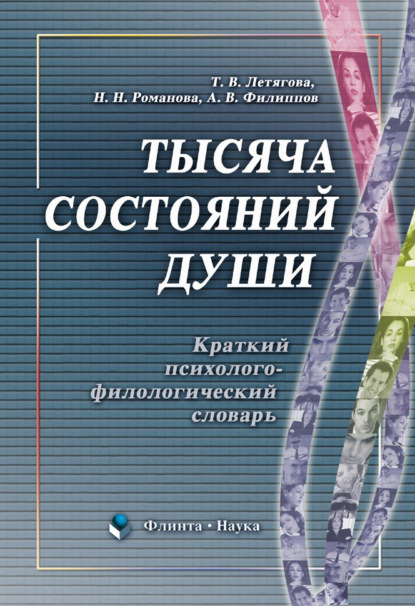- -
- 100%
- +
»Was, du kennst ihn nicht!« Vorwurfsvoll, fast böse hatte Klodzinski das ausgerufen. »Wo Mierosławski sogar 1848 bei der Märzrevolution dabei gewesen ist.«
»Entschuldige, da war ich gerade fünf Jahre alt.«
Witold klärte ihn auf. Geboren worden war Ludwik Mierosławski 1814 in Frankreich als Sohn einer Französin und eines emigrierten polnischen Offiziers. Seit 1820 lebte er in Kongresspolen und war schon 1830, gerade sechzehn Jahre alt geworden, als Fähnrich am Novemberaufstand gegen Russland beteiligt. Nach dessen Niederwerfung flüchtete er nach Paris, um dort später ins Zentralkomitee der polnischen Emigranten gewählt zu werden. 1846 und erst recht im April und Mai 1848 kämpfte er in der Stadt Posen und an verschiedenen anderen Orten, so vor allem in Baden als General und Oberbefehlshaber der dortigen Revolutionsarmee gegen die preußischen Truppen. Nach dem Fall der Festung Rastatt im Juli 1849 ging er in die Schweiz und von dort weiter nach Paris, wo er als Privatlehrer arbeitete. Bis ihn 1861 Giuseppe Garibaldi rief und im Unabhängigkeitskampf der Italiener den Oberbefehl über eine internationale Legion anvertraute. Danach war er Kommandeur der polnischen Militärschule in Genua geworden.
Mit dem Satz »Man nennt ihn den polnischen Napoleon« schloss Witold Klodzinski seine Ausführungen. »Und nun ist er zurück, um sein Vaterland von den Russen zu befreien, und ich werde morgen früh losziehen und mich seinen Truppen anschließen.«
Berthold Kempinski schwieg. Er war zutiefst beeindruckt vom Feuer, das in Witold loderte. Dagegen war geradezu läppisch, was ihn bisher bewegt hatte: Luise Liebenthal zu besitzen oder genügend Geld zu haben, um die Weinhandlung seines Bruders aufzukaufen und sich an dessen Stelle zu setzen.
Witold Klodzinski begann die polnische Nationalhymne zu singen. »Jeszcze Polska nie zginela … Noch ist Polen nicht verloren,/In uns lebt sein Glück./Was an Obmacht ging verloren,/bringt das Schwert zurück.«
Berthold Kempinski war an sich jedes Pathos zuwider, und normalerweise hätte er das Gesicht verzogen, aber bei dem Freund war das alles derart echt, dass er es nicht wagte. Außerdem war er in hohem Maße ergriffen. Er begann, Witold um dessen Patriotismus zu beneiden. Das war etwas, an dem man sich festhalten konnte. Einen solchen Anker für seine Seele hatte er nicht. Als echter Deutscher konnte er sich nicht fühlen, zu diskriminiert waren die Juden in Preußen noch immer, und seine Distanz zum Judentum war zu groß, da kam wenig von innen. Wie glücklich musste einer wie Witold sein, der keine Sekunde zögerte, sein Leben für das Glück seines Volkes herzugeben.
»Willst du nicht mitkommen?«, fragte der Freund und legte ihm den Arm um die Schultern.
»Warum eigentlich nicht? Was hab ich groß zu verlieren …«
Raphael Kempinski kam aus dem Krankenzimmer, nachdem er seiner Frau eine Hühnersuppe gebracht hatte, der man nachsagte, dass sie Kraft gab. Sie siechte immer schneller dahin. Dr. Dramburger wusste keinen Namen für ihre Krankheit. Bis jetzt hatte Raphael Kempinski das Leben gemeistert, indem er immer und überall seinen Humor einsetzte. Starb aber das Liebste, was er hatte, unter so entsetzlichen Leiden, dann half ihm auch der nicht mehr. Blieb ihm nur, sich in die Arbeit zu flüchten. So stieg er in sein Kontor hinab und machte sich daran, seine Geschäftsbücher durchzugehen und nachzutragen, was noch auf dem Schreibpult lag.
Er hatte gerade eine halbe Stunde über allem gebrütet, da wurde kräftig gegen die Haustür geklopft. So früh schon der erste Kunde? Das konnte nicht sein. Er stand auf und trat in die Diele. Seit in Posen und im angrenzenden Schlesien immer wieder Menschen spurlos verschwanden, war er vorsichtig geworden und fragte erst, wer da wohl sei.
»Ein Bote aus Ostrowo, von Professor Lagow.«
Raphael Kempinski fühlte, wie sein Herz aussetzte. »Ist was mit Berthold?«
»Ja, er ist weg, nach Kongresspolen rüber, und will zu den Aufständischen.«
»Mein Gott!« Raphael Kempinski musste sich festhalten, sonst wäre er nach vorn gestürzt. Es dauerte Sekunden, bis der Schwindel vorüber war und er dem Jungen aus Ostrowo öffnen konnte. »Komm rein und erzähl mal, was passiert ist.«
Der Junge trat ein, nahm die Mütze ab und erstattete Bericht. »Die Witwe Jastrau wacht auf und macht Frühstück. Sie ruft nach Berthold. Keine Antwort. Sie sieht in seiner Stube nach – das Bett ist leer. Da erinnert sie sich, dass der Pole, der am Abend da war, sein Freund Witold Klod … Klod …«
»Lass, nur weiter!«
»Der wollte also zu den Soldaten rüber, zu den Polen, und gegen die Russen kämpfen, und da ist der Berthold nun mit.«
»Man muss ihn aufhalten!«, schrie Raphael Kempinski.
»Ja, das sagt der Professor Lagow auch, und er ist mit dem Herrn Rabbiner Ungar zusammen hinterher … Sie haben sich eine Kutsche gemietet und sind ab nach Kalisch.«
»Ich muss ihnen nach!«
Raphael Kempinski entlohnte den Boten, informierte dann den inzwischen eingetroffenen Kommis und lief zur Apotheke. Sein Freund Eduard Schlüsselfeld verfügte über Pferd und Wagen. Als er hörte, was vorgefallen war, ließ er hurtig anspannen.
»Du hast recht, Raphael, wenn wir ihn nicht abfangen, kriegst du ihn nur im Sarg zurück. Die Russen sind auf Dauer derart in der Übermacht, dass die Polen keine Chance haben und die Aufständischen allesamt massakriert werden. Der Bär zerfleischt die Schafe, wie immer.«
»Wie konnte das nur angehen?«, rief Raphael Kempinski, während er sich auf den Kutschbock schwang. »Berthold ist doch ein viel zu heiterer Mensch, als dass er auf andere schießt.«
»Der Freund ist ein Eiferer, ein Feuerkopf, ein kleiner Savonarola, der wird ihn mitgerissen haben.«
»Mitgegangen, mitgehangen.« Raphael Kempinski hatte das Erschießungskommando vor Augen. Wie man die Gewehre auf seinen Sohn anlegte. Feuer!
»Wenn die beiden zu Fuß sind, werden wir auf alle Fälle vor ihnen an der Grenze sein«, sagte Schlüsselfeld. Nach Kalisch waren es auf direktem Wege knapp dreißig Kilometer.
Raphael Kempinski überlegte trotz aller Hetze und Panik einen Augenblick lang, wie wohl optimal vorzugehen war. »Wir sollten bei Droszew abbiegen und nach Skalmierzyce fahren, das liegt auf ihrem Weg von Ostrow nach Kalisch, und da stoßen wir schon auf sie, bevor sie in der Nähe der Grenze angekommen sind.«
Der Apotheker nickte. »Gut. Also über Drosenau und Skalmierschütz Richtung Russisch-Polen.« Mit Absicht wählte er die deutschen Namen der genannten Orte.
Raphael Kempinski konnte es nicht schnell genug gehen, und er verfluchte die Behörden, die es noch immer nicht geschafft hatten, die Städte im Dreieck Posen–Breslau–Kalisch mit Eisenbahnen zu verbinden.
Schlüsselfeld nickte. »Recht hast du! Hüh! Mach hinne, du dösiger Krippensetzer!« Sein Brauner lief ihm nicht schnell genug. »Wenn man Posen germanisieren will, muss bei uns alles besser sein als anderswo. Und wehe uns, wenn die Polen den Zaren besiegen und einen der Ihren zum König machen, dann wird man in Warschau nichts weiter im Kopf haben, als Preußen Posen wieder zu entreißen – und womöglich Schlesien dazu.«
»Mir kann es egal sein, was in zwanzig Jahren sein wird, da deckt mich schon längst der kühle Rasen.«
»Da freust du dich wohl drauf?«, fragte Schlüsselfeld.
»Du hast mehr vom Leben, wenn du dich darauf freust, von Gott heimgeholt zu werden in die Ewigkeit.«
»Wenn schon, dann möchte ich als Deutscher sterben und in deutscher Erde begraben werden.«
»Ist das hier deutsche Erde?«, fragte Raphael Kempinski, während sie, wenn die Chausseebäume einmal etwas lichter standen, in der Ferne schon den Kirchturm von Szczuny sahen.
»Ja, das hier ist deutsche Erde, und ich fürchte ein wenig um unsere Freundschaft, wenn sich dein Berthold wirklich den polnischen Banden anschließt. Erst werden sie gegen Russland kämpfen, dann gegen die Preußen – bis sie endlich ihr Großpolen wiederhaben.«
»Das ist nun mal so«, sagte Raphael Kempinski. »Nur schade, dass sie bei ihrer Siegesfeier Wodka trinken werden und keinen Wein. Man müsste sich rechtzeitig umstellen.«
So stritten sie munter weiter, bis sie nach anderthalb Stunden Skalmierschütz erreichten. Es war ziemlich heiß, das Pferd musste unbedingt getränkt werden, und auch sie lechzten nach einem kühlen Trunk.
Dennoch war Raphael Kempinski von dieser Rast nicht eben begeistert. »Was wir dadurch an Zeit verlieren! Ist Berthold erst einmal über die Grenze, dann kann ich ihn abschreiben.«
»Hör auf zu jammern!«
Raphael Kempinski besann sich. »Du hast recht: Ich habe ja noch immer Moritz, von den anderen Kindern ganz zu schweigen.«
»Deinen Humor möchte ich haben.«
Nach kurzer Suche fanden sie einen Gasthof, in dem ein Knecht bereitstand, um sich um das Pferd zu kümmern. Sie überließen es ihm und traten in die Gaststube, die niedrig war und dunkel dazu. So kam es, dass Raphael Kempinski den jungen Mann hinten in der Ecke erst entdeckte, als sie sich niedersetzen wollten.
»Berthold!«, schrie er.
»Vater! Was machst du denn hier?«
»Ich will dich daran hindern, dich den Polen anzuschließen.«
Der Sohn lachte. »Da kämest du zu spät, das hätte ich schon längst tun können. Ich wollte aber Witold nur bis zur Grenze begleiten und dort Abschied von ihm nehmen. Das habe ich auch – und nun bin ich wieder auf dem Rückweg nach Ostrowo.«
Raphael Kempinski umarmte ihn.
»Du solltest den Jungen was Vernünftiges machen lassen«, sagte Schlüsselfeld. »Seit er nicht mehr in die Schule gehen will, lungert er nur noch herum und kommt auf dumme Gedanken. Bei seinen guten Noten hätte er doch überall studieren können, jeder Professor wäre froh über ihn gewesen.«
Berthold Kempinski starrte auf seine Fingernägel. »Ich weiß aber partout nicht, was ich machen möchte.«
»Warum gehst du nicht nach Breslau zu deinem Bruder ins Geschäft? Breslau ist ein gutes Sprungbrett nach Berlin.« Schlüsselfeld wusste, dass er seinem Freund Raphael ab und an auf die Sprünge helfen musste, denn der hätte den Jungen nie aus eigenem Antrieb an die Kandare genommen, weil er meinte, alles müsse von innen heraus kommen und zwang man einem anderen seinen Willen auf, dann ging das immer schief.
»Ich will nicht zu Moritz!« Fast hätte Berthold Kempinski mit dem Fuß auf den Boden gestampft.
»Du gehst!«, beschied der Vater, der sich genötigt sah, angesichts des kritischen Freundes einmal Härte zu zeigen. »Auch wenn es nur für kurze Zeit ist, um einmal hineinzuschnuppern.«
»Nein.«
Schlüsselfeld wollte vermitteln. »Dann schick ihn in die Lehre, Raphael, ich habe da einen Vetter in Kreuzburg, bei dem kann er den Beruf des Kaufmanns erlernen, und dann erst tritt er bei Moritz ins Geschäft ein.«
Leopold Leichholz ließ es sich nicht nehmen, Berthold Kempinski sein Breslau zu zeigen, und er wurde richtig poetisch dabei. »Breslau ist die größte und kostbarste Perle am schimmernden Bande der Oder«, rief er aus, als sie über die Universitätsbrücke schritten, die Insel Bürgerwerder, die geformt war wie ein menschlicher Magen, mit ihren Kasernen zur Linken und der Vorderbleiche zur Rechten. »Wie eine Geliebte umschlingt sie der Strom. Breslau, alte Patrizierstadt und Zentrum von Wissenschaft und humanistischer Bildung. Ich sage nur Joseph von Eichendorff und Gustav Freytag und allein die Philosophen: Christian von Wolff, ein Vorläufer Kants, Christian Garve, ein Kämpfer gegen den Kant’schen Kritizismus, Johann Gottlieb Fichte, Friedrich Schleiermacher … Darum blieb mir nichts anderes übrig, als Philosophie zu studieren.«
Berthold Kempinski schaute ihn an. »Die Wahrheit findest du allerdings nicht im Hörsaal, sondern nur bei uns.«
»Wie das?«
»Nun: Im Wein liegt Wahrheit, und der Wein ist ein Spiegel der Menschen.«
Leichholz lachte. »Ja, die schläs’sche G’mittlichkeit. Mein Vater hat jeden Sonntag im Dorfkretscham gesessen und seinen Grünberger getrunken, so sauer der auch gewesen sein mag. Und wie hat unser großer schlesischer Dichter gereimt …«
»Der Angelus Silesius?«
»Nein, der August Kopisch.« Er musste einen Augenblick nachdenken, bis er darauf kam. »Auf Schlesiens Bergen, da wächst ein Wein,/der braucht nicht Hitze, nicht Sonnenschein./Ob’s Jahr schlecht, ob’s Jahr gut,/da trinkt man fröhlich der Trauben Blut.«
Berthold Kempinski erinnerte sich wieder. »Der Dichter trifft nun den Teufel und wettet mit ihm, dass er ihn unter den Tisch trinken kann.«
»Ja, und schließlich lallt der Teufel: Hör’, Kamerad,/beim Fegefeuer! Jetzt hab ich’s satt/Ich trank wohl vor hundert Jahren in Prag/mit den Studenten Nacht und Tag,/doch mehr zu trinken solch sauern Wein,/müsst’ ich ein geborener Schlesier sein!«
»Was wir nicht sind«, sagte Berthold Kempinski, »sondern geborene Posener, und darum hat M. Kempinski auch das Recht, seine Weine aus Ungarn zu beziehen.«
Leopold Leichholz schlug ihm auf die Schulter. »Es sei euch gedankt!«
Sie durchschritten die engen Straßen der Oder- und der Sandvorstadt und kamen über den Gneisenauplatz zur Kreuzkirche, deren spitzer Turm Leichholz spotten ließ, hier habe sich der Baumeister in der Religion geirrt und aus Versehen ein Minarett errichtet. Nicht weit entfernt lag der Dom mit seinen beiden Renaissance-Türmen und der dreischiffigen Basilika, an die mehrere Kapellen angebaut waren.
»Willst du in den Chor rein?«, fragte Leichholz.
»Nein, dazu singe ich zu schlecht.«
»Mensch, ins Kirchenschiff, den Hohen Chor zu St. Johannes.«
Berthold zeigte sich vom Breslauer Dom durchaus beeindruckt, obwohl er nicht so recht verstand, was der Freund damit meinte, wenn er sagte, der Fürstbischof Friedrich von Hessen habe im 17. Jahrhundert die gotische Ausstattung systematisch barockisieren lassen. Ein Gedanke ließ ihn nicht mehr los, seit er neulich geträumt hatte, Habel in Berlin hätte ihn adoptiert. »Was könnte man hier für ein herrliches Restaurant eröffnen!«, rief er.
Leichholz lachte. »Keine schlechte Idee. Der Wein ist ja schon hier – der Messwein fürs Abendmahl. Aber ob sie ihn dir als Juden so ohne weiteres überlassen würden?«
Berthold Kempinski winkte ab. »Du weißt, ich hab mich nie so recht als Jude gefühlt.«
»Dessen ungeachtet bist du einer. Und wenn es mal Ausschreitungen gegen Juden gibt …«
»In Preußen gibt es keine«, beschied ihn Berthold Kempinski. »Und wenn ich einmal ein Restaurant aufmache, dann nenne ich es bestimmt nicht Beth ha-Mikdasch.«
»Immerhin kennst du den Tempel in Jerusalem.«
»Manchmal kann es ja auch ganz nützlich sein, einen Glauben zu haben«, sagte Berthold Kempinski und dachte an seinen Freund Witold, der nun schon die ersten Gefechte hinter sich hatte. »An irgendetwas muss sich der Mensch schließlich festhalten. Und man lernt am Schabbat Leute kennen, die einem später etwas abkaufen.«
»Sehr gläubig bist du wirklich nicht.«
»Wenn alle Völker auf der Welt einen Gott hätten und anbeten würden, wäre ich ja noch zu überzeugen, dass es ihn wirklich gibt, aber so … Alle haben einen anderen und behaupten, er wäre der einzig wahre. Da kann doch etwas nicht stimmen!«
»Das erinnert mich an mein zweites Semester.« Leopold Leichholz kratzte sich den Hinterkopf. »Da gibt es einen Philosophen aus Landshut, den Ludwig Feuerbach, der behauptet, dass nicht Gott den Menschen nach seinem Ebenbilde geschaffen habe, sondern vielmehr umgekehrt der Mensch die Götter nach seinem eigenen Ebenbilde schaffe.«
Berthold Kempinski schloss ihren Dialog mit dem Satz, dass er nur an eines hundertprozentig glaube. »Dass nämlich ein Kilo Rindfleisch eine wunderschöne Brühe ergibt.«
Dennoch ging er mit Leichholz am Freitagabend in die Storch-Synagoge in der Wallstraße 7/9, die von keinem Geringerem als Carl Ferdinand Langhans erbaut worden war. Hier trafen sich die liberalen Breslauer Juden. Es wurde aber darüber geredet, eine neue und viel größere Synagoge zu bauen und diese hier den Orthodoxen zu überlassen.
»Mir ist das alles egal«, sagte Berthold Kempinski.
Leichholz sah ihn prüfend an. »Sag bloß, du willst konvertieren?«
»Paris ist eine Messe wert, heißt es ja, aber ich bin zu bequem dazu. Außerdem scheinen mir die Grabreden bei den Juden besser zu sein als bei den Christen.«
»Daran zu denken ist doch ein bisschen früh, oder?«
Berthold Kempinski lachte. »Recht hast du. Und vielleicht werde ich einmal unsterblich, dann ist das Ganze sowie kein Problem mehr.«
Krojanke hatte zu Hause in Obersitzko eine Liste mit über zwanzig potentiellen Opfern versteckt, darunter auch Berthold Kempinski. Die wollte er sich noch holen, bevor er zu alt dafür war, mit Pferd und Wagen durch die Lande zu ziehen und im Zelt zu schlafen. Da er alles tat, um als gutmütiger und hilfsbereiter Mensch zu erscheinen, und zusätzlich das hatte, was seine Mitmenschen als »ein liebes Gesicht« bezeichneten, war er noch immer unentdeckt geblieben. Dass er keine Frau hatte, erregte keinen Verdacht. Alle wussten, dass ihm seine heißgeliebte Johanna schon in jungen Jahren weggestorben war und er damals geschworen hatte, nie wieder eine andere anzurühren. Die Leute also ließen ihn in Ruhe, und die Mittel der Polizei waren in jenen Jahren so beschränkt, dass er auch von dieser Seite nichts zu befürchten hatte. Wer nicht in flagranti ertappt wurde, der konnte über Jahrzehnte hinweg andere abschlachten, ohne dass man seiner habhaft wurde.
Nach Breslau kam Krojanke nur selten, denn hier war nicht allzu viel zu verdienen, weil es zu viele Geschäfte gab, die wie er Scheren, Messer, Sägen, Feilen, Äxte und Beile an den Mann bringen wollten. So stand er auch heute wieder ziemlich gelangweilt an seinem Stand, als es ihn traf wie ein Stich in die Brust: Lief doch da Berthold Kempinski aus Raschkow über den Platz. »Den muss ich mir noch holen«, flüsterte er. »Diesmal wirst du mir nicht entgehen.«
Einmal hatte er ihn schon in der Falle gehabt. Damals auf der Chaussee zwischen Ostrowo und Raschkow, als er ihn aufgelesen und neben sich auf dem Kutschbock platziert hatte. Bei der ersten Rast hätte er ihn erschlagen und unter einer Plane verborgen nach Obersitzko gebracht. Da war ihm ein Rad gebrochen, und Kempinski hatte es vorgezogen, den Rest des Weges zu Fuß zurückzulegen.
So arm die Menschen in den preußischen Provinzen auch waren, überall gab es Honoratioren und Genießer, die gute Weine zu schätzen wussten und froh waren, dass sie nicht meilenweit reisen mussten, um diese käuflich zu erwerben, sondern sie ohne großen Aufpreis ins Haus geliefert bekamen. Gutsbesitzer und Landpfarrer vor allem. Moritz Kempinski hatte das schnell begriffen und seinen Radius ganz erheblich erweitert, seit er seinen Bruder ausschicken konnte.
Berthold Kempinski fand es nicht gerade berauschend, als fliegender Weinhändler zweispännig durchs Land zu zuckeln, aber da er die Kunst beherrschte, das Beste aus allem zu machen, litt er auch nicht übermäßig. Es gab Schlimmeres auf der Welt, und »Hoch auf dem gelben Wagen« zu singen, während es durch wogende Kornfelder ging, war ja auch nicht ohne. Er liebte die Kornblumen am Wege und mehr noch den roten Mohn, und ab und an fand sich in den Dörfern auch ein Mädchen, das auf einen Prinzen wartete. Sah er zu den weißen Wolken hinauf, dann fand er, dass er dahintrieb wie sie. Irgendwie wusste er, dass das eigentliche Leben noch kam und diese Zeit nur so leer war, damit er sich nicht zu früh verbrauchte. Wer warten konnte, zu dem kam alles. Wenn es irgendwie ging, nahm er den Weg nach Nordosten, nach Ostrowo und Raschkow, um zugleich die Eltern und die Geschwister, aber auch die alten Freunde zu besuchen.
In Medzibor traf er Ludwig Liebenthal, der dort im ersten Hotel am Platze als Hausknecht arbeitete. Die Wiedersehensfreude war groß.
»Wie geht’s denn Luise?« Das war eine der ersten Fragen, die Berthold Kempinski stellte.
»Du wirst lachen, sie lebt gar nicht weit von hier als Magd in Honig. Gleich hier hinter Medzibor Richtung Krotoschin.«
»Na, da muss ich morgen mal hin.«
»Mach das. Ich glaube, sie liebt dich noch immer.«
Berthold Kempinski fühlte, dass er rot wurde. In einsamen Nächten hatte er sich oft genug vorgestellt, mit Luise ins Heu zu gehen. Und nun stellte sich heraus, dass auch sie ihn nicht vergessen hatte. Geh hin und frage sie, ob sie deine Frau werden will. Was ihn antrieb, war die Natur. Die wollte, dass er sich mit Luise vereinigte und Kinder in die Welt setzte. Alles kam, wie es kommen musste.
Ludwig Liebenthal umarmte ihn. »Es wäre schön, wenn du mein Schwager wirst.«
Berthold Kempinski. »Und du meiner! Was stellt sich denn Luise so vor, ich meine …« Er konnte nicht recht in Worte fassen, was er im Sinn hatte.
»Sie will unbedingt auswandern. Nach Amerika.«
»Nach Amerika.« Berthold Kempinski brauchte eine Weile, um das zu verarbeiten. »Das will ja mancher.« Bis 1848, das wusste er, waren viele Juden nach Übersee ausgewandert, inzwischen aber wollten sie nicht mehr ganz so weit und begnügten sich mit Schlesien, von wo es des Öfteren auch weiterging bis nach Berlin. »Wenn schon Amerika, dann aber bitte Lateinamerika, schließlich habe ich in der Schule Latein gelernt.«
»Wie?« Der Freund verstand den kleinen Scherz nicht und blieb ernsthaft. »Nein, in die Vereinigten Staaten möchte sie, das ist ihr großer Traum.«
Als Berthold Kempinski wieder auf dem Kutschbock saß, hatte er Zeit genug, sich alles durch den Kopf gehen zu lassen. Der schmerzte zwar ein wenig, weil er den ganzen Abend über mit Ludwig gezecht hatte, aber dennoch. War es also sein Schicksal, Amerikaner zu werden? New York, New York. Alle Liberalen sprachen davon. Keine Fürsten mehr, keine Unterdrücker. Freiheit und viele Dollars. Konnte man drüben als Weinhändler seinen Weg machen? Vielleicht hatten sie sich ein bisschen an europäischer Kultur bewahrt und soffen nicht nur Bier and Brandy.
Je mehr er sich dem Dorfe Honig näherte, desto unruhiger wurde er. Wie hielt man um die Hand einer Vollwaise an? Luises Vater war ja auf ewig verschollen und ihre Mutter schon lange gestorben. Fragte man da den Bruder? Möglicherweise, aber Ludwig hatte ja schon sein Plazet gegeben. Also standen alle Türen offen. Oder waren die eigenen Eltern vorher zu fragen? Da geriet er ins Wanken. Aber was sollte sein Vater gegen Luise haben? Dass sie arm war und ihm eine gute Partie den Start ins Leben sehr erleichtert hätte. Schon richtig, aber bislang hatte keine der höheren Töchter zwischen Posen und Breslau Anstalten gemacht, ihn zu erwählen. Außerdem liebte er Luise, wenn Liebe hieß, dass er sie besitzen wollte.
Als er Akazien am Wegesrand sah, stieg er ab und pflückte ihr einen wunderschönen Strauß aus Feldblumen.
Eine Stunde später hielt er vor dem Gehöft des Bauern Gurkow. Es war nicht schwer zu finden gewesen, Ludwig hatte ihm alles genau beschrieben. Irgendwie hatte Berthold gehofft, dass hier tausend bunte Bänder wehten. Aber Luise hatte ja von seiner Ankunft nichts wissen können.
Er zog die Bremse seines Wagens an und stellte den Pferden Wasser und Hafer hin, um Zeit zu gewinnen und alles zu mustern. Vorn am Wohnhaus klebte viel Schinkel, was hieß, dass der Bauer recht wohlhabend war. Da hatte es Luise ja gut getroffen.
Er nahm seinen Blumenstrauß und trat durch das offene Tor in den Hof. »Hallo, ist da wer?«
Ein Hüne mit Haaren wie Haferstroh kam mit der Forke vom Misthaufen herab. Offenbar der Knecht. »Was ist?«
»Pardon, ich suche die Luise.«
»Hier ist keine Luise.«
»Ich bin doch aber richtig bei Gurkow?«
»Was wollen Sie hier?«
»Na, die Luise sprechen.«
Da erschien Luise Liebenthal auf der kleinen Terrasse, die man vor die Küche gesetzt hatte, um vom Hochparterre über eine Treppe in den Hof und zu den Ställen zu gelangen.
Ein Hahn krähte, ein Kater schmiegte sich an ihre Beine, aber die Szene war dennoch alles andere als idyllisch, denn Berthold Kempinski hatte schnell begriffen, dass auch der andere ein Auge auf Luise geworfen hatte und sie nicht kampflos hergeben würde.
»Berthold!«, rief Luise von oben. »Du hier?«
»Ja, um dich zu holen!« So schoss es aus ihm heraus, ohne dass er eine Chance gehabt hätte, es zu verhindern.