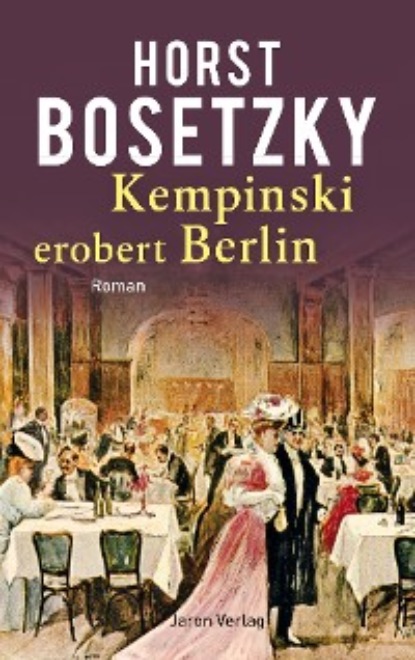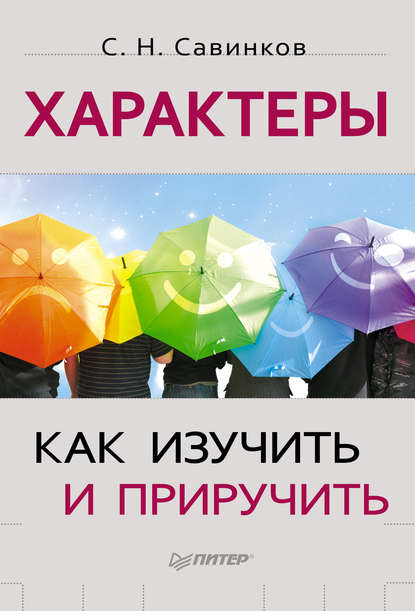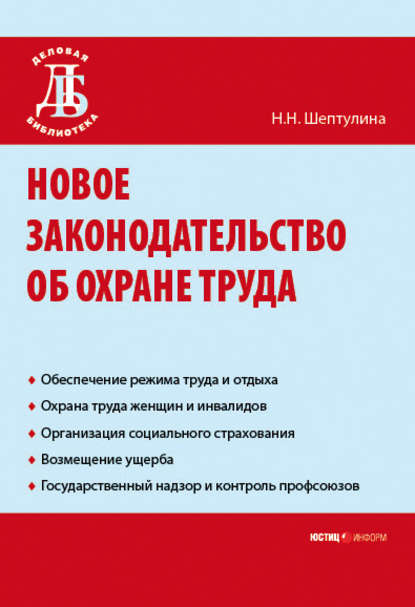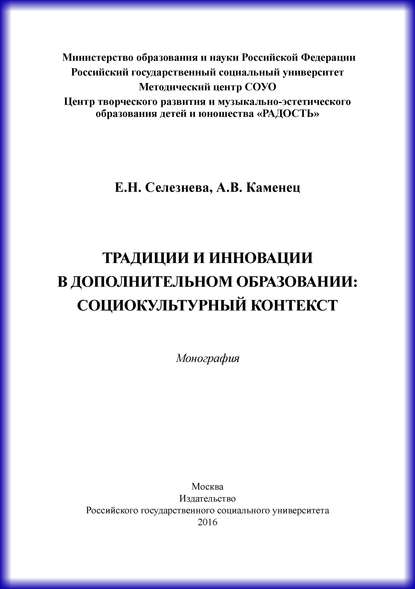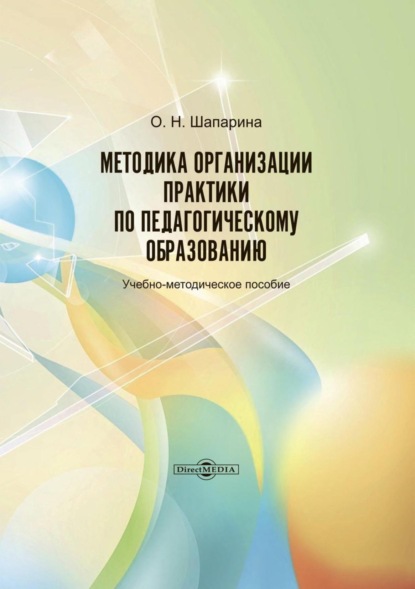- -
- 100%
- +
»Luise gehört mir!«, schrie da der Mann auf dem Misthaufen und kam mit seiner Forke drohend auf Berthold zu. Der wich einen Schritt zurück und fragte Luise, wer das denn sei.
»Heinrich, der Sohn vom Bauern. Er will mich auch.«
»Und wen willst du?«
»Lass mir einen Augenblick Zeit.«
Luise Liebenthal schloss die Augen, und Berthold Kempinski hatte das Gefühl, sie warte auf eine Eingebung des Himmels.
Als sie sich dann sicher war, kam sie die Treppen herunter und in seine Richtung gelaufen. Er breitete schon die Arme aus, um sie aufzufangen.
Da machte sie einen kleinen Schlenker und warf sich Heinrich Gurkow an die Brust.
In Kongresspolen waren die Aufständischen 1864 endgültig gescheitert. Sie hatten es nicht verstanden, ein tragfähiges Programm für die Bauernbefreiung zu entwickeln, und so war die Unterstützung aus dem Lande weithin ausgeblieben, erst recht, als der Zar mit einem Ukas die Leibeigenschaft aufgehoben hatte. Unter Romuald Traugutt hatte man schließlich den Partisanenkrieg gegen die Russen verloren. Die überzogen das Land mit Terror und henkten Traugutt und andere Rädelsführer. Hunderte Rebellen waren es, die öffentlich hingerichtet wurden, und es hieß, zwanzigtausend Polen seien nach Sibirien in die Verbannung geschickt worden.
»Das ist aber noch nicht alles«, sagte Friedrich Wilhelm von Kraschnitz. »Tausende von polnischen Adelsfamilien sind enteignet worden, die katholische Kirche wird unterdrückt, Russisch ist Amts- und Schulsprache geworden. Kongresspolen existiert nicht mehr und ist russische Provinz geworden. ›Weichselland‹ nennen sie es oder ›Gouvernement Warschau‹.«
»Mich interessiert Witolds Schicksal. Und Sie mit Ihren vielen Verbindungen nach Russland können doch da sicher etwas ausrichten.« Vor allem deswegen Berthold war Kempinski aufs Gut gekommen, nicht wegen des Weines, den Kraschnitz bestellt hat. »Ich flehe Sie geradezu an!«
»Ich werde alles versuchen, was in meiner Macht steht, aber wenn er schon auf dem Weg nach Sibirien ist, dann …« Er brach ab, denn sein Leibdiener war in den Raum getreten und kam zu ihm hin, um ihm etwas ins Ohr zu flüstern. Kraschnitz nickte und blickte dann zu Berthold Kempinski hinüber. »Ihr Vater weiß, dass sie hier sind, und hat jemanden geschickt. Ihre Mutter liegt im Sterben, und Sie sollen so schnell wie möglich nach Raschkow kommen.«
Mit Rosalie Kempinski ging es zu Ende, und alle ihre Kinder und näheren Verwandten hatten sich an ihrem Bett versammelt. Sie sah so elend aus, dass Berthold es kaum schaffte, in ihre Richtung zu blicken.
Obwohl es ihr furchtbar schwerfiel und sie immer von Hustenkrämpfen erschüttert wurde, wollte sie ihrem Mann und ihren Kindern noch ein letztes Wort mit auf den Weg geben. »Moritz, du kümmerst dich um Berthold und machst ihn zum Kompagnon. Und du, Berthold, bist Moritz ein ehrlicher Partner und fügst dich in alles ein.«
Kapitel 4 1871
Mit der Schlacht bei Sedan am 2. September 1870 und der Gefangennahme von Napoleon III. war der Deutsch-Französische Krieg entschieden, und die Deutschen sollten am 18. Januar 1871 den preußischen König Wilhelm I. zum Kaiser krönen. Nicht alle Menschen zwischen Maas und Memel und von der Etsch bis an den Belt stimmten in den nationalen Jubel ein, aber es gab in den deutschen Landen einen Aufbruch ohnegleichen. Die deutsche Agrarrevolution kam zum Abschluss, die industrielle Revolution strebte ihrem Höhepunkt entgegen. Jetzt musste man wagen, wollte man gewinnen.
Vor diesem historischen Hintergrund wollte Breslau sein Schiffer-Silvester ganz besonders ausgelassen feiern. Es war ein einzigartiges Fest der Lebensfreude, das die Oderschiffer abbrannten. Begannen sie ihren Umzug, sprach sich das wie ein Lauffeuer herum, und wer sich vergnügen wollte, der stürzte aus dem Haus, um sich ihnen anzuschließen. Durch die Altstadtgassen wälzte sich der Strom, um den Ring und über den Neumarkt, und ergoss sich schließlich in die Straßen zur Oder, wo in den vielen kleinen Schifferlokalen bis weit in den Neujahrstag hinein gefeiert wurde. Getrunken wurden Breslauer Spezialitäten wie der Schirdewan und die Hennig-Creme. Für die Musik sorgten Schnutenorgel und Schifferklavier, also Mund- und Ziehharmonika, und es wurde tüchtig getanzt und gesungen.
»Wie die Welle hüpft vom Kiel,/wie der Wind fegt über Deck,/ jagen plötzlich Tanz und Spiel/alle Müh’ des Jahres weg./Schiffer-Karle, Schiffer-Franz/mit der Frieda und Sophie/drehen sich im Dauertanz/junge Welt, was kostet sie!«
Berthold Kempinski kämpfte sich mit seinen Freunden Leopold Leichholz und Witold Klodzinski durch die Menge. Die beiden waren unheimlich aufgekratzt und wollten ordentlich feiern. Grund dazu hatten sie. Der eine hatte im vergangenen Jahr sein Studium beenden können und verdiente seinen Lebensunterhalt als Hauslehrer bei einer wohlhabenden jüdischen Familie, der andere war mit nur leichten Blessuren aus Frankreich heimgekehrt.
Witold Klodzinski hatte sich vor sechs Jahren schon auf dem Weg in ein sibirisches Arbeitslager befunden, als es Kraschnitz mit seinen Verbindungen zu deutschen Diplomaten in St. Petersburg gelungen war, ihn den Russen doch noch zu entreißen. Voller Dankbarkeit für seine Rettung hatte er sich dann widerstandslos in sein Schicksal ergeben, mit den Ostrower Ulanen in den Krieg zu ziehen. Natürlich war ihm das contrecoeur gegangen, denn das Herz der Polen hatte immer schon für Frankreich geschlagen, und der Sieg über die Franzosen stärkte nur die Deutschen und ließ ein freies und großes Polen in eine noch fernere Zukunft rücken, aber zuerst kam das Menschliche, und er wollte Kraschnitz nicht enttäuschen.
Berthold Kempinski freute sich über das Glück seiner beiden besten Freunde, haderte aber doch ein wenig mit dem eigenen Schicksal. Er hatte kein Studium beendet, konnte sich weder Professor nennen und seiner Gelehrsamkeit rühmen, wie der eine, noch hatte er etwas Abenteuerliches erlebt und galt als Held, wie der andere, er verschleuderte weiterhin all seine Gaben und war im Grunde nichts weiter als ein ganz gewöhnlicher Ladenschwengel. »Da darf ich Ihnen zuerst die alles entscheidende Frage stellen, mein Herr: Rot oder weiß?« Er sah sich als armseliges Zirkuspferd Abend für Abend, Jahr für Jahr durch die Arena laufen, immer im Kreis herum, obwohl er doch die Anlage zu einem Rennpferd hatte, das immerzu siegen und wertvolle Preise einheimsen konnte. Im neuen Jahr musste alles anders werden, musste er endlich raus aus seinem Trott. Breslau war eine Sackgasse, in Berlin spielte die Musik.
Sie mussten langsam zusehen, dass sie in einer der vielen Kneipen und Gaststätten einen Platz ergatterten, wollten sie auf das neue Jahr mit Sekt anstoßen, doch das Gedränge vor den Eingängen war so groß geworden, dass sie kaum noch hoffen konnten.
»Witold, geh du mal voran!«, rief Berthold Kempinski. »Du hast Kampferfahrung und kannst den Durchbruch schaffen.«
Witold Klodzinski sagte nicht nein und spielte den Rammbock, die beiden anderen folgten ihm.
Anfangs ging es ganz gut, dann aber verlor Berthold Kempinski ein wenig den Anschluss, und der Druck der Menge trieb eine junge Frau wie einen Keil zwischen ihn und Klodzinski. Es ließ sich nicht vermeiden, dass er ihr kräftig auf den Fuß trat. Sie schrie auf.
»Pardon!« rief er. »Aber das ist mein erster Auftritt heute.«
»Sie haben mir den Fuß gebrochen, Sie Gawwalier! Ich werd gleich ohnmächchdch.«
»Kommen Sie, ich stütze Sie.« Dessen bedurfte es eigentlich keiner besonderen Aufforderung, denn sie wurde von den Nachdrängenden ohnehin gegen seinen Körper gepresst. »Witold, andere Richtung, wir müssen raus hier!«
Das gelang dann auch mit einiger Mühe, und als sie schließlich am Rande des Menschenstromes eine halbwegs ruhige Insel gefunden hatten, stellte sich heraus, dass das Fräulein nur noch humpeln konnte.
»Wie soll ich denn so nach Hause kommen?«, fragte sie.
»Wir tragen Sie hin«, versprach ihr Berthold Kempinski, den die Kleine, sechzehn mochte sie sein, gehörig dauerte. »Wo kommen Sie denn her?«
»Aus Leibzsch.«
»Das dürfte ein bisschen weit sein. Aber dass Sie aus Leipzig stammen, hätte ich nie vermutet.«
»Nu, door säggs’sche Dialeggd iß iwwerall ä bisschen andorsch. Mier mergn glei, wenn eener aus Drehsden oder aus Leibzsch gommd. Wie in Leibzsch so schbrichd morr ooch inn Worrzn, Grimme unn ooch in Borrne. Schon in Eilnborch unn ooch in Dorche gamorr gee G schbrechn. Doord gibbds dorrfohr ä J.«
Alles lachte schallend, und sie erklärte, dass in Leipzig zwar ihr Elternhaus stünde, sie aber durch mehrere Zufälle bei einem Arzt in der Berliner Straße gelandet sei. »Hier in Breslau. Als Dienstmädchen.«
»Dann ist das mit dem Tragen ja wirklich kein Problem«, sagte Leopold Leichholz. »Wenn wir die Neue Oderstraße Richtung Bahnhof hochgehen, sind wir gleich an der Berliner Straße. Passen Sie mal auf, Fräulein …«
»Hess, Helene Hess.«
»Wieso Hässlich?«, fragte Berthold Kempinski, sie bewusst miss verstehend. »Sie müssten doch eigentlich Schön heißen, Helene Schön, die schöne Helene.«
»Sie können aber Gommblemännde machen.«
»Nicht nur das…«
Schon war er dabei, seine Hände mit denen von Witold Klodzinski zu verschränken, so dass sich für das Fräulein ein schöner Sitz ergab. So zogen sie denn los. Leichholz, der für solche Transporte zu schwächlich war, wies ihnen den Weg.
Die Familie des Arztes war schon tüchtig am Feiern, der Doktor fand aber noch Zeit, den schon dick angeschwollenen rechten Fuß des Mädchens zu versorgen. Anschließend lud er die drei jungen Männer ein, mit ihm und seinen Gästen zu feiern. Sie sagten nicht nein, zumal es hieß, der Champagner sei schon kalt gestellt.
Caspar Sprotte war 1840 in Berlin als Sohn eines Schauspielers zur Welt gekommen und hatte mit heißem Bemühen Malerei und Baukunst studiert, ohne aber von den anderen als das Genie wahrgenommen zu werden, als das er sich selber sah. Auch seine Romane und Gedichte hatten nie einen Verleger gefunden. Schließlich war er in die Fußstapfen seines Erzeugers getreten und versuchte sich nun nach zwei Jahren an einer mittelmäßigen Schauspielschule als gehobener Statist an den Bühnen der preußischen Provinz. So hatten all die Großen einmal angefangen, und es gab schlechtere Plätze als Breslau und geringere Rollen als den Pförtner in Shakespeares Macbeth. Elend war das Leben eines Bohemiens in den Zeiten kaiserlichen Glanzes, aber Sprotte genoss es dennoch.
Vor der nächsten Probe saß er in der Kantine des Breslauer Stadttheaters am Exerzierplatz und memorierte seinen Text. »Das ist ein Klopfen! Wahrhaftig, wenn einer Höllenpförtner wäre, da hätte er was zu schließen. Poch, poch, poch: Wer da! In Beelzebubs Namen? Ein Pächter, der sich in Erwartung einer reichen Ernte aufhing…«
Das ging. Wenn er nur etwas zu trinken gehabt hätte! Bei seiner geringen Entlohnung war er gezwungen, sich zwei Stunden an einem Schoppen Wein festzuhalten.
Als er sein Glas bis auf den letzten Tropfen geleert hatte, lechzte er geradezu nach einem frischen Trunk, und just in diesem Augenblick kam ein Mann mit einem großen Korb voller Weinflaschen vorüber.
»Wein her!«, rief Sprotte. »Wein her, Burschen!/Stoßt an mit dem Gläselein, klingt! klingt!«
»Bravo«, rief der Mann mit den Weinflaschen. »Shakespeare, Othello, II. Akt, 3. Szene.«
»Ihr Bravo retour!« Da Sprotte im Gegensatz zu dem anderen seine Hände frei hatte, konnte er anhaltend klatschen. »Welche Bildung bei einem Boten!«
»Das hing bei meinem Vater im Bureau. Wir sind eine alte Weinhändlerfamilie.«
»Wir haben auch mit Weinen zu tun, mit Lachen und Weinen.«
»Sie sind hier im Engagement?«
»Erraten.« Sprotte rückte einen zweiten Stuhl zurecht. »Setzen Sie sich doch.«
Man stellte sich vor, und Caspar Sprotte erfuhr, dass der andere Berthold Kempinski hieß und kein simpler Bote war, sondern Kompagnon des Weinhauses M. Kempinski & Co., das auch Lieferant der Theaterkantine war, und außerdem Absolvent des bekannten Gymnasiums in Ostrowo. Sie kamen schnell ins Gespräch.
»Wie fühlen Sie sich hier?«, fragte der Schauspieler.
»Gemessen an Raschkow und Ostrowo erscheint mir Breslau wie eine strahlende Residenz«, antwortete Berthold Kempinski.
»Ach, Bres is lau. Leben lässt sich’s nur in Berlin.« Er hätte fast seine Probe verpasst, so sehr geriet er ins Schwärmen. Ein Assistent holte ihn schließlich.
»Schade«, sagte Berthold Kempinski. »Wann kann man Sie denn auf der Bühne erleben?«
»Nächsten Monat ist Premiere.« Sprotte schielte auf die Weinflaschen. »Wir können ja tauschen: Eine Flasche Wein gegen eine Theaterkarte.«
»Zwei Flaschen gegen zwei Karten.«
»Gut. Machen wir.«
Die Jüdische Gemeinde zu Breslau wuchs von Jahr zu Jahr. Hatte man 1850 an die 7200 Bürger mosaischen Glaubens gezählt, so sollten es 1900 schon mehr als 19 000 sein. Und so erwarb die Jüdische Gemeinde im Südosten der Schweidnitzer Vorstadt ein 4,6 Hektar großes Areal, das Raum für zwanzig Gräberfelder bot. Im November 1856 konnte dort das erste Begräbnis stattfinden.
Moritz und Berthold Kempinski gingen über diesen »Ort des Lebens« und suchten das Grab ihres Kunden Salomon Auerbach, dessen Sarg sich letztes Jahr in die Erde gesenkt hatte.
»Der Ewige gab, der Ewige nahm; es sei der Name des Ewigen gepriesen!« Mit der ihm eigenen Ernsthaftigkeit zitierte Moritz Kempinski Hiob 1, Vers 21.
Berthold Kempinski lachte und dachte an die Kria. »Nicht so feierlich, sonst zerreiße ich mir noch meine Kleider!« Für die nahen Verwandten des Verstorbenen war das fest vorgeschrieben. Damit sollte der Schmerz nach außen hin sichtbar gemacht werden. Der Riss in den Gewändern symbolisierte den Riss im Herzen.
Moritz Kempinski simulierte weiterhin den Gang von der Trauerfeier zum Grabe, der mehrmals unterbrochen wurde, um die Mühsal dieses Weges anzuzeigen, und rezitierte den Anfang des 91. Psalms: »Wer in dem Schutze des Höchsten sitzet, der ruhet im Schatten des Allmächtigen. Ich spreche zum Ewigen: Meine Zuflucht und meine Burg, mein Gott, dem ich vertraue. Denn er wird dich retten von der Schlinge des Vogelstellers.«
»Das tut ja nun in Breslau weniger not«, kam Berthold Kempinskis Zwischenruf.
Der Bruder sah ihn tadelnd an. »Treib aus den Spötter!« Das war aus den Sprüchen Salomos, und weil er viele von denen auswendig kannte, fügte er noch hinzu: »Mancher kommt zu großem Unglück durch sein eigen Maul.«
»Du, ich bin da die große Ausnahme: Mein Maul ist mein größtes Kapital und Glück. Ich unterhalte die Leute damit, ich sorge dafür, dass sie sich amüsieren – und sie danken es mir. So sind wir alle glücklich.« Berthold Kempinski hatte es in all den Jahren in Breslau gelernt, den Aggressionen des Bruders mit einem entwaffnenden Humor zu begegnen.
Der Bruder sah ihn böse an. »Ich möchte dir heute nicht bei uns am Abendbrottisch gegenübersitzen.«
»Da brauchst du nichts zu befürchten, ich gehe heute Abend ins Theater.«
Helene Hess kam aus einfachen Verhältnissen, ihr Vater war Rangierer bei der Königlich Sächsischen Eisenbahn in Leipzig und ihre Mutter Beiköchin in einem Gasthaus in der Nähe des Bayerischen Bahnhofs, und wie alle Mädchen ihres Standes träumte sie davon, einmal in die höheren Kreise einzuheiraten. Und ein Weinhändler mit einem Geschäft am Ring zählte ganz sicher dazu.
Vor ihr auf der Waschkommode stand der Blumenstrauß, den ihr Berthold Kempinski geschickt hatte. Zusammen mit einem Billett, das zwar kein richtiger Liebesbrief war, aber immerhin eine gewisse Anbetung erkennen ließ. Ins Theater lud er sie ein, und Theater war etwas für Herrschaften. Sein genaues Alter kannte sie noch nicht, aber sie schätzte, dass er mehr als zehn Jahre vor ihr auf die Welt gekommen war. Es war nichts Außergewöhnliches, dass ein Mann so viel älter war als die Frau, die er heiratete, es war sogar gut so, da hatte er sich schon die Hörner abgestoßen. Ein Beau war Berthold Kempinski nicht, aber durchaus ansehnlich und vor allem ein lustiger Kerl. Und in ihm steckte viel Energie, das hatte sie bei ihrer kurzen Begegnung zu Silvester instinktiv gespürt. Wenn er nun wirklich ernsthafte Absichten hatte … Sie war doch erst sechzehn und kannte die Welt nur aus Kolportageromanen. Mit wem sollte sie reden? In Breslau hatte sie noch keine beste Freundin gefunden.
Ich gehe mit ihm ins Theater, ich gehe nicht. Ich gehe, ich gehe nicht. Sie konnte sich nicht entscheiden. Schließlich nahm sie einen Würfel. Eins, zwei oder drei bedeutet: Ich gehe nicht. Vier, fünf oder sechs heißt: Ich gehe. Der Würfel rollte über die Marmorplatte.
Kommissarius Wilhelm Owieczek schlenderte über den Markt von Krotoschin. Er war gerufen worden, weil man an der Straße nach Ostrowo einen ausgeweideten jungen Mann gefunden hatte. Dem Leichnam hatten Herz, Leber und Teile aus dem rechten Oberschenkel gefehlt. Das war die Handschrift des Mannes, den er nun schon seit über fünfzehn Jahren suchte. Es war mit Sicherheit einer, der das Fleisch seiner Opfer kochte und konservierte. Da, wo es Leichenfunde gegeben hatte und junge Männer als verschwunden gemeldet waren, hatte er bunte Nadeln in die Karte der Provinz Posen gesteckt, und sehr schnell war ihm klargeworden, dass der Täter von Berufs wegen viel unterwegs sein musste. Außerdem konnte er davon ausgehen, dass der Mann alleinstehend war, denn vor einer Ehefrau oder einer Haushälterin hätte er sein Treiben nicht über so viele Jahre hinweg verheimlichen können. Im langen Winter hatte er sich nun mit mehreren Gehilfen darangemacht, die Melderegister aller Gemeinden zwischen der Stadt Posen und der schlesischen Grenze nach Männern abzusuchen, die alleinstehend waren und ihr Geld als Handlungsreisende, fliegende Händler, Schauspieler, Musiker, Akrobaten, Trödler, Lumpenmänner, Saisonarbeiter oder Lokomotivführer verdienten. Hunderte von Namen waren zusammengekommen, und Owieczeks Vorgesetzter hatte seine Arbeit als verlorene Liebesmüh bezeichnet.
Von den vielen Namen hatten sich nur wenige in sein Gedächtnis eingeprägt, und einer von denen war Krojanke. Warum, das wusste er nicht. Wahrscheinlich, weil seine Mutter eine geborene Jahnke war.
Und nun hörte er den Namen Krojanke am Stand eines Mannes, der Scheren, Messer, Sägen, Feilen, Äxte und Beile verkaufte und gerade mit einem Förster verhandelte.
»Die nehm ich, Krojanke«, sagte der Forstbeamte und prüfte die scharf geschliffene Klinge noch einmal mit Zeigefinger und Daumen.
»Da können Se Papier mit schneiden.« Krojanke ließ sich die Axt noch einmal geben, um es zu demonstrieren.
Dabei entdeckte Owieczek einen rötlichen Fleck auf dem Stiel, und zwar da, wo sich ein kleiner Ratscher in der Lackierung befand. Dieser Fleck war ganz einfach zu erklären, denn Krojanke hatte Stunden zuvor Rote Beete gegessen, und dabei war ein wenig Saft auf seine Auslagen gekleckert. Owieczek aber hatte eine ganz andere Assoziation: Blut! Es schoss ihm durch den Kopf, wie ein Reflex, und gleichzeitig fiel ihm wieder ein, dass damals in Raschkow der Regierungsreferendarius Sigismund von Schecken mit einer Axt erschlagen worden war. Vielleicht hatte er sterben müssen, weil er den Kannibalen schon damals entdeckt hatte? Ach, alles Hirngespinste!
Dennoch setzte sich Owieczek am Abend hin und schrieb einen Brief an seine Kollegen in der Stadt Posen. Sie mögen doch bitte in Erfahrung bringen, wo dieser Krojanke ansässig war, und sich einmal in dessen Wohnung umsehen.
Moritz Kempinski war wenig erbaut davon, dass sich sein Bruder mit Fräulein Hess verloben wollte.
»Ein Dienstmädchen, Berthold, ich kann es nicht fassen! Wollen wir mit unserer Firma expandieren, brauchen wir dringend neues Kapital. Und ich habe so sehr mit der Mitgift deiner Braut gerechnet.«
»Es ist Liebe – und gegen diese Himmelsmacht kann keiner an.«
»Das Leben ist kein Kolportageroman!«
Berthold Kempinski lachte. »Dann mache ich’s eben dazu.«
»Das Lachen wird dir schon noch vergehen.«
Und diese Prophezeiung sollte sich alsbald erfüllen, denn bei ihnen in der Ohlauer Straße 73, wohin sie inzwischen mit ihrer Firma umgezogen waren, erschien ein Mann, der sich als Kommissarius Wilhelm Owieczek aus Posen vorstellte.
»Ich komme wegen eines versuchten Mordes.«
»Wir sind nicht Kain und Abel!«, rief Berthold Kempinski, nachdem man sich gegenseitig vorgestellt hatte. Jetzt erst ging ihm ein Licht auf. »Gott, Sie sind doch der, der mich damals in Raschkow vernommen hat, weil ich den erschlagenen Regierungsreferendarius gefunden habe.«
»Ja, in der Tat.« Auch Owieczek konnte sich wieder daran erinnern. »Da waren Sie noch ein Schuljunge.«
»Und jetzt stehe ich kurz davor, die Frau fürs Leben zu heiraten.«
»Gratuliere.« Owieczek schüttelte ihm die Hand. »Zu Ihrer Braut und dazu, dass sie dem Tod gerade so von der Schippe gesprungen sind.«
»Wie das?« Berthold Kempinski konnte nicht verhindern, dass er doch ein wenig blass wurde.
»Setzen wir uns erst einmal.« Der Kommissarius nahm Platz und ließ seine Blicke über die Weinregale schweifen. »Ein Glas Wasser haben Sie nicht für mich?«
»Doch«, sagte Moritz Kempinski und gab dem Gehilfen einen Wink, in die Küche zu eilen.
Berthold Kempinski hielt den jungen Mann zurück. »Sie dürfen ja keinen Schnaps im Dienst trinken, aber wohl ein Glas Wein, Posen ist schließlich weit weg.«
»Oh, gerne!« Owieczek freute sich immer wieder, wenn er auf Menschen traf, die Gedanken lesen konnten. Nachdem er sich gelabt hatte, begann er zu erzählen. Wie er durch den roten Fleck auf der Axt, aber auch durch die anderen Fakten auf Krojanke gekommen war und dass sie in seinem Haus in Obersitzko grausiges Beweismaterial in Hülle und Fülle gefunden hatten.
»Das habe ich schon alles in der Zeitung gelesen«, sagte Berthold Kempinski ein wenig enttäuscht. »Und warum soll ich da dem Tod von der Schippe gesprungen sein? Weil ich den Regierungsreferendarius gefunden habe?«
»Nein, weil Sie auf Krojankes Liste gestanden haben, auf einer Liste mit jungen Männern, auf die er mächtig Appetit gehabt hat. Und einmal hatte er sie auch schon an der Angel, wie er mir erzählt hat. Irgendwann im Jahre 1861. Da waren Sie zu Fuß von Ostrowo nach Raschkow unterwegs, und er hat sie auf seinem Wagen mitgenommen. Wenn nicht das Rad gebrochen wäre, dann … Die Axt lag schon bereit.«
Berthold Kempinski schwieg. Fast hätte er ein Dankgebet gen Himmel geschickt.
Des Menschen Seele ist ein merkwürdig Ding, hatte Dr. Dramburger immer gesagt, und daran musste sich Berthold Kempinski in den nächsten Tagen des Öfteren erinnern, denn jetzt, wo Krojanke hinter Schloss und Riegel saß und bald geköpft werden würde, kam die Angst. Er sah Krojanke mit seiner Axt hinter jeder Ecke lauern, und ein Gedanke beherrschte ihn mehr und mehr: Bloß weg von hier, weg von Posen und Breslau!
Das deckte sich mit Helenes Wunsch, lieber heute als morgen nach Berlin zu ziehen, denn die Reichshauptstadt war für sie, wie er immer wieder spottete, das, was für die alten Griechen der Berg Ida war, der Geburtsort des Zeus.
»Das ist doch widernatürlich, dass du als Sächsin nach Preußen willst.«
»Jetzt sind wir doch alle ein Land – und Schlesien ist schließlich auch preußisch.«
Berthold Kempinski konnte sich nicht entscheiden, ob er Berlin herrlich oder scheußlich finden sollte. Er kannte es nur vom Hörensagen, vor allem aus den Erzählungen seines Freundes Caspar Sprotte. In Raschkow war er wer, in Breslau kannten ihn und die Firma M. Kempinski & Co. immerhin alle Honoratioren der Stadt, aber in Berlin war er ein absoluter Niemand.
»Was soll ich denn da?«, fragte er seine zukünftige Gattin, als er mit Helene und Moritz zusammen bei Tische saß.
Helene lachte. »Was du da sollst? Na, Berlin erobern. E’ jeder hat sei’ Steckenfärd.«
»Berlin erobern – vielleicht mit meinen Jonglierkünsten?« Er schaffte es immerhin, drei leere Weinflaschen durch die Luft zu wirbeln und vor seiner Nase kreisen zu lassen, wenn auch nur selten, ohne dass sie irgendwann zu Boden fielen und zerschellten.
»Mit deiner Kenntnis von guten Weinen.«
Berthold Kempinski kaute an seinem Rinderbraten und geriet wieder ins Wanken. »Und wenn ich nun doch in Breslau bleibe und wir zusehen, dass wir zum Weinhandel noch ein eigenes Restaurant aufmachen?«