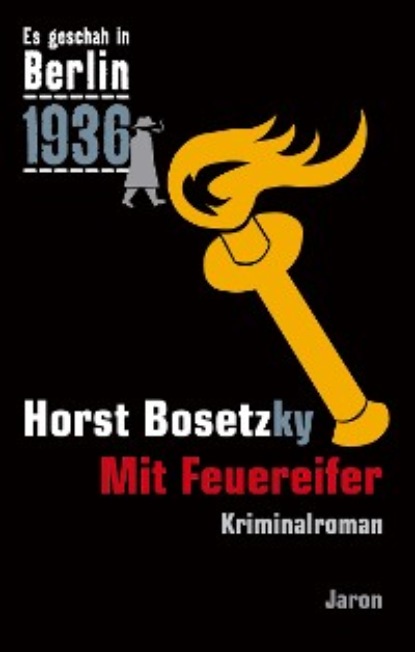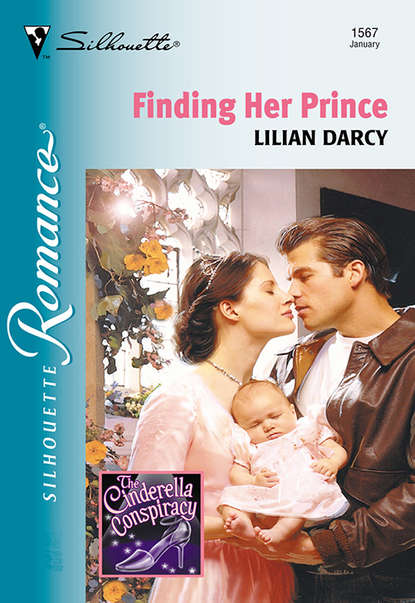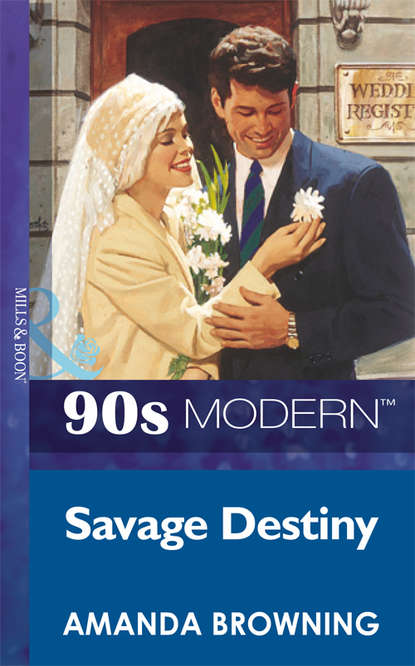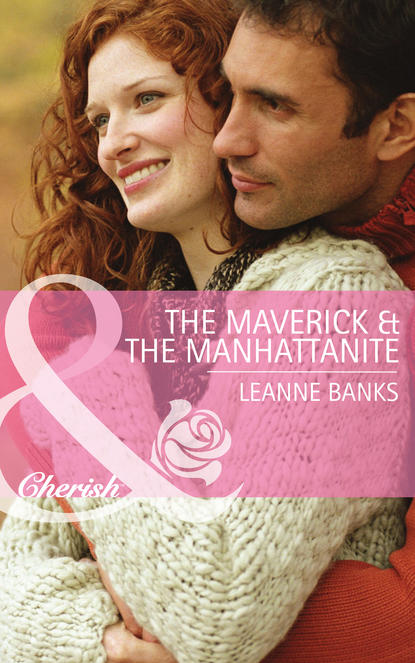- -
- 100%
- +
Gustloff, gelernter Bankkaufmann, war wegen eines chronischen Lungenleidens nicht eingezogen worden und 1917 nach Davos gegangen, um sich dort auszukurieren. In der Schweiz geblieben, war er 1929 der NSDAP beigetreten und 1932 Landesgruppenleiter der Auslandsorganisation geworden. In dieser Funktion hatte er antisemitische Hetzschriften verbreitet und fünftausend Auslandsdeutsche für die NSDAP gewonnen. Am 4. Februar 1936 war er in seiner Davoser Wohnung von dem Medizinstudenten David Frankfurter, dem Sohn eines Rabbiners, erschossen und von den Nationalsozialisten als «Blutzeuge der Bewegung» zum Helden gemacht worden. Nun war der Sarg mit einem Sonderzug in Schwerin angekommen, und 35 000 Menschen standen Spalier.
Kappe grauste es vor diesem Trauerspektakel. Er quetschte sich durch die Menge, um schnell in sein Hotel zu kommen, das in der Nähe der St.-Anna-Kirche gelegen war.
Als er am nächsten Morgen zum Landgericht eilte, stieß er auf dem Demmlerplatz mit Karl-Heinz Wanzka zusammen, einem windigen Burschen aus Berlin, der sich als Einbrecher, Hehler und Erpresser einen Namen gemacht hatte, aber immer mit milden Strafen rechnen konnte, weil er für die Polizei als V-Mann unentbehrlich war. Zwar suggerierte die gleichgeschaltete Presse den Deutschen, dass im NS-Staat alle individuelle Kriminalität nahezu ausgerottet sei, doch gab es immer noch eine erhebliche Anzahl schwerer Eigentums- und Rohheitsdelikte, und das Berufsverbrechertum war längst nicht zerschlagen. Die alten Ringvereine bestanden im Geheimen weiter, und Zuhälter und Prostituierte dominierten wie früher bestimmte Lokale und Straßenstriche in Kreuzberg und Friedrichshain. Selbst Erich Liebermann von Sonnenberg, seit 1936 Chef der Berliner Kriminalpolizei, musste eine gewisse Machtlosigkeit einräumen: «An der Front fühlt man schon, dass der Schock, den der scharfe Zugriff der nationalsozialistischen Polizei dem gesamten Verbrechertum beigebracht hat, an Wirkung zu verlieren beginnt.»
Vor diesem Hintergrund musste Kappe zu einem Mann wie Wanzka, den er eigentlich nur eklig fand, scheißfreundlich sein.
«Was machen Sie denn hier in Schwerin?», fragte er, während sie sich die Hände schüttelten. «Ein Verwandtenbesuch?»
Wanzka grinste. «Nee, und ick verbitte mir diese Beleidigung!»
«Ah, haben Sie hier wieder eine Stelle als Kellner gefunden?»
«Auch nicht.» Wanzka nahm Haltung an. «Ich bin amtlich geladener Zeuge im Prozess gegen Onkel Ticktack.»
Kappe staunte. «Sie kennen Adolf Seefeldt?»
«Ja, er hat sich auch mal an mich rangemacht, als ich noch ein Junge war, aber ich bin ihm nicht auf den Leim gegangen.»
Jetzt begriff Kappe die Zusammenhänge. Es war bekannt, dass Wanzka der Berliner Schwulenszene angehörte und auch Seefeldt Homosexueller war.
Sie plauderten noch ein wenig, dann trennten sich ihre Wege. Wanzka hatte sich bei einem Justizwachtmeister zu melden, Kappe orientierte sich in Richtung Sitzungssaal.
«Bis bald einmal», sagte Kappe.
Wanzka grinste. «Nee, Herr Kommissar, wenn ick ooch ’n Aas bin, ’n Mörder bin ick nich.»
DREI
DER STARTER hob seine Pistole und wartete, bis die Läufer an die weiße Linie getreten waren, die sich in sanfter Krümmung von der Innenzur Außenbahn zog. «Auf die Plätze …» Wo ihre Spikes in die hart gewordene Kruste der Aschenbahn drangen, stiegen kleine Staubwölkchen auf. «Fertig …»
Martin Kammholz hatte Mühe sich zurückzuhalten, das Zucken seiner Muskeln ließ sich kaum noch unterdrücken. Der Startschuss war eine Erlösung und nur vergleichbar mit dem Höhepunkt beim Beischlaf. Nein, der Vergleich war falsch, denn nun folgte keine Phase der Erholung, sondern eine der höchsten Anstrengung. Eine Neugeburt war es nicht, aber eine Metamorphose: Hatte er sich eben noch wie ein müder, alter Mann gefühlt, so war er jetzt ein junger Gott, der dahinflog wie eine Gazelle und dabei war, die Schwerkraft aufzuheben.
Laufen war Leben, nur wenn er lief, dann lebte er wirklich. Der Mensch war ein Lauftier, Laufen war etwas Archaisches. Wer schneller lief, hatte größere Chancen zu überleben, er konnte seinen Feinden wie seinen Beutetieren besser folgen, um sie zu erlegen, ihnen aber auch eher entkommen, wenn sie stärker waren als er.
Martin Kammholz wäre auch gelaufen, wenn es keinen Wettkampf gegeben hätte, wie seine Urahnen ja auch über die Savannen gelaufen waren, ohne dass es um Meisterehren und goldene Medaillen gegangen wäre. Aber ein Sieg überhöhte alles noch, und es gab keinen stärkeren Rausch als das Wissen, der Beste zu sein: die Nummer eins in der Region, im Land, in Europa und schließlich in der ganzen Welt. Dafür trainierte er seit zehn Jahren, und wäre ein Samiel gekommen, dann hätte er ihm, ohne zu zögern, seine Seele verkauft, wenn er dafür Olympiasieger geworden wäre. Er sah die Schlagzeilen vor sich: Martin Kammholz, der Telegraphenbauhandwerker aus Berlin, erringt die Goldmedaille im 1500-Meter-Lauf.
Doch das war nur zu schaffen, wenn er bis dahin keinem Wettkampf aus dem Wege ging, denn nur im Ringen mit den anderen gewann man die nötige Härte, um gegen die Großen der Zunft eine Chance zu haben, mit dem Training allein war es nicht getan. Und so war er nach Köln gefahren, wo bei einem Sportfest einige Männer am Start waren, denen man zutrauen konnte, die 1500 Meter unter vier Minuten zu laufen. Diese Zeit hatte lange als Schallmauer gegolten, und selbst der große Otto Peltzer war nie mit einer Zeit unter vier Minuten Deutscher Meister geworden. Martin Kammholz hatte eine Bestzeit von 3 Minuten 56,9 Sekunden, und im Deutschen Reich waren nur wenige schneller als er. Der Rekord, gehalten von Otto Peltzer, stand im Augenblick bei 3 Minuten 51,0 Sekunden, er stammte schon aus dem Jahre 1926. Den zu knacken war ein weiterer Traum.
Auf den ersten vierhundert Metern ließ es Kammholz ruhig angehen, denn er liebte es, den Pulk der Läufer vor sich zu haben. Alle waren rank und schlank und hatten den leptosomen Körperbau, den er so liebte. Lief er schräg nach außen versetzt, konnte er am besten verfolgen, wie sich die durchtrainierten Oberschenkel hoben und senkten und sich die Hosen über ihnen derart spannten, dass der Stoff zu zerreißen drohte.
Nach etwa achthundert Metern verschärfte er das Tempo und genoss es, das Feld von hinten aufzurollen. In der Mitte angekommen, bremste er aber wieder ab, um andere passieren zu lassen. Bald war er eingeschlossen, roch den Schweiß der anderen, berührte ihre Arme, streifte ihre Körper, hörte ihren Atem, spürte ihre Kraft, die ihn in pulsierenden Wellen erreichte. Er fühlte sich wie ein Büffel inmitten einer Herde, die mit Urgewalt über weites Grasland fegte.
Eine besondere Lust war es, an der Spitze zu laufen und den anderen davonzufliegen. Sein Körper wurde immer leichter, das Gefühl der Überlegenheit hob jede Schwerkraft auf, er war so viel besser als die anderen, dass er mit ihnen spielen konnte.
Er bog als Erster auf die Zielgrade ein und erkannte das gespannte Band an ihrem Ende. Er lief in gleißendes Licht hinein, sah sich gleichzeitig auf der Tribüne stehen und sich zujubeln und hätte schreien mögen vor Glück. Es war ein göttliches Gefühl, ein Augenblick, in dem er eins war mit dem Kosmos, ein Augenblick, der so schön war, dass er ewig dauern konnte.
«Sieger über 1500 Meter: Martin Kammholz, CSC Berlin!», schrie der Stadionsprecher.
Die Reichspost hatte Kammholz den Montag freigegeben, so musste er nicht in der Nacht nach Berlin zurückfahren. Unterkunft hatte er in einer kleinen Pension in der Gereonstraße gefunden, deren Eigentümer Josef Wüllenrath, ein Freund der Leichtathletik, über die 1500 Meter immerhin eine Bestzeit von 4 Minuten 15,4 Sekunden zu Buche stehen hatte. Da Kammholz erst den Zug um elf nehmen wollte, konnte er in aller Ruhe frühstücken.
Auf dem Frühstückstisch lag der Völkische Beobachter. Aufmacher war die feierliche Eröffnung des Deutschen Juristentages in Leipzig. Das verdarb Kammholz fast den Appetit, denn er hatte eine starke Abneigung gegen alle Juristen, und als er las, welche NS-Größen in den vorderen Reihen Platz genommen hatten, wurde dieses Gefühl noch um einiges stärker. Da waren die Reichsminister Heß und Dr. Frank, der Staatssekretär Freisler und Mutschmann, der Gauleiter von Sachsen.
Die linke Hälfte der Titelseite des Völkischen Beobachters wurde von einer Traueranzeige beherrscht. Julius Schreck war gestorben. Einer der Ersten, Besten und Treuesten ging von uns, hieß es. Schreck war über die «Brigade Erhardt» und den «Stoßtrupp Hitler» zu SA und SS gekommen und hatte zuletzt zum Führer-Begleitkommando gehört.
Kammholz las im Nachruf:
Nur ein kleines Erlebnis, das die eiserne Pflichtauffassung unseres toten Kämpfers zeigt: Es war im Jahre 1926 auf Versammlungsfahrt durch Mecklenburg. Schreck saß am Steuer, neben ihm der Führer. In zwei Stunden sollte Adolf Hitler sprechen. Noch waren 160 Kilometer zurückzulegen. Da erkrankte plötzlich Schreck an Vergiftungserscheinungen. Vor Schmerzen war er einer Ohnmacht nahe. Doch er ließ nicht vom Steuer, fuhr durch die Nacht, bis er am Ziel zusammenbrach. Das war Julius Schreck.
«O Schreck, nu is er weg!» Josef Wüllenrath war lautlos in den Raum gekommen und hinter Kammholz getreten.
Kammholz war zusammengefahren. «Hab ich einen Schreck bekommen!»
«Und der Schreck wird ein Staatsbegräbnis bekommen.»
«Hirnhautentzündung», sagte Kammholz.
«Dann muss er wohl ein Hirn gehabt haben, sonst hätte sich das nicht entzünden können. Erstaunlich.»
«Pst», machte Kammholz. «Können wir nicht über etwas anderes reden …»
«Wie geht es Ihrer Frau?», fragte der Kölner.
Kammholz lächelte. «Danke, Helga arbeitet jetzt als Direktrice im Modehaus Tauentzien, und es geht ihr gut.»
«Wann wird es denn Kinder geben?»
«Nach den Olympischen Spielen …»
Josef Wüllenrath nickte. «Das kann ich gut verstehen. Deutschland hat ja über 1500 Meter noch nie eine Medaille gewonnen, und wenn Sie da der Erste sind …» Er ging zu seiner Anrichte und holte eine Art Kladde hervor, in der die deutschen Olympiateilnehmer über diese Strecke eingetragen waren. «1896 in Athen war Carl Galle immerhin Vierter … in 4 : 39,0. Da hätte ich ja noch gewonnen!
1900 in Paris ist Werkmüller Neunter geworden, 1904 in St. Louis war Johannes Runge Fünfter und 1928 in Amsterdam Hans Wichmann Vierter … mit einer tollen Zeit: 3 : 56,8.»
Kammholz schmierte sich dick Butter auf sein Brötchen.
«Der Weltrekord von William Bonthron liegt bei 3 : 48,8, und wahrscheinlich muss man in Berlin noch etwas schneller laufen, wenn man die Goldmedaille holen will.»
«Silber oder Bronze wären ja auch ganz schön, Hauptsache ist doch, dass auf unserer Strecke endlich auch mal ein Deutscher das Siegerpodest erklimmt!», rief der Kölner mit einigem Pathos.
«Ihnen fehlen noch ganze fünf Sekunden, lieber Kammholz, dann …»
Weiter kam er nicht, denn ohne dass jemand geklingelt oder an seine Eingangstür geklopft hätte, standen plötzlich drei Männer im Flur. Sie mussten sich mit Hilfe eines Dietrichs oder eines Nachschlüssels Zutritt verschafft haben.
Ihr Anführer legte den Finger auf den Mund. «Pst! Geheime Staatspolizei.»
Die drei Gestapo-Leute stürmten zum Zimmer 8, wo sie zwei Männer im Bett vorfanden, die sie kräftig zusammenschlugen, bevor sie sie abführten.
Josef Wüllenrath saß kreidebleich auf seinem Stuhl und musste sich mit beiden Händen an der Tischkante festhalten, um nicht zur Seite wegzukippen. «Dieser Kanthack wieder», murmelte er.
Im Mai 1935 war im Geheimen Staatspolizeiamt Berlin, Gestapa genannt, ein eigenes Homosexuellenreferat geschaffen worden (zunächst II 1 H 3), und in dessen Auftrag zog nun der Berliner Kriminalkommissar Gerhard Kanthack, der von der Kripo zur Gestapo versetzt worden war, durch Deutschland und entfesselte vor Ort Kampagnen gegen Homosexuelle. Auf seine Opfer kam er des Öfteren durch anonyme Anzeigen, so auch auf die beiden Männer in der Pension von Josef Wüllenrath. Am 1. September 1935 war die Verschärfung des Paragraphen 175 RStGB in Kraft getreten, und drastische Strafen drohten nun allen, denen jede Art gleichgeschlechtlicher Unzucht nachgewiesen werden konnte, worunter nicht nur beischlafähnliche Handlungen, sondern auch wechselseitige Onanie verstanden wurde.
«Was wird nun mit den beiden?», fragte Kammholz.
Der Kölner wusste einiges darüber. «Bei uns in Preußen können Homosexuelle nach dem Gewohnheitsverbrechergesetz Paragraph 20 a erfasst und nach einmaliger Verurteilung in ‹Vorbeugehaft› genommen werden. Wer daraus wieder freigelassen wird, kann polizeilich überwacht werden. Hinzu kommt noch: Man darf sich nicht mehr an bestimmten Örtlichkeiten aufhalten, nachts nicht mehr ausgehen, kein Auto oder Motorrad besitzen und muss einen Hausschlüssel bei der Polizei hinterlegen. Und wenn’s ganz schlimm kommt …» Josef Wüllenrath senkte die Stimme. «Einen meiner Berliner Freunde haben sie schon ins Konzentrationslager gesteckt.»
VIER
MAX BRAUN und seine Frau Lore wohnten in der Jansastraße in Neukölln, und zwar im dritten Stock des Seitenflügels. Er arbeitete als Lagerverwalter bei Pfaff am Maybachufer, sie war Verkäuferin in einem Lebensmittelgeschäft in der Pannierstraße. Kinder hatten sie noch keine, was Max sehr schmerzte, denn er hatte sich vorgenommen, dem Führer viele Kinder zu schenken. Ihr Traum war ein Häuschen draußen im Grünen, wenn in den nächsten Jahren besondere Siedlungen für Parteigenossen entstanden. Nicht zuletzt deswegen war er 1932 in die NSDAP eingetreten. Vorher hatte Max eher mit den Kommunisten sympathisiert.
Um neun Uhr standen Max und Lore auf, um zu frühstücken. Es war Sonntag. Die beiden waren ziemlich zerschlagen, denn sie hatten gerade zwei Versuche hinter sich, einen Stammhalter zu zeugen.
«Wat machen wa heute?», fragte Lore, um sich gleich selber die Antwort zu geben. «Wir fahr’n nach Jrünau raus.»
Als Neuköllner kannten sie keine anderen Ausflugsziele als die Woltersdorfer Schleuse, den Werlsee, das Strandbad Müggelsee, Grünau, den Langen See, die Große Krampe, Schmöckwitz, den Zeuthener See und die Zernsdorfer Lanke. Der Wannsee und die Tegeler Wälder und Gewässer waren für sie fremde Welten, in die man nur fuhr, wenn es unbedingt sein musste.
Max ließ seine Hosenträger gegen den Brustkorb schnellen.
«Denkste, Puppe, heute jeht’s mal anne Havel.»
«Wieso ’n ditte?» Lore konnte es nicht fassen.
«Weil ick ma die Marathonstrecke langloofen möchte.» Auch ihn hatte das olympische Fieber gepackt.
Lore lachte höhnisch. «Du und die janzen fuffzich Kilometa!»
«Nee, nur det Stücke anne Havel unten. Und im Übrigen sind et nur 42 Kilometa und ’n paar Zerquetschte. Und Schildhorn könn’ wa baden, mein Chef jeht da ooch imma hin.»
Damit war Lore überredet, und um halb elf machten sie sich auf den Weg. Max hatte über die optimale Verbindung lange nachdenken müssen und dann entschieden, mit der U-Bahn vom Hermannplatz - einmal umsteigen Stadtmitte - bis zum Adolf-Hitler-Platz zu fahren und dort die Straßenbahn Richtung Spandau zu nehmen. «Mit der 58 oder der 75 bis zur Stößenseebrücke.» Nach knapp anderthalb Stunden standen sie auf der Stößenseebrücke. Sie brauchten eine Weile, bis sie realisiert hatten, dass sie noch immer in der Reichshauptstadt waren und die Gegend hier zum Berliner Bezirk Charlottenburg gehörte.
Max Braun, der eigentlich schon die zweihundert Meter zur Milchfrau als Langstreckenlauf empfand, hatte ein merkwürdiges Faible für den Marathonlauf, vielleicht deswegen, weil er die einzige Eins seiner gesamten Schullaufbahn für die Antwort chaírete nikômen bekommen hatte. Das hatte laut Überlieferung der griechische Soldat ausgerufen, der 490 vor Christus nach der Schlacht bei Marathon den über vierzig Kilometer langen Weg nach Athen gelaufen war, um den Triumph über die Perser zu melden: «Seid gegrüßt! Wir sind Sieger!» Nach diesem Ausruf war die Klasse vom Lehrer gefragt worden, und er, Max Braun, hatte die Antwort gewusst, weil er von seinem Großvater, der ein paar Jahre lang als Ingenieur in Griechenland gearbeitet hatte, mit allem Hellenischen traktiert worden war. Natürlich kannte er auch den Marathonsieger der ersten Olympischen Spiele der Neuzeit, den Griechen Spyridon Louis, und alle seine Nachfolger. 1924 in Paris, wo die Sonne an der Seine gebrannt hatte wie in der Sahara, war der vierzigjährige Finne Albin Stenroos als Erster durchs Ziel gelaufen, 1928 auf dem harten Kopfsteinpflaster von Amsterdam hatte der Algerier Boughera El Quafi gesiegt und 1932 auf den breiten, von Palmen gesäumten, aber schattenlosen Straßen von Los Angeles der kleine Argentinier Carlos Zabala.
Die Berliner Marathonstrecke war mit Sicherheit einzigartig, denn sie führte weithin durch den Grunewald. Vom Olympiastadion ging es über die S-Bahn hinweg zum Stößensee und dann auf der Havelchaussee bis hinunter zum Schlachtensee, wo auf der Avus weiterzulaufen war. Wendepunkt war an der legendären Nordkurve, dann hatten die Läufer auf demselben Weg ins Stadion zurückzukehren.
«Da müssen die Kampfrichter aba uffpassen, sonst kürzt da eena uff da Avus wat ab», sagte Lore. «Einfach mal uff de andre Fahrbahn jehüpft, und schon biste weit vor die anderen, wenn die erst inne Nordkurve müssen.»
Max beruhigte sie. «Da wird schon eena Obacht jeben.» Gleichzeitig fiel ihm aber ein, dass bei den Olympischen Spielen 1904 in St. Louis der Amerikaner Frederick Lorz als Erster ins Stadion eingelaufen war und das Zielband zerrissen hatte. Nachdem ihn seine Landsleute jubelnd als Marathonsieger gefeiert hatten, war herausgekommen, dass er die Hälfte der Strecke in einem Auto zurückgelegt hatte.
«Alle Achtung!», rief Lore, als er ihr diese Anekdote erzählt hatte. «Da kannst du ja ooch Olympiasieja werden.» Dann rechnete sie und stellte fest, dass die Hälfte von 42 auch noch eine Menge war.
«Nee, du brichst mir ja schon nach ’m halben Kilometa zusammen.»
«Und du schon nach hundert Metern. Aba bei dir jibt et ooch noch ’n Fettfleck uff de Straße.»
Damit stiegen sie die lange Treppe zur Havelchaussee hinunter, und Max Braun beschlich ein hehres Gefühl, als sie unten auf dem Asphalt standen. «Hier wer’n se nun langkommen.»
«Willste etwa hier stehen und zusehen?», fragte Lore.
«Klar, ick nehm ma extra ’n Urlaubstag dafür.»
«Det kann doch nich dein Ernst sein!»
Max nickte. «Doch, det isset! Eene Macke muss der Mensch ja haben.»
«Dann musste aba ooch die janze Strecke abloofen», sagte Lore.
«Nee, nur bis nach Schildhorn und dann quer durch ’n Wald bis zur S-Bahn.»
«Komm ma, Bewegung tut dir jut.»
Max stöhnte auf. «Ick hab schon jenuch Bewegung jehabt heute morjen.» Damit meinte er seine Bemühungen, einen Sohn zu zeugen. Er gähnte demonstrativ.
«Keene Müdigkeit vorschützen. Nimm dir ’n Beispiel an dem Kammholz, wenn der beim Marathon hier langhetzen tut.»
Max Braun verdrehte die Augen. «Martin Kammholz läuft über 1500 Meter.»
«Is mir doch wurscht, aba ’n schöner Mann isset.» Sie hatte sein Photo neulich im Völkischen Beobachter gesehen, wo man ihn als eine der größten deutschen Olympiahoffnungen in der Leichtathletik gepriesen hatte. «Nu los!» Sie gab ihrem Mann einen kleinen Schubs.
Knapp fünf Kilometer lagen vor ihnen, doch sie waren keine dreihundert Meter gelaufen, da drückte Lore die Blase. «Ick muss ma mal inne Büsche schlagen.»
«Mach dit, aba pass uff, dette keem Unhold inne Hände fällst.»
Weil ihr die Sache doch genierlich war, entfernte sich Lore ziemlich weit vom Weg, und ihr Mann hatte sie bald aus den Augen verloren. Während er wartete, bückte er sich, um den Ameisen zuzusehen, die dabei waren, einen toten schwarzen Käfer auszuweiden. Ein Schrei ließ ihn hochfahren.
«Maxe, Hilfe, ’n Mann!»
Er stürzte in die Richtung, in die seine Frau gegangen war.
Da kam ihm Lore schon entgegengeflogen. «Da liegt ’n Tota, allet volla Blut!»
FÜNF
HERMANN KAPPE ließ den Sonntag ruhig angehen. Nach dem Frühstück hatte er sich auf die Toilette zurückgezogen, um den Völkischen Beobachter zu lesen, den sein Sohn vom Zeitungsstand an der Ecke geholt hatte. Jetzt war er schon auf der Seite mit Roman, Rätsel, Rundfunkprogramm und Wetterbericht.
Der Roman stammte aus der Feder von Martin Luserke und trug den Titel Obadjah und die ZK 14. Ein Seemann und sein Fischerboot dienten als Erkennungszeichen. Es ging um einen jungen Fischer, und da Kappe schließlich aus einer Familie von Fischern kam, hatte er angefangen zu lesen, obwohl er den Namen Obadjah fürchterlich fand. Ein gebildeter Kollege hatte gemeint, es sei der Name eines Propheten.
Kappe begann zu lesen: In Obadjahs Blut steckten die Erlebnisse zahlloser Geschlechter von Fischerleuten. Selbst während der Wanderjahre mitten im Binnenland hatte sein Gefühl einen Zusammenhang mit dem Gleichmaß von Flut und Ebbe draußen bewahrt. Kappe musste schmunzeln. Bei ihnen zu Hause am Scharmützelsee hatte es Ebbe nur in der Haushaltskasse gegeben und eine Art Flut nur zweibis dreimal im Jahr, wenn der Sturm, kam er von Norden, zwölf Kilometer lang über den See gefegt war.
Er ließ Obadjah Obadjah sein und vertiefte sich in den Wetterbericht für das Reich. In Süddeutschland und Schlesien war es noch stark bewölkt bis bedeckt, für Norddeutschland wurden Wolken und nur vereinzelte Regenschauer vorausgesagt. Allgemein sei es ziemlich kühl.
Nach dem Toilettengang setzte sich Kappe im Wohnzimmer an seinen Schreibschrank und vertiefte sich in eine neue Abhandlung über die Germanen: wie im Jahre 105 vor Christus die Kimbern und Teutonen die Römer bei Arausio an der Rhône vernichtend schlugen, 120 000 Legionäre und Trossknechte töteten und anschließend den Gefangenen die Kehlen durchschnitten oder sie aufhängten und sämtliche Kriegsbeute zerhackten und im Fluss versenkten. Furor Teutonicus hatten die Römer diese Raserei genannt. Kappe hatte die Germanen schon lange vor der Zeit geliebt, als Adolf Hitler durch die Lektüre der Ostara -Hefte zur Ansicht gelangt war, die Germanen seien allen anderen Völkern überlegen. Nun schämte sich Kappe irgendwie für seine Vorliebe, er wusste aber auch, dass sie bei seinen Vorgesetzten gut ankam und als ein gewisses Äquivalent für seine rote Herkunft angesehen wurde. Bei seinem Vornamen musste man ja automatisch an Hermann den Cherusker denken, von Hermann Göring ganz zu schweigen. Wenigstens hieß er nicht Horst, benannt nach Horst Wessel.
Bei Klara Kappe hatte alles seine feste Ordnung, und so stand jeden Sonntag Punkt halb eins das Mittagessen auf dem Tisch, egal, ob einer schon Hunger hatte oder nicht. Außerdem bestand sie darauf, ein Menü zuzubereiten, wobei die Variationsbreite nicht eben groß war. Vor- und Nachspeise waren im Sommer immer gleich: Tomatensuppe vor und Grießpudding mit Kirschkompott nach dem Hauptgericht. Das lag daran, dass sie Tomaten und Kirschen ebenso billig wie frisch aus Wendisch Rietz bekam, wo Kappes Bruder Albert einen großen Garten hatte. Was das Hauptgericht betraf, gab es eine feste Abfolge: Falscher Hase, Gulasch, Schmorbraten, Kassler und Rouladen, so dass alle fünf Wochen das Gleiche auf dem Tisch stand. Heute waren Rouladen an der Reihe, und Kappe freute sich schon auf den Kampf mit dem Bindfaden, denn Klara weigerte sich strikt, metallene Spieße zu benutzen, weil die ihrer Meinung nach den Geschmack des Fleisches verdarben.
«Zu Tisch, bitte!», hörte es Kappe aus der Küche rufen. Seufzend legte er seinen Band über die Germanen aus der Hand. Gern hätte er noch ein Weilchen gelesen.
Seine Familie saß schon am runden Esstisch. Immer, wenn er seine Lieben ansah, war Kappe verwundert: Wie alt Klara inzwischen geworden war, und wie groß, beinahe erwachsen der erstgeborene Sohn und die Tochter waren!
Margarete war gerade dabei, ihre Lehre als Schneiderin zu Ende zu bringen. Hartmut ging noch zur Schule und sollte, getrieben vom Ehrgeiz seiner Mutter, 1939 das Abitur machen. Hoffentlich noch vor Kriegsbeginn, dachte Kappe, denn dass es Krieg geben würde, glaubten sowohl seine Freunde, die Hitlergegner waren, als auch seine Kollegen, die auf Adolf Hitler schworen. «Wartet erst einmal ab, bis die Olympischen Spiele vorbei sind», hieß es überall, so lange tue der Führer so, als habe er Kreide gefressen. Karl-Heinz, der Nachkömmling, war nun auch schon neun Jahre alt und ein kräftiger Kerl.