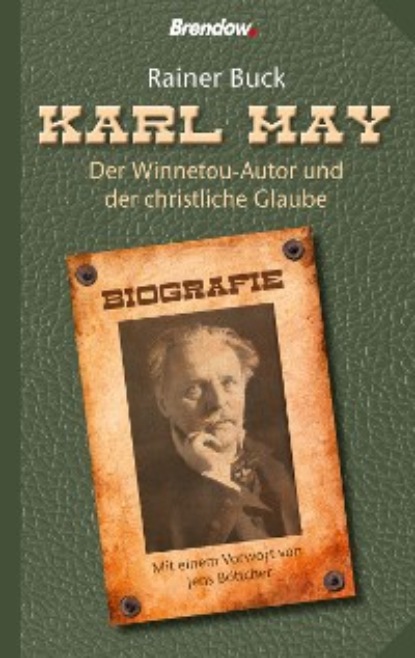- -
- 100%
- +
Aus psychologischer Sicht, nicht zuletzt weil das Blindheitsmotiv auffällig oft in seine Romane einfließt, ist man dennoch geneigt, daran festzuhalten, dass Karl May die ersten Jahre seines Lebens tatsächlich in Dunkelheit verbrachte. Dies wäre zugleich die Erklärung dafür, dass er in besonderer Weise von der mit im Haushalt lebenden Mutter seines Vaters umhegt wurde. May spricht von ihr als der »Märchengroßmutter«, die ihn mit spannenden Märchen und Erzählungen versorgt und damit seine Fantasie angeregt haben soll.
Großmutter erzählte eigentlich nicht, sondern sie schuf; sie zeichnete; sie malte; sie formte … Mochte sie aus der Bibel oder aus ihrer reichen Märchenwelt berichten, stets ergab sich am Schluss der innige Zusammenhang zwischen Himmel und Erde, der Sieg des Guten über das Böse und die Mahnung, dass alles auf Erden nur ein Gleichnis sei, weil der Ursprung aller Wahrheit nicht im niedrigen, sondern nur im höheren Leben liege. Ich bin überzeugt, dass sie das nicht bewusst und in klarer Absicht tat; dazu war sie nicht unterrichtet genug, sondern es war angeborene Gabe, war Genius, und der erreicht bekanntlich das, was er will, am sichersten, wenn man ihn weder kennt noch beobachtet. Großmutter war eine arme, ungebildete Frau, aber trotzdem eine Dichterin von Gottes Gnaden und darum eine Märchenerzählerin, die aus der Fülle dessen, was sie erzählte, Gestalten schuf, die nicht nur im Märchen, sondern auch in Wahrheit lebten.
An dieser Stelle seiner Biografie erwähnt May auch ein angeblich im Familienbesitz befindliches altes Buch mit dem orientalischen Titel »Der Hakawati« (der Märchenerzähler), in dem die Geschichte über den Stern »Sitara« enthalten sein soll. Die Figur des Hakawati und das Sitara-Märchen spielen in Karl Mays Alterswerk eine wichtige Rolle, wie wir noch sehen werden. Im Bemühen, seinen literarischen Weg im Rückblick als eine planmäßige Mission zu deuten, dürfte May dieses geheimnisvolle Märchenbuch der Großmutter erfunden haben, denn ganz offensichtlich mischt er in einer Synthese aus Dichtung und Wahrheit philosophische Ansichten aus seinen späten Schriften unter seine hier geschilderten Kindheitseindrücke. Deren Wiedergabe wirkt somit stellenweise reichlich verklärt, wirft aber ein Licht auf das reiche Seelenleben Mays:
In meiner Erinnerung tritt zuerst … das Märchen ›von der verloren gegangenen und vergessenen Menschenseele‹ auf. … Ich habe mit meinen blinden, lichtlosen Kindesaugen um sie geweint. Für mich enthielt diese Erzählung die volle Wahrheit. Aber erst nach Jahren, als ich das Leben kennengelernt und mich mit dem Innern des Menschen eingehend beschäftigt hatte, erkannte ich, dass die Kenntnis der Menschenseele in Wirklichkeit verloren und vergessen wurde und dass alle unsere Psychologie bisher nicht imstande war, uns diese Kenntnis zurückzubringen. … Ich wollte und wollte sie finden. … Da nahm Großmutter mich auf ihren Schoß, küsste mich auf die Stirn und sagte: ›Sei still, mein Junge! Gräme dich nicht um sie! Ich habe sie gefunden. Sie ist da!‹ ›Wo?‹, fragte ich. ›Hier, bei mir‹, antwortete sie. ›Du bist diese Seele, du! … Man hat dich herabgeworfen in das ärmste, schmutzigste Ardistan. Aber man wird dich finden; denn wenn alle, alle dich vergessen haben, Gott hat dich nicht vergessen.‹ – Ich begriff das damals nicht; ich verstand es erst später, viel, viel später. Eigentlich war in dieser meiner frühen Knabenzeit jedes lebendige Wesen nur Seele, nichts als Seele. … Wenn jemand sprach, hörte ich nicht seinen Körper, sondern seine Seele. Nicht sein Äußeres, sondern sein Inneres trat mir näher. Es gab für mich nur Seelen, nichts als Seelen. Und so ist es geblieben, auch als ich sehen gelernt hatte, von Jugend an bis auf den heutigen Tag. Das ist der Unterschied zwischen mir und anderen. Das ist der Schlüssel zu meinen Büchern.
Die Kindheit endete für May mit dem »sehend werden« im 5. Lebensjahr. Nun wurde er stärker zur damals üblichen Kinderarbeit herangezogen. Der Webstuhl stand in der heimischen Stube. Das Tagwerk waren etwa 14 Stunden. Während der Vater am Webstuhl saß, nähten Frauen und Kinder Leichenhandschuhe, eine Nebenerwerbsquelle. Die Weberei brachte weniger ein als das Existenzminimum. Hunger und Entbehrung kennzeichneten diese Jahre. Das Geburtshaus Karls, eine Erbschaft der Mutter, konnte von der Familie nicht mehr gehalten werden, so dass man schon 1845 eine Mietwohnung am nahegelegenen Ernstthaler Markt bezogen hatte.
Kegelbub und Seminarist
»Keine Jugend« – so überschreibt Karl May die Jahre 1847 bis 1857 in »Mein Leben und Streben«. Der zuweilen jähzornige Vater entdeckt schon bald die Begabungen seines Sohnes. Karl wird früh eingeschult, und zusätzlich zum Schulpensum traktiert der ehrgeizige Vater ihn mit wahllos zusammengesammelten Büchern und paukt ihm lexikalisches Wissen ein. Später wird es noch schlimmer, schließ-lich soll aus dem Jungen ja einmal etwas »Besseres« werden. Sicher hat sich Karl nicht vehement gegen den Bildungseifer gewehrt. Er ist ja wissbegierig und träumt bald selbst davon, später einmal Arzt zu werden. Er bekommt Privatstunden in Latein, Englisch und Französisch. Die finanzielle Lage mochte sich etwas verbessert haben, weil die Mutter seit 1846 als Hebamme arbeitet, aber um den Unterricht finanzieren zu können, muss Karl sich als Kegelbube in einer Gastwirtschaft verdingen. Das ist eigentlich keine Umgebung für einen 12-Jährigen. Die Restauration beherbergt eine Leihbücherei, aus der sich May kostenlos bedienen kann. Er verschlingt am liebsten reißerische Abenteuerromane der trivialsten Art, die er im Rückblick als »Gift« für seine Seele bezeichnet. Arbeit, Lernen und Lektüre isolieren den ohnehin einzelgängerischen Jungen weithin von einem »normalen Leben«. Wenn er sich vor anderen Kindern profiliert, dann durch seine blühende Fantasie und seine Fabulierkunst. Zeitgenossen aus Ernstthal sagen später von Karl, er habe schon als kleiner Junge fantastische Geschichten erzählt und damit sogar Ältere in seinen Bann ziehen können.
Der Ernstthaler Kantor, ein Nachbar der Familie May, entdeckt Karls musikalische Begabung und nimmt ihn in den Knabenchor auf. Außerdem erteilt er ihm kostenlos Geigen-, Klavier- und Orgelunterricht und legt den Grundstein für Mays lebenslange besondere Beziehung zur Musik.
Nach Konfirmation und Volksschulabschluss sucht die Familie May einen Weg, Karl den Weg zu höherer Bildung zu eröffnen. Das Gymnasium bleibt ihm verwehrt, aber durch ein vom Landesfürsten gestiftetes Stipendium reicht es für den Webersohn immerhin für einen Platz im Lehrerseminar Waldenburg. In der Biografie beschreibt May, wie er sich zwar mit den Verhältnissen arrangiert, aber im Hintergrund schon eine andere Berufung spürt:
Also nicht Gymnasiast, sondern nur Seminarist! Nicht akademisches Studium, sondern nur Lehrer werden! Nur? Wie falsch! Es gibt keinen höheren Stand als den Lehrerstand, und ich dachte, fühlte und lebte mich derart in meine nunmehrige Aufgabe hinein, dass mir alles Freude machte, was sich auf sie bezog. Freilich stand diese Aufgabe nur im Vordergrund. Im Hintergrunde, hoch über sie hinausragend, hob sich das über alles andere empor, was mir seit jenem Abende, an dem ich den Faust gesehen hatte, zum Ideal geworden war: Stücke für das Theater schreiben! Über das Thema Gott, Mensch und Teufel!
May erinnert sich hier an die Puppentheateraufführung einer Wanderbühne, die ihn als Knabe nachdrücklich fasziniert hatte. Zunächst aber geht es für ihn mit der Paukerei von trockenem Lernstoff weiter.
Die Zeit als Seminarist beschreibt May in seinen Lebenserinnerungen als wenig förderlich für eine gesunde innere Weiterentwicklung. Er blieb ein Einzelgänger und fand wenig Gefallen daran, wie im Seminar der Lehrstoff vermittelt wurde. Die religiöse Unterweisung empfand er als besonders abschreckend. Dabei hatte ihm nicht zuletzt das gute Zeugnis des Ernstthaler Pfarrers den Weg aufs Seminar geebnet. May sieht eine Diskrepanz zwischen einem »seelenlosen« institutionalisierten Christentum und seinem persönlichen Hunger nach Liebe:
Die Überzeugung, dass es einen Gott gebe, der auch über mich wachen und mich nie verlassen werde, ist, sozusagen, zu jeder Zeit eine feste, unveräußerliche Ingredienz meiner Persönlichkeit gewesen, und ich kann es mir also keineswegs als ein Verdienst anrechnen, dass ich diesem meinem lichten, schönen Kinderglauben niemals untreu geworden bin. Freilich, so ganz ohne alle innere Störung ist es auch bei mir nicht abgegangen; aber diese Störung kam von außen her und wurde nicht in der Weise aufgenommen, dass sie sich hätte festsetzen können. Sie hatte ihre Ursache in der ganz besonderen Art, in welcher die Theologie und der Religionsunterricht am Seminar behandelt wurde. Es gab täglich Morgen- und Abendandachten, an denen jeder Schüler unweigerlich teilnehmen musste. Das war ganz richtig. Wir wurden sonn- und feiertäglich in corpore in die Kirche geführt. Das war ebenso richtig. Es gab außerdem bestimmte Feierlichkeiten für Missions- und ähnliche Zwecke. Auch das war gut und zweckentsprechend. Und es gab für sämtliche Seminarklassen einen wohldurchdachten, sehr reichlich ausfallenden Unterricht in Religions-, Bibel- und Gesangbuchslehre. Das war ganz selbstverständlich. Aber es gab bei alledem eines nicht, nämlich grad das, was in allen religiösen Dingen die Hauptsache ist; nämlich es gab keine Liebe, keine Milde, keine Demut, keine Versöhnlichkeit. Der Unterricht war kalt, streng, hart. Es fehlte ihm jede Spur von Poesie. Anstatt zu beglücken, zu begeistern, stieß er ab. Die Religionsstunden waren diejenigen Stunden, für welche man sich am allerwenigsten zu erwärmen vermochte.
Die Schule allerdings dreht den Spieß herum: Wegen eines geschwänzten Gottesdienstes vermerkt man in einer Beurteilung des Seminaristen May, er sei in religiösen Dingen »kalt und gleichgültig«.
In Mays Seminarzeit fällt seine erste große Liebe zur gleichaltrigen Anna Preßler aus seiner Heimatstadt Ernstthal. In seinen Lebenserinnerungen erwähnt Karl May, dass er in diesen Jahren Lieder und Gedichte geschrieben habe, nicht aber, für wen sie bestimmt waren. Vermutlich findet Anna deshalb keine Erwähnung, weil sie dem Seminaristen nicht treu bleibt, sondern mit 16 Jahren einen Kaufmann heiratet, von dem sie ein Kind erwartet. Zu dieser Zeit schickte May eine erste Indianergeschichte an die bekannte Familienzeitschrift »Die Gartenlaube« und erhielt nach eigenem Bekunden eine ermutigende Absage: Er möge es in einigen Jahren nochmal probieren, soll der Chefredakteur ihm geschrieben haben.
Die Seminarzeit in Waldenburg endet jäh, als Karl kurz vor Weihnachten 1859 des Kerzendiebstahls beschuldigt wird. Nach Mays Version wollte er mit einigen Talgresten seinen Lieben daheim eine kleine Weihnachtsfreude machen. Die Episode zeigt, dass Karl May auf dem Waldenburger Seminar offensichtlich ein Außenseiter und unbeliebter Schüler war, denn er wird Ende Januar 1860 aus dem Seminar geworfen. Die Katastrophe wird aber noch einmal abgewendet, denn nach einer »untertänigsten« Eingabe ans Ministerium und einem diplomatischen Begleitbrief seines Pfarrers kann er ab Juni 1860 seine Ausbildung im Lehrerseminar Plauen fortsetzen und im September des folgenden Jahres mit der Gesamtnote »gut« abschließen.
Конец ознакомительного фрагмента.
Текст предоставлен ООО «ЛитРес».
Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на ЛитРес.
Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.