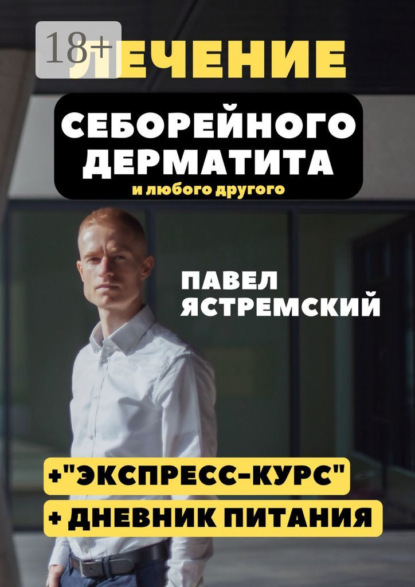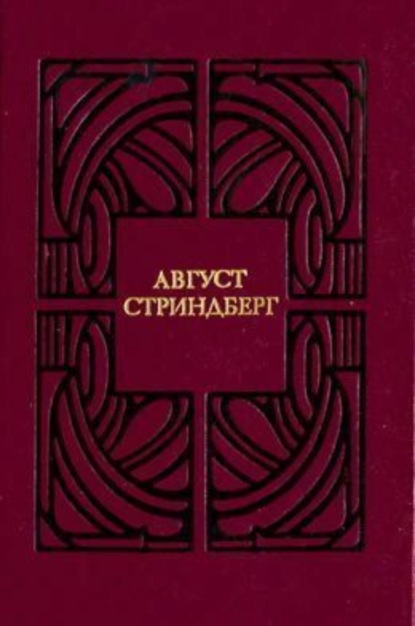- -
- 100%
- +
So wird aus einem hundert Jahre zurückliegenden Ereignis eine Projektionsfläche für aktuelle persönliche Probleme. Das ist auch deshalb möglich, weil in der kommunistischen Zeit das Thema Trianon tabuisiert war. Im Ostblock mussten alle Staaten „sozialistische Bruderländer“ sein, da durfte Nationalismus keine Rolle spielen. Offiziell. Der Schmerz, den viele Ungarn spürten, auch weil ihnen die Behandlung der ungarischen Minderheit in anderen Staaten nicht gefiel, wurde verdrängt. Und kann heute umso massiver missbraucht werden.
Viktor Orbán spielt lustvoll mit dem Mythos Trianon und wird dabei auch kreativ. Am 4. Juni 2020 wurde in Budapest ein 100 Meter langes und vier Meter breites Denkmal fertig. Eine Art Rampe um rund 16 Millionen Euro soll ein „Denkmal der nationalen Einheit“ werden und die Menschen daran erinnern, wie groß Ungarn einmal war. Das Jahr 1913 wurde als Referenzpunkt gewählt, mehr als 12.500 Ortsnamen des Königreichs Ungarn wurden in die Rampe, die unter die Erde verläuft, eingemeißelt. Also auch viele Orte, die heute nicht mehr in Ungarn liegen und solche, die nie mehrheitlich von Ungarn besiedelt waren. Orbán spielt gerne das Opfer, da wird die EU-Zentrale auch zu „Brüssel, dem neuen Moskau“.
Die Europäische Gemeinschaft wurde gegründet, um den bis dahin üblichen Geschichtsrevisionismus durch den Abbau von Grenzen für immer zu beenden. Wenn es seit den Verträgen von Maastricht eine Europäische Staatsbürgerschaft gibt, dann muss ein Nationalstaat nicht mehr danach trachten, ehemalige Staatsbürger mit einem nationalen Dokument einzugemeinden. Genau das aber macht Orbán mit Angeboten für ungarische Pässe an Ungarn in Rumänien, der Slowakei und den Balkanländern. Genauso handelte die FPÖ, als sie mit der Idee spielte, Südtirolern die österreichische Staatsbürgerschaft anzubieten und diese Forderung sogar im türkis-blauen Regierungsprogramm von 2017 unterbrachte. Das sind rückwärtsgewandte Ideen, die bewusst Gräben aufreißen und den Nationalismus virulent machen sollen.
Osteuropa:
Rückfall in autoritäre Zeiten
In den Staaten des früheren Ostblocks schien es nach dem Fall der Mauer und der Beseitigung des Eisernen Vorhangs wirklich so, als würden dort Demokratie, Rechtsstaat und Menschenrechte verankert werden sowie das Prinzip des Wohlfahrtsstaats, der sich nach dem Zweiten Weltkrieg überall in Westeuropa entwickelt hatte. Immerhin hatten sich einige Völker ihre Freiheit gegen die lokalen kommunistischen Diktatoren, die mit den sowjetischen Panzern im Hintergrund herrschten, erkämpft, in einem zum Teil jahrzehntelangen Prozess.
Die Ungarn hatten sich schon 1956 gegen die sowjetischen Besatzer gewehrt, Tschechen und Slowaken 1968. Vergeblich. Im Jahr 1980 wurde der 37-jährige Elektriker Lech Wałęsa in Danzig Chef der neuen Gewerkschaftsbewegung Solidarność. Dort agierten endlich keine angeblichen Arbeiterführer mehr, die nur dem Staat und ihrer Ideologie dienen wollten, sondern echte Gewerkschafter, die für ihre Kolleginnen und Kollegen eintraten, auch mit Streiks. Das hatte Wałęsa schon zehn Jahre davor versucht und war deshalb verhaftet worden. Nun wurde er zum weltweiten Helden, den auch Kriegsrecht und Hausarrest nicht mundtot machen konnten. Neun Jahre später, im Sommer 1989, machte Wałęsa – in noch nicht wirklich freien Wahlen – den Christdemokraten Tadeusz Mazowiecki zum ersten nichtkommunistischen Ministerpräsidenten seit dem Zweiten Weltkrieg.
Auch andere Völker, die seit dem Krieg von sowjetischen Panzern beherrscht waren, lehnten sich auf. Am 7. Oktober 1989 beobachte ich in Ost-Berlin die offiziellen Feiern zum 40. Jahrestag der Gründung der DDR, der Deutschen Demokratischen Republik. Unweit des Alexanderplatzes war eine riesige Tribüne aufgebaut, von wo aus der damals 77-jährige Staatschef Erich Honecker gemeinsam mit den anderen überwiegend greisen Mitgliedern des Politbüros und dem vergleichsweise jugendlichen sowjetischen Parteichef Michail Gorbatschow die Militärparade beobachtete. Auf der ehemaligen Stalinallee, die seit Herbst 1961 Karl-Marx-Allee hieß, demonstrierten Panzer sowjetischer Bauart die Macht des Militärs im „Arbeiter- und Bauernstaat“, tausende Soldaten marschierten im Stechschritt nach dem Vorbild preußischer Exerzierregimenter an den kommunistischen Führern vorbei. Ich stand ganz vorne, nahe dem Alexanderplatz, von wo auch viele Ost-Berliner die Szene mitverfolgten. Da trat ein DDR-Bürger einen Schritt nach vorne, an einen abgesperrten Bereich heran. Ein Volkspolizist wies ihn rüde an, wieder auf den Gehsteig zurückzugehen. Der Mann sah den Uniformierten an und fragte: „Warum?“ Das war eine Revolution im Kleinen, der Polizist schaute verwundert und drehte sich um. Als ob er geahnt hätte, dass das Geschehen nur mehr der letzte Akt einer schlechten Show war, die verzweifelte Farce einer Führung, die nur mehr wenige Wochen existieren würde.
In diesem Herbst des Jahres 1989 veränderte sich ganz Europa. Östlich des Eisernen Vorhangs ganz radikal, im Westen zunächst unbemerkt. Mauer und Stacheldraht hatten auch dazu geführt, dass viele Menschen im Westen nur wenig über das Leben jenseits der Todesstreifen wussten. Am Balkan machten sich die ersten Vorboten nationaler Konflikte bemerkbar, die in blutige Kriege münden sollten. Und es ging alles sehr schnell: in Polen, Rumänien, Bulgarien, Ungarn, der ČSSR – die Tschechoslowakische Sozialistische Republik der Tschechen und Slowaken –, Estland, Lettland, Litauen.
Bereits am 10. November 1989, einen Tag nach Öffnung der Berliner Mauer, musste Todor Schiwkow als Generalsekretär der kommunistischen Partei Bulgariens zurücktreten. Er war seit 1954 im Amt gewesen. In Rumänien wollte Nicolae Ceaușescu beweisen, dass er sich zurecht Titel wie „das Genie der Karpaten“ oder „Sohn der Sonne“ verliehen hatte und glaubte, mit Hilfe des Geheimdienstes Securitate den Sturm der Demokratisierung des Ostens zu überleben. Nach kurzem Prozess wurden der Diktator und seine Frau Elena, laut Propaganda eine „Gelehrte von Weltruhm“, am 25. Dezember 1989 standrechtlich erschossen. Fotos und Videos sollten den Tod der beiden beweisen. In Ungarn fanden am 25. März 1990 die ersten freien Wahlen statt, Regierungschef wurde der Christdemokrat Joszef Antall. In Estland erklärte der Oberste Rat der Estnischen Sowjetischen Sozialistischen Republik unter dem Vorsitzenden Arnold Rüütel ausgerechnet am 8. Mai 1990, 45 Jahre nach Ende des Zweiten Weltkriegs, seine erneute Souveränität von der Sowjetunion. Ab sofort nannte sich das Land Republik Estland, eine Bezeichnung, die 1991 zusammen mit den ebenfalls wieder unabhängigen Ländern Litauen und Lettland durchgesetzt wurde.
In Mittel- und Osteuropa waren die nationalen Zusammensetzungen und Grenzen weitgehend unbestritten, nur Tschechen und Slowaken gründeten am 1. Jänner 1993 ihre eigenen Staaten, nachdem sie sich zuvor mit einer Föderation geplagt hatten.
Die glücklichste Generation – in Westeuropa
Ich verfolgte diese Entwicklungen beruflich als Journalist – bis Jänner 1991 als Korrespondent in Deutschland und anschließend als Chef der politischen Magazine und Dokumentationen im ORF in Wien –, aber im Herzen vor allem auch als glückliches Nachkriegskind.
Meine Generation ist aufgewachsen mit dem Erlebnis des ständig zunehmenden, unbeschränkt scheinenden Wachstums. Alles wurde mehr, zunächst einmal der Wohlstand. Auch in Mittelklassenfamilien waren in meiner Kindheit Süßigkeiten noch eine Besonderheit, etwa, wenn jemand zu Besuch kam. Oder Fleisch, das es meistens nur am Sonntag gab. Eine Woche Ferien am Faaker See waren ein Ereignis, zwei Wochen in Lignano Luxus. Aber im Rückblick waren nicht die materiellen Erfahrungen so wichtig, sondern der spürbare Zuwachs an persönlicher Freiheit. Wir waren die erste Generation, die an den Universitäten mitbestimmen durfte, nach dem Universitätsorganisationsgesetz der SPÖ-Alleinregierung im Jahr 1975, damals zum großen Ärger der Professoren. Dabei war es der junge ÖVP-Unterrichtsminister Alois Mock gewesen, der schon im Jahr 1969 die Mitbestimmung in den Studienkommissionen eingeführt hatte. Ausgerechnet die schwarz-blaue Regierung Schüssel hat im Jahr 2000 die Mitbestimmung zurückgenommen. Dazu kam, dass meine Generation leichter im Ausland studieren konnte. Und schließlich waren wir dabei, als sich die Freiheit in ganz Europa ausbreitete. Was für ein Erlebnis für uns, was für eine Chance für Europa und seine Bürgerinnen und Bürger!
Die neue Freiheit führte zur Öffnung der Grenzen, und die EU war und soll Garant dafür sein, dass die Europäer nicht mehr gegeneinander Krieg führen werden. Diese Hoffnung bewegt mich bis heute. Was für ein Glück haben wir gehabt, dass wir nach dem schrecklichsten aller europäischen Kriege geboren wurden. Doch das bringt eine riesige Verantwortung mit sich, die niemals selbstverständliche Errungenschaft der Freiheit und des Friedens für die nächsten Generationen zu erhalten.
Jedes Volk muss mit seiner Geschichte leben, deshalb ist es so wichtig, dass wir sie kennen. Die Lehren der Geschichte strahlen stets länger in die Politik und das Zusammenleben in der Gegenwart aus, als den Nachgeborenen lieb sein kann. Denn es ist nicht immer einfach, die Traumata und Verwundungen, die aus der Vergangenheit herüberstrahlen, zu verstehen. Wir Österreicher wissen um die manchmal noch spürbaren Auswirkungen unseres Bürgerkriegs des Jahres 1934. Die oft zum Hass gesteigerte Abneigung zwischen „Schwarzen“ und „Roten“ macht sich zum Teil bis heute bemerkbar. Dazu kommt, dass viele unserer Vorfahren wenig heldenhaft und sicher auch verblendet ihre Grenzen, Plätze und Herzen öffneten, als Adolf Hitler am 12. März 1938 einmarschierte und sich die Opportunisten aller Lager mit den braunen Horden verbrüderten. Aus dem bereits latenten widerlichen Antisemitismus des Alltags in Österreich wurde der mörderische in der Ostmark. Carl Zuckmayer schildert in seiner Autobiografie, dass er sowohl die ersten Tage der Nazi-Herrschaft in Berlin Ende Jänner 1933 als auch den Einmarsch Hitlers in Wien erlebte und wie er den Unterschied zu Berlin sah: „Nichts davon war mit diesen Tagen in Wien zu vergleichen. […] Was hier in Wien entfesselt wurde, war der Aufstand des Neids, der Missgunst, der Verbitterung, der blinden, böswilligen Rachsucht – und alle anderen Stimmen waren zum Schweigen verurteilt.“ Die 1930er Jahre hatten Not und Armut gebracht, auch in Österreich, aber es waren nicht nur die Hungernden und Arbeitslosen, die ihre jüdischen Nachbarn plötzlich quälten, verhöhnten und schließlich ermordeten. Es waren auch Juristen und Ärzte dabei, die zunächst auf den Straßen Wiens Juden erniedrigten und dann in den Konzentrationslagern über Leben und Tod entschieden.
Österreich hat nach Krieg und Shoah länger gebraucht als Deutschland, um sich zu den Verbrechen der Hitlerzeit zu bekennen. Dort wiederum zeigte die AfD in den letzten Jahren ganz offen, dass sie die bisherige Einigkeit der deutschen Politik, den Holocaust als einmaliges Verbrechen in der Geschichte der Menschheit zu sehen und zu verurteilen, nicht mittrug. Nein, die Nazi-Zeit war kein „Vogelschiss der Geschichte“, wie AfD-Chef Gauland bewusst verharmlosend meinte.
Wir haben unsere Freiheit – sowohl in Deutschland als auch in Österreich – von den Alliierten geschenkt bekommen. Oder, um es ganz menschlich zu sagen: von den Soldaten, die für unsere Befreiung gekämpft haben. An dieser Stelle muss ich an den wunderschönen Strand in Rayol – Canadel-sur-Mer unweit von St. Tropez denken. Dort kann man einen herrlichen Urlaub verbringen. Aber wer mit offenen Augen über die kleine Landstraße oberhalb des Strandes geht, sieht dort eine Gedächtnisstelle für die Gefallenen des Afrika Kommandos, das am 15. August 1944, nach der Landung der Alliierten in der Normandie im Juni, den Süden Frankreichs befreite. Dort wird mit weißen Kreuzen einiger christlicher französischer Soldaten gedacht, die bei der Landung am Strand gefallen sind, aber maurische Figuren erzählen auch von muslimischen Uniformierten in den Reihen der Befreier.
Rückfall in den Nationalismus
Aber zurück zur Befreiung der Jahre 1989/1990, zu dieser friedlichen Revolution: Unsere östlichen Nachbarn mussten nach der Teilung Europas allzu lange auf der stalinistischen, und nach Stalins Tod auf der sowjetischen Seite der Geschichte leben. Und sie haben sich auf unterschiedliche Weise vom Joch der Unterdrückung, von Einparteiendiktatur, Misswirtschaft und Funktionärsmissbrauch befreit. Das war und ist eine historische Leistung, für die wir sie bewundern müssen. Aber warum erleben wir dort seit einigen Jahren den Rückfall in den Nationalismus? Das Phänomen ist überall zu beobachten, und es gibt dazu inzwischen unterschiedliche Erklärungsversuche, die darauf gründen, dass wir mitten in einer technologischen und gesellschaftspolitischen Entwicklung stehen, die weit über Europa hinausgeht. Das ist schon ein Teil der Erklärung: Diese vielfältigen Veränderungen machen Angst. Da liegt der Rückzug in das Vertraute, und das ist auf verführerische und trügerische Weise auch die Nation, durchaus nahe.
Heute, 30 Jahre nach der deutschen Wiedervereinigung und nachdem die Konferenz für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa (KSZE) den ewigen Frieden ausgerufen hat, leben wir plötzlich wieder mitten in einem nationalistischen Gepolter, das sich durch ganz Europa bis in kleine Regionen zieht. Der Ton wird lauter und aggressiver. Institutionen, die für das Gemeinsame stehen, wie die Europäische Union, werden von den Rechten diffamiert. Selbst gemäßigte Politiker gehen auf Distanz zur EU, um bei nationalen Wahlen zu punkten. Wird aus Nationalismus wieder Chauvinismus, die Verachtung der anderen? Da werden wir sehr genau hinschauen und hinhören müssen.
Die Rolle des Staates
Aber nicht nur die komplizierte und kriegerische Geschichte macht das Zusammenleben in Europa schwer, auch der Blick der Bürger auf den Staat und andere Autoritäten unterschiedet sich massiv zwischen Palermo und dem Polarkreis, zwischen Lissabon und Limassol. Viele Italiener sehen den Staat als Einrichtung, gegen die man sich zur Wehr setzen muss, zumindest, indem man ihm die Steuern vorenthält. Deutsche wollen korrekt sein, Österreicher neigen mit der Habsburger-DNA im Blut zu einer beachtlichen Hörigkeit gegenüber Obrigkeiten. In Ländern des ehemaligen Ostblocks reagieren Menschen auf Anweisungen aus Brüssel skeptisch, weil sie früher von einer anderen, fernen Zentrale gesteuert wurden. Franzosen wehren sich gegen Präsidenten, denen sie aber eine fast imperiale Ausstattung zugestehen, und in Großbritannien ist persönliche Freiheit traditionell ein wichtigerer Wert als in den anderen europäischen Staaten. Das klingt klischeehaft, ließ sich aber auch in der Corona-Krise verfolgen, wobei Boris Johnson mit seiner freizügigen Strategie gegen das Virus erfolglos blieb.
Überall haben Politikerinnen und Politiker ein Gespür, die nationalen Emotionen anzusprechen. Und wenn es einen Außenfeind gibt, dann sind plötzlich auch Grenzen willkommen. Nationale Grenzen helfen allerdings nicht gegen ein Virus, regionale Blockaden schon eher.
Der britische Historiker Ian Kershaw nennt in seinem 2018 erschienenen Buch Achterbahn – Europa 1950 bis heute die Europäische Union eine „Kompromissfabrik“. Ihre Schwungräder und Kurbelwellen bewegen sich langsam. Kershaw: „Das System ist nicht für Tempo und Dynamik gemacht, sondern dafür, zu verhindern, dass eine Macht die Vorherrschaft erreicht.“ Andere verglichen die EU mit der Springprozession im luxemburgischen Echternach: zwei Schritte vor, einer zurück. Viele Krisen wurden aber so bewältigt, und dass kein Land in Europa die anderen dominiert, ist das Erfolgsgeheimnis. Im Vertrag von Maastricht haben sich die damals zwölf Mitgliedsländer verpflichtet, die Gemeinschaft zu einer politischen Union auszubauen. Alle Staaten, die seither beigetreten sind, haben diese Verpflichtung übernommen. Die Europäische Union hat also alle Grundlagen, um gemeinsam durch diese Krise zu kommen, wenn die Nationalstaaten nur wollen. Und wenn diese so entschlossen sind, wie sie es im Vertrag von Maastricht vereinbart haben.
KAPITEL 4
ENTSCHLOSSEN
MAASTRICHT BRACHTE DIE UNVOLLENDETE UNION
Entschlossen – dieses ausdrucksstarke Wort steht gleich fünfmal in der Präambel des Vertrages von Maastricht. Er wurde am 7. Februar 1992 in der niederländischen Stadt unterschrieben und sollte die zwölf Staaten der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft (EWG) in eine Union für gemeinsames Handeln nach innen und außen weiterentwickeln, was in wichtigen Bereichen auch gelang. Aber von dieser geforderten Entschlossenheit war vor allem zu Beginn der Corona-Pandemie so gar nichts zu spüren.
Nun kann es für eine weltweite Seuche keinen günstigen Zeitpunkt geben, aber im Frühjahr 2020 erwischte das Corona-Virus ganz Europa zu einem besonders heiklen Zeitpunkt. Es war genau 30 Jahre her, dass nach dem Zerfall des Sowjetblocks und der darauffolgenden Unabhängigkeit der 15 Sowjetrepubliken überall in Osteuropa demokratische Regime entstanden. Erst vor 30 Jahren wurde in Europa der Zweite Weltkrieg durch den Zwei-plus-Vier-Vertrag offiziell beendet, Vertreter der beiden deutschen Staaten und der vier Alliierten unterzeichneten am 12. September 1990 in Moskau diesen Vertrag. Erst jetzt war Deutschland ein souveräner Staat, die vier Siegermächte hatten ihre Rechte aufgegeben. Endlich durften die Menschen in den beiden bis zum Mauerfall verfeindeten deutschen Staaten ihre Wiedervereinigung feiern. Aber 30 Jahre nach diesen weltpolitisch überraschenden und so erfreulichen Ereignissen befindet sich die Europäische Union bereits seit Jahren in einer tiefen Krise. Diese zeigt sich unter anderem darin, dass Medienfreiheit und Rechtsstaatlichkeit in ehemals kommunistischen Ländern eingeschränkt wurden. Journalisten und Richter geraten in einigen Staaten unter Druck, statt der Betonung der Menschenrechte hören wir in einigen Staaten wieder völkische Parolen rechtsextremistischer Gruppen, in Ungarn sogar von der Regierung. Bei der Art, wie nach dem Austritt der Briten aus der Union über das Budget der nächsten sieben Jahre gestritten wurde, war der Geist von Maastricht auch nicht zu spüren. Der Brexit wurde zwar am 31. Jänner 2020 vollzogen, aber das künftige Verhältnis zwischen der EU und Großbritannien ist nach wie vor nicht geklärt. Immerhin: Vielen Briten wurde während der Corona-Krise klar, dass ein funktionierender Handel mit dem Kontinent gerade in schwierigen Zeiten überlebenswichtig ist.
Der heftig ausgetragene Streit zwischen Nord und Süd, zwischen Ost und West, zwischen den „frugalen Vier“, also Dänemark, Holland, Österreich, Schweden auf der einen und dem Rest der EU auf der anderen Seite, war und ist ein Symbol für das Auseinanderdriften einer Staatengemeinschaft, die erst 2013 durch die Aufnahme Kroatiens auf 28 Mitglieder angewachsen und durch den Brexit wieder auf 27 geschrumpft ist. Über Geld wurde in der Union immer gestritten, wobei die Lösung in Zeiten von Helmut Kohl und Maggie Thatcher einfacher war. Die Britin rief „I want my money back!“ und der Deutsche hatte immer das Scheckbuch dabei, durchaus zum Vorteil der starken, exportorientierten Industrie der Bundesrepublik.
Die Werte der Union klingen wunderbar
Die Konflikte, die vor der Corona-Krise virulent geworden waren, lassen sich aber nicht mit Geld allein beseitigen, denn es geht plötzlich um das Wertefundament Europas. Werte? Sind sich alle Regierungen einig darüber, auf welchen Fundamenten Europa nach den Weltkriegen des 20. Jahrhunderts errichtet wurde? Theoretisch vielleicht, aber die national befeuerten Emotionen, aus denen wieder ein völkischer Furor werden könnte, spielen eine immer größere Rolle. Dabei haben alle Länder, die später in mehreren Wellen der Europäischen Union beigetreten sind, den Vertrag von Maastricht unterzeichnet. Mit diesem haben im Februar 1992 die zwölf damaligen Mitglieder Belgien, Dänemark, Deutschland, Griechenland, Spanien, Frankreich, Irland, Italien, Luxemburg, die Niederlande, Portugal und Großbritannien die Europäische Wirtschaftsgemeinschaft (EWG) zur Europäischen Union weiterentwickelt. Und zwar mit vielen Werten, Grundsätzen und sich daraus ergebenden Verpflichtungen. Die Länder erklärten in Maastricht, eine Europäische Union zu gründen, und zwar
ENTSCHLOSSEN, den mit der Gründung der Europäischen Gemeinschaften eingeleiteten Prozess der europäischen Integration auf eine neue Stufe zu heben,
EINGEDENK der historischen Bedeutung der Überwindung der Teilung des europäischen Kontinents und der Notwendigkeit, feste Grundlagen für die Gestalt des zukünftigen Europas zu schaffen,
IN BESTÄTIGUNG ihres Bekenntnisses zu den Grundsätzen der Freiheit, der Demokratie und der Achtung der Menschenrechte und Grundfreiheiten und der Rechtsstaatlichkeit,
IN DEM WUNSCH, die Solidarität zwischen ihren Völkern unter Achtung ihrer Geschichte, ihrer Kultur und ihrer Traditionen zu stärken,
IN DEM WUNSCH, Demokratie und Effizienz in der Arbeit der Organe weiter zu stärken, damit diese in die Lage versetzt werden, die ihnen übertragenen Aufgaben in einem einheitlichen institutionellen Rahmen besser wahrzunehmen,
ENTSCHLOSSEN, die Stärkung und die Konvergenz ihrer Volkswirtschaften herbeizuführen und eine Wirtschafts- und Währungsunion zu errichten, die im Einklang mit diesem Vertrag eine einheitliche, stabile Währung einschließt,
IN DEM FESTEN WILLEN, im Rahmen der Verwirklichung des Binnenmarkts sowie der Stärkung des Zusammenhalts und des Umweltschutzes den wirtschaftlichen und sozialen Fortschritt ihrer Völker zu fördern und Politiken zu verfolgen, die gewährleisten, dass Fortschritte bei der wirtschaftlichen Integration mit parallelen Fortschritten auf anderen Gebieten einhergehen,
ENTSCHLOSSEN, eine gemeinsame Unionsbürgerschaft für die Staatsangehörigen ihrer Länder einzuführen,
ENTSCHLOSSEN, eine gemeinsame Außen- und Sicherheitspolitik zu verfolgen, wozu auf längere Sicht auch die Festlegung einer gemeinsamen Verteidigungspolitik gehört, die zu gegebener Zeit zu einer gemeinsamen Verteidigung führen könnte, und so die Identität und Unabhängigkeit Europas zu stärken, um Frieden, Sicherheit und Fortschritt in Europa und in der Welt zu fördern,
IN BEKRÄFTIGUNG ihres Ziels, die Freizügigkeit unter gleichzeitiger Gewährleistung der Sicherheit ihrer Bürger durch die Einfügung von Bestimmungen über Justiz und Inneres in diesen Vertrag zu fördern,
ENTSCHLOSSEN, den Prozess der Schaffung einer immer engeren Union der Völker Europas, in der die Entscheidungen entsprechend dem Subsidiaritätsprinzip möglichst bürgernah getroffen werden, weiterzuführen,
IM HINBLICK auf weitere Schritte, die getan werden müssen, um die europäische Integration voranzutreiben.
Man muss diese Präambel mehrfach und genau lesen, da sie sehr differenziert formuliert ist. Entschlossen waren die Unterzeichner bei der Gründung einer Wirtschafts- und Währungsunion mit einer „stabilen Währung“, bei der „Unionsbürgerschaft“, dem „Subsidiaritätsprinzip“ und einer „gemeinsamen Außen- und Sicherheitspolitik“. Eine „gemeinsame Verteidigung“ wurde schon unter Vorbehalt genommen, dazu „könnte“ es kommen. Wobei der Nutzen einer gemeinsamen Verteidigung klar beschrieben wird: „Die Identität und Unabhängigkeit Europas zu stärken, um Frieden, Sicherheit und Fortschritt in Europa und in der Welt zu fördern.“ Das sollten wir tun, aber davon sind wir weit entfernt. So sind wesentliche Fortschritte, die für die EU überlebenswichtig sind, nur mit der Formulierung „in dem Wunsch“ eingeleitet: „Solidarität zwischen den Völkern unter Achtung der Kultur und der Geschichte“ sowie der „Ausbau der Demokratie“.
Immerhin, im Vertrag von Maastricht geht es nicht mehr nur um einen gemeinsamen Markt, um den Abbau von Zöllen oder Bewegungsfreiheit. Nein, hier werden die Grundlagen des Zusammenlebens für alle Bürgerinnen und Bürger genannt, wenn schon nicht in einem Staat, so doch in einer „Union der Völker Europas“: Freiheit, Demokratie, Menschenrechte, Rechtsstaatlichkeit, Solidarität und die Angleichung der Volkswirtschaften sind mehr als nur ein Ziel, diese Werte sind das Motto für ein grenzenloses Leben und Arbeiten. Außerdem wird die Achtung der unterschiedlichen Geschichte der Völker und die Stärkung der Kultur und der Traditionen proklamiert. Und schließlich ist der Vertrag von Maastricht auch die Grundlage für die Einführung einer gemeinsamen Währung, die auf der gemeinsamen Verpflichtung von Höchstgrenzen für die Defizite und die Verschuldung der Staaten beruhen soll.