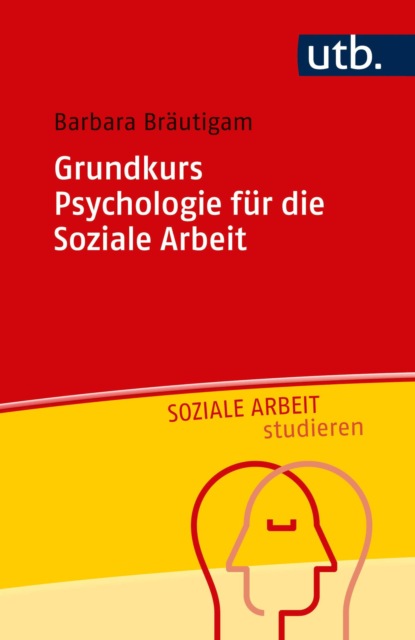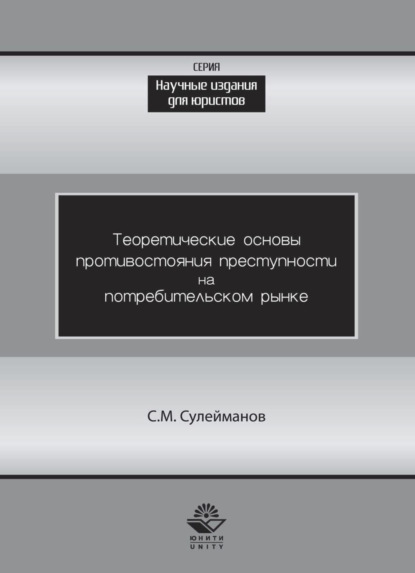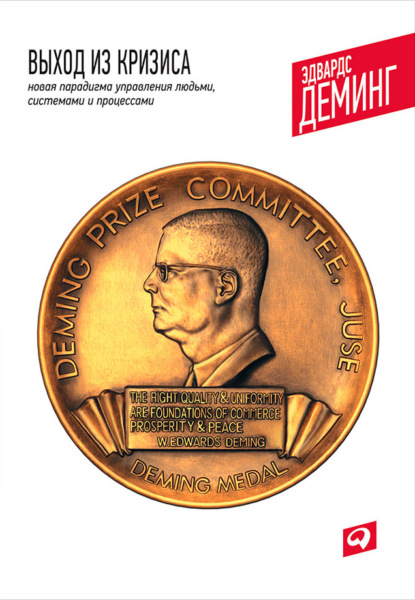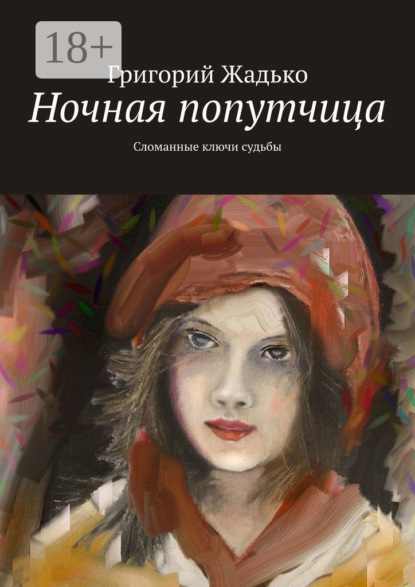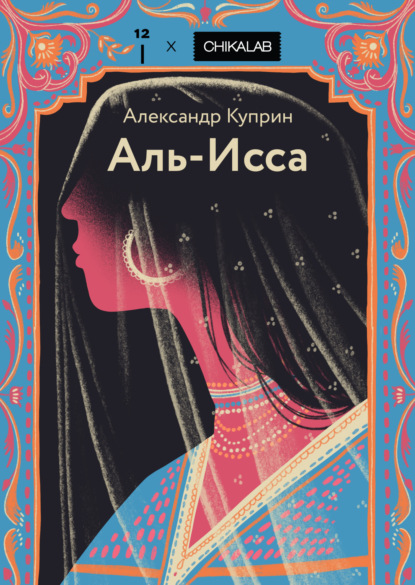- -
- 100%
- +
Der zweite Grund, warum entwicklungspsychologische Kenntnisse für Fachkräfte der Sozialen Arbeit wichtig sind, besteht in der Fähigkeit zur Differenzierung zwischen entwicklungsangemessenen bzw. erwartbaren Verhaltensweisen und überfordernden bzw. unterfordernden Ansprüchen an die jeweiligen Menschen. Die Erwartung von Eltern, dass ihr drei Monate altes Kind durchschläft, ist zwar ausgesprochen verständlich, aber aus entwicklungspsychologischer Perspektive nicht angemessen. Gleichzeitig kann einem 12-jährigen Kind in der Regel zugemutet werden, allein zur Schule zu gehen und nicht von seinen Eltern ständig begleitet zu werden. Entwicklungspsychologie bietet somit eine normative Orientierungsfolie, auch wenn diese, wie in Lisas Fall, durchaus kritisch zu hinterfragen ist. Auf Grund von Lisas biologischer Vorgeschichte ist z.B. nicht zu erwarten, dass sie mit vier Jahren bereits in allen „Funktionsbereichen“ altersentsprechend entwickelt ist.
2.2 Der Entwicklungsbegriff und Entwicklungsmodelle
„Es kann schon nicht alles so bleiben
Hier unter dem wechselnden Mond
Es blüht eine Zeit und verwelket
Was mit uns die Erde bewohnt […]“ (August von Kotzebue, 1802).
Vereinfacht könnte man sagen, dass Entwicklung Veränderung über die Zeit bedeutet. Die meisten EntwicklungspsychologInnen gehen allerdings davon aus, dass es sich dabei um Veränderungen handelt, die lebensalterbezogen, langfristig und geordnet verlaufen (Ulich 2005). Nach dieser Auffassung wäre also eine kurzfristige Veränderung des Gemütszustandes, wie z.B. eine depressive Episode, keine Entwicklung. Hingegen ist eine fortschreitende Erkrankung im höheren Lebensalter, wie z.B. Demenz, durchaus als Entwicklung zu verstehen.
Ein erweiterter Entwicklungsbegriff beinhaltet alle längerfristig wirksamen Veränderungen von Kompetenzen, also alle bleibenden sowie kurzzeitigen Veränderungen, die weitere Veränderungen nach sich ziehen (Flammer/Alsaker 2002).
Es gibt sehr unterschiedliche Vorstellungen und Ideen davon, wie Entwicklung von statten geht. Dies wird beispielhaft deutlich an unterschiedlichen Vorstellungen von Kindheit und des angemessenen Umgangs mit Kindern (Ariès 1975; deMause 1989; Dornes 2012). Philipp Ariès zeichnet in seinem berühmten Buch „Geschichte der Kindheit“ (1975) den Wandel des Kindheitsbegriffs nach und macht die Relativität und die historische Eingebundenheit des Begriffs der Kindheit, so wie wir ihn heute verstehen, deutlich. Nach dem Historiker Lloyd deMause (1989) ist das Verständnis von Kindheit und den Bedürfnissen von Kindern bis ins 20. Jahrhundert zum einen als eine Art Abnahme eines Alptraums zu verstehen. Dieser reichte von systematischen Kindermorden in der Antike (Herodes) über die in manchen Ländern bis heute bestehende gnadenlose Ausbeutung von Kindern als Arbeitskraft bis hin zur gesetzlichen Ächtung von Gewalt in der Erziehung in Deutschland im Jahre 2000 der Erziehung. Zum anderen weist Martin Dornes (2012) darauf hin, dass Kinder zwar zum einen kontinuierlich mehr Rechte erhielten, aber dafür umso mehr an Freiheiten einbüßten.
Im 17. und 18. Jahrhundert herrschte die Vorstellung vor, dass das Kind ein kleiner Erwachsener sei und keiner spezifischen Lebensräume bedürfe. Eine andere Idee, die vor allem in der christlichen Religion wurzelte, implizierte, dass Kinder eher einen schlechten Kern haben und vor allem bestraft werden müssen – hier spricht man von dem sogenannten „Erbsündemodell“. Jean Jacques Rosseau, einer der wichtigsten Philosophen und Pädagogen der Aufklärung (1712–1778), vertrat hingegen die Auffassung, dass der Mensch und somit auch das Kind von Natur aus gut sei, und im Wesentlichen vor äußeren und somit auch vor erzieherischen Einflüssen geschützt werden müsse. Heute herrscht in der westlichen Welt in der Regel das Bild vom Kind als einer aktiv handelnden Persönlichkeit, das in seiner Kompetenzentwicklung umfassend gefördert und begleitet werden sollte (Hédervári-Heller 2011).
Eine Kernfrage aller Entwicklungsmodelle beschäftigte sich damit, ob die Entwicklung von inneren oder äußeren Kräften gelenkt wird. Auch in der Sozialen Arbeit ist diese Frage immer dann von Bedeutsamkeit, wenn es um die Möglichkeiten von äußerer Einflussnahme bzw. Hilfe und Unterstützung von verschiedenen Zielgruppen geht. Historisch bedeutsam sind dabei zwei entgegengesetzte Modelle: das endogenistische und das exogenistische Entwicklungsmodell. Beide Modelle wurden Ende des 19. und Anfang des 20. Jahrhunderts vertreten und prägten die damaligen Vorstellungen von Entwicklungspsychologie.
Das endogenistische Entwicklungsmodell stellte Entwicklung phasenhaft in mehreren irreversiblen Schritten ablaufend dar, an deren Ende ein abgeschlossener Reifezustand vorlag. Die einzelnen Phasen wurden im Kindesalter bildhaft benannt – der Greifling, der Läufling, das Schimpansenalter, das Alter der Namensfragen/ Warumfragen, das Märchenalter, die Schulreife. Teile dieser mittlerweile in seiner Absolutheit überholten Vorstellung finden sich nach wie vor in verschiedenen pädagogischen Konzepten, so z.B. in der Waldorfpädagogik oder auch übergreifend in der Feststellung der Schulreife.
Das exogenistische, auch als Tabula-Rasa-Modell bezeichnete Modell, findet seine Wurzeln vor allem im Behaviourismus (s. Kapitel 3.6.2 und 6.5). Es geht davon aus, dass Kinder ohne jegliche Anlagen auf die Welt kommen und durch Erziehung in jede beliebige Richtung geformt werden können. Nach dieser Vorstellung gibt es keine festgelegten Abläufe, sondern Entwicklung wird als Lernfortschritt betrachtet – Dinge können beliebig gelernt oder auch wieder verlernt werden. Auch dieses Modell ist mittlerweile in seinem Absolutheitsanspruch überholt (Wicki 2015). Teile davon finden sich aber noch immer in eher verhaltensorientierten Konzepten von Heimeinrichtungen oder Jugendwohngruppen, die vor allem mit Lob und Strafe in sogenannten Verstärkerprogrammen (s. Kapitel 3.6.3) arbeiten.
Insgesamt werden beide Entwicklungsmodelle – das endogenistische und das exogenistische – mittlerweile als zu universalistisch beurteilt, weil sie z.B. zu wenig kulturelle und individuelle Unterschiede berücksichtigen. Zudem konzentrierten sich beide Entwicklungsmodelle sehr auf die Kindheit und Jugend und beinhalten tendenziell starre und normative Vorstellungen von Entwicklungsverläufen (Montada et al. 2012).
Die moderne Entwicklungspsychologie betrachtet Entwicklung über die gesamte Lebensspanne und bezieht differentielle Entwicklungen ein. Zudem wird Entwicklung in viel stärkerem Maße kontextabhängig und als von den sozialen Versorgungssystemen abhängig verstanden. So weiß man beispielsweise, dass Armut ein wesentliches Entwicklungsrisiko darstellt (Weiß 2010).
„Die Entwicklungspsychologie der Lebensspanne hat eine Erkenntnis in aller Schärfe deutlich gemacht: Die differenziellen Unterschiede im Lebenslauf beziehen sich nicht nur auf die Variabilität zwischen Kulturen, Subkulturen oder sozialen Gruppen, sondern auch auf die Unterschiede zwischen unterschiedlichen Generationen. Sexualität beispielsweise ist heutzutage von einem Jugendlichen in anderer Weise zu bewältigen als früher, ebenso wie etwa das Altern heute andere Anforderungen an die Menschen stellt als an Angehörige früherer Generationen. Von Generation zu Generation sind nur beschränkte Schlussfolgerungen möglich. So wird Entwicklungspsychologie auch immer eine ‚unendliche Geschichte‘ sein“ (Langfeldt/Nothdurft 2015, 73).
Ein aktuelles und für die Soziale Arbeit anschlussfähiges Entwicklungsmodell ist das biopsychosoziale Entwicklungsmodell (Fröhlich Gildhoff 2013). Die Bewältigung von Entwicklungsaufgaben und aktuellen Anforderungen ist demzufolge abhängig von



Im Falle von Lisa wäre also ihre Entwicklung maßgeblich von dem Drogenkonsum ihrer Mutter während der Schwangerschaft und ihrer Frühgeburt (biologische Bedingungen), ihrer guten Emotionsregulation (psychische Strukturen) sowie vom Abbruch der Mutter-Kind-Beziehung einerseits und der verlässlichen sowie warmherzigen Beziehung zu den sozial zurückgezogen lebenden Großeltern andererseits (soziale Umstände) geprägt.
In diesem Modell wird der Mensch als erkennender und potenziell reflektierender Mitgestalter seiner Entwicklung angesehen, der sich ein Bild von sich selbst und seiner Umwelt macht und bei neuen Erfahrungen modifiziert. Dabei wird nicht nur dem Entwicklungssubjekt, sondern auch den Entwicklungskontexten und den in diesen agierenden Menschen gestaltender Einfluss auf die Entwicklung zugeschrieben.
2.3 Bindung
Das Konstrukt der Bindung soll aus folgenden Gründen unter der entwicklungspsychologischen Perspektive einigermaßen gründlich erläutert werden: Ein Großteil Sozialer Arbeit manifestiert sich in psychosozialen Hilfeprozessen, die von Beziehungen getragen sind. Dabei
„[…] lässt sich für das Gelingen eines psychosozialen Hilfeprozesses eine authentische, emotional tragfähige, persönlich geprägte und dennoch reflexiv und fachlich durchdrungene Beziehungsgestaltung herauskristallisieren, die sich inmitten des Lebensalltags der AdressatInnen entfaltet“ (Gahleitner 2017, 234).
Bei dieser professionellen Beziehungsgestaltung mit KlientInnen sind SozialarbeiterInnen in der Regel permanent mit zwei Bindungssystemen konfrontiert: mit ihrem eigenen und mit dem ihrer KlientInnen. Das Bindungssystem meint die angeborene Motivation, in bedrohlich erlebten Situationen, die Nähe oder den Schutz einer vertrauten Person aufzusuchen.
Aber was bedeutet Bindung überhaupt?
2.3.1 Der Bindungsbegriff
Bindung beschreibt die angeborene soziale Motivation, Beziehungen zu anderen emotional nahe stehenden Menschen einzugehen (Bowlby 1969, Bischof 1989). Im Englischen wird zwischen „bonding“ (emotionale Bindung der Eltern an das Kind) und „attachment“ (emotionale Bindung des Kindes an seine Bezugsperson) differenziert. Das Bonding wird hormonell vorbereitet und zeitbegrenzt in den ersten Minuten nach der Geburt ausgelöst; dieses ist eine sensible Phase für den Prägungsvorgang und der Grund dafür, dass heutzutage in den meisten deutschen Krankenhäusern viel Wert darauf gelegt wird, den Kontakt zwischen Mutter und Kind unmittelbar nach der Geburt möglichst wenig zu stören.
Das Bedürfnis nach Bindung ist komplementär zu dem Bedürfnis nach Exploration – also der Wunsch, die Welt zu erkunden – und Autonomie zu verstehen. Die Herstellung der Ausgewogenheit beider Bedürfnisse gilt als eine lebenslange Entwicklungsaufgabe (Rass 2011).
Alle Kinder entwickeln im Verlaufe des ersten Lebensjahres eine oder mehrere enge Bindungen zu nahestehenden Personen. Ausgenommen davon sind Kinder, deren kognitives Entwicklungsniveau das von sechs Monaten nicht überschreitet, sowie schwer vernachlässigte Kinder. Im günstigen Fall hat das Kind bis zum Beginn des dritten Lebensjahres eine „sichere“ Bindung (s. Kapitel 2.3.2) zu einer oder mehreren zentralen Bezugspersonen aufgebaut.
„Das Kind sollte bis dahin eine emotionale Repräsentation der Bindungsperson entwickelt haben; diese ermöglicht es ihm zum einen, bei Angst und Gefahr zur Bindungsperson zu laufen und dort wie in einem ‚sicheren Hafen‘ Schutz zu suchen, und sorgt zum anderen dafür, dass das Kind innerlich auf die emotional positive Erfahrung von Schutz und Geborgenheit aus vielen solchen früheren Erlebnissen zurückgreifen und sich durch den Rückgriff und die Erinnerung an das gute Gefühl bei Aktivierung der Bindungsrepräsentation emotional selbst beruhigen kann“ (Brisch 2015, 40).
2.3.2 Bindungsstile
In der Bindungstheorie wird zwischen unterschiedlichen Bindungsstilen unterschieden. Diese Unterscheidung geht auf die Bindungsforscherin Mary Ainsworth zurück, die den sogenannten „Fremde Situations Test“ (1974/2011) entwickelte, bei dem sie das Verhalten von Kindern im Alter zwischen 12 und 18 Monaten in kurzen experimentell hergestellten Trennungssituationen beobachtete. Dabei kristallisierten sich drei unterschiedliche Bindungsstile heraus, die alle als Variationen eines normalen Bindungsverhaltens angesehen werden.
Als Typ A gilt der unsicher–vermeidende Bindungsstil – Mary Ainsworth ging davon aus, dass dieser Stil sich am häufigsten manifestieren würde, was sich aber nicht bewahrheitete. Die auf diese Weise gebundenen Kinder reagieren vermeintlich „cool“ auf die Trennung von der Bezugsperson, explorieren ungerührt weiter und zeigen keine besondere Reaktion nach Wiederkehr der Bezugsperson. Bei hormonellen Messungen am Hautwiderstand wurde aber deutlich, dass diese Kinder sehr wohl in dieser Trennungssituation Stress erleben, aber bereits Ende des ersten Lebensjahrs in der Lage sind, ihre Gefühle zu maskieren.
Martin Dornes (2012) beschreibt, dass Kinder bereits mit neun Monaten „Mentalisten“ seien, also in der Regel hoch interessiert daran sind, die Einstellungen anderer Menschen in deren Gesichtern zu lesen. Die Reaktion des Maskierens erklärt man sich in etwa auf diese Weise: Unsicher-vermeidend gebundene Kinder „lesen“ aus den Reaktionen ihrer Bezugspersonen, dass ein autonomes und gefühlsverbergendes Verhalten ein adäquates und gewünschtes Verhalten sei. Noch in vielen Kindertageseinrichtungen gelten die Kinder, die in Trennungssituationen „nicht so viel Theater“ machen, als die pflegeleichten und sich richtig verhaltenden Kinder. Auch in einigen afrikanischen Ländern scheint die Variante eines eher passiven und emotionslosen Babys und Kleinkindes populärer. Das Kind ist dann durch sein ruhiges Verhalten besser von anderen zu beaufsichtigen; Weinen oder Schreien gilt eher als Zeichen für eine ernsthafte Gefährdung (Atabavikpo Lochmann 2015).
Als Typ B gilt der sicher gebundene Bindungsstil – etwa 60–70 % aller Kinder sind den meisten Studien zufolge diesem Stil zuzurechnen. Sicher gebundene Kinder reagieren in der Regel mit deutlichen Emotionen (Weinen oder Schreien) auf die Trennung von der Bezugsperson, lassen sich dann beruhigen und reagieren mit klar erkennbarer Freude auf die Wiederkehr der Bezugsperson. Gegen Ende des zweiten Lebensjahres verhalten sich sicher gebundene Kinder überwiegend kooperativ. Zu der Entwicklung eines sicheren Bindungsstils gehört die elterliche Feinfühligkeit bzw. die intuitive Elternschaft, die sich bei einem Großteil der Eltern als Anpassungsleistung nach der Geburt einstellt (Papoušek/Papoušek 1987) und auf die im nächsten Abschnitt (2.3.3) eingegangen wird.
Der Typ C wird als unsicher-ambivalenter Bindungsstil bezeichnet. Die betroffenen Kinder reagieren ebenfalls wie sicher gebundene Kinder deutlich erkennbar auf die Trennung, lassen sich dann aber nicht beruhigen und bleiben auch bei der Wiederkehr der Bezugsperson eher in der negativen Emotion. Häufig korreliert dieser Bindungsstil mit trennungsängstlichen oder zumindest sehr trennungsambivalenten Bezugspersonen.
Später wurde von Mary Main und Judith Solomon (1986) auch der sogenannte desorganisierte Bindungsstil (Typ D) klassifiziert. Dieser zeigt sich in einem äußerst wechselhaften, nicht eindeutigen Bindungsverhalten und geht z.T. mit plötzlichem Erstarren und eingefrorener Mimik einher. Er taucht bei ca. 5–10% der beobachteten Kinder auf und wird im Zusammenhang mit traumatisierenden Erlebnissen, Misshandlung oder auch chronischer Vernachlässigung gesehen.
Von den Bindungsstilen zu unterscheiden sind Bindungsstörungen, die in kinderpsychiatrische Diagnosesysteme einzuordnen sind. Hierzu zählt beispielsweise die reaktive Bindungsstörung, die von Angst und großer Zurückhaltung gegenüber Erwachsenen geprägt ist, und die Bindungsstörung des Kindesalters mit Enthemmung, die sich in Distanz- und Wahllosigkeit in Zuwendungsbezeugungen gegenüber Erwachsenen manifestiert. Letztere tritt des Öfteren bei stark deprivierten und vernachlässigten Kindern auf, die schon viele Wechsel ihrer Bezugspersonen erfahren mussten.
„Das Muster der sicheren Bindung wird als adaptiv für eine gesunde Entwicklung betrachtet. Trotzdem handelt es sich bei den bisher beschriebenen unsicheren Bindungsmustern und auch bei der Bindungsdesorganisation nicht um pathologische Muster, sondern um Varianten von Bindungsmustern, die innerhalb eines normalen Verhaltensspektrums angesiedelt werden können“ (Spangler 2011, 284).
Sichere oder unsichere Bindungsstile sind das Ergebnis gemeinsamer und individuell unterschiedlicher Interaktionserfahrungen. Sie können auch von Bezugsperson zu Bezugsperson variieren, sind geronnene Beziehungserfahrungen und nicht als stabile Eigenschaftsbeschreibungen zu betrachten. Frühe Bindungserfahrungen sind zwar für die spätere Entwicklung hoch bedeutsam. Dennoch kann das innere Arbeitsmodell von Bindung sich durch spätere positive Beziehungserfahrungen positiv oder durch das Auftreten schwerer Belastungen im späteren Leben auch negativ verändern (Seiffge-Krenke 2015). Bindungsprozesse werden als mentale Arbeitsmodelle etwa ab Mitte des zweiten Lebensjahres gespeichert – dieses geht auch mit dem Beginn des Spracherwerbs einher; mit fünf Jahren sind sie meist entwickelt und bilden das Bindungssystem.
2.3.3 Das Konzept der elterlichen Feinfühligkeit
Elterliche Feinfühligkeit setzt sich aus drei Komponenten zusammen:
a. Wahrnehmung der Signale des Kindes
b. angemessene Interpretation dieser Signale
c. angemessene und prompte Reaktion auf diese Signale
Bei einem Säugling sollte im Sinne von Feinfühligkeit auf die Bedürfnisäußerung – beispielsweise Schreien wegen Hungers – direkt geantwortet und sofern möglich auch mit sofortiger Bedürfnisbefriedigung gehandelt werden. Bei einem Kind um das erste Lebensjahr herum würde feinfühliges Handeln dagegen bedeuten, zwar direkt auf die Bedürfnisäußerung des Kindes zu antworten, aber je nach Situation nicht unbedingt gleich zu handeln und das Bedürfnis umgehend zu befriedigen (also nicht sofort unbekleidet und nass aus der Dusche zu springen, wenn das Kleinkind Hunger äußert).
Zu diesen feinfühligen Kompetenzen gehört es auch, dem Kind markiert seine Gefühle zu spiegeln. Das bedeutet, dem Kind durch Gestik, Mimik und Worte zu verstehen zu geben, dass man seine akute Not (z. B. Hunger, Schmerz, Müdigkeit) versteht, aber nicht teilt, und darum in der Lage ist, das Kind zu trösten. Das Kind bekommt somit seine Gefühle zum einen als seine eigenen und zum anderen als vom Gegenüber aushaltbar gespiegelt. Diese markierte Spiegelung ist zentral für die Ausbildung der Mentalisierungsfähigkeit, auf die unter Kapitel 2.6.1 eingegangen wird.
Etwa dreiviertel aller Eltern verfügen über derlei intuitive kommunikative Kompetenzen. Auch Geschwisterkinder können etwa ab dem 4. Lebensjahr im Umgang mit dem jüngeren Geschwisterkind Feinfühligkeit zeigen. Einige Eltern, beispielsweise depressiv erkrankte Elternteile, haben jedoch Schwierigkeiten, feinfühlig gegenüber ihren Kindern zu agieren (Murray 2011).
Lange Zeit ging es bei dem Konstrukt der Feinfühligkeit immer nur um die mütterliche Feinfühligkeit. Heute wird zwischen einem mütterlichen und einem väterlichen feinfühligen Interaktionsstil unterschieden – wobei diese Bezeichnungen insofern missverständlich sind, als dass sie nicht geschlechtsgebunden sind. Der sogenannte mütterliche Interaktionsstil, den aber auch Männer praktizieren können, zeichnet sich eher durch Konventionalität, Fürsorglichkeit und Sicherheit aus. Der sogenannte väterliche Interaktionsstil, den ebenso auch Mütter verfolgen können, manifestiert sich in unkonventionellem, das Erregungsniveau stimulierendem Verhalten (Grossmann/Grossmann 2006).
Ein wesentlicher Faktor für die Interaktion zwischen Eltern und Kind ist aber nicht nur die elterliche Feinfühligkeit, sondern u.a. auch der Gesundheitszustand und das Temperament des Kindes (Bindt 2003); alle diese Faktoren haben durchaus Auswirkungen auf den jeweiligen Bindungsstil der Kinder. In der Temperamentsforschung werden drei Temperamentsdimensionen unterschieden (Elsner/Pauen 2012):
a. das einfache Temperament (easy babies): Dazu zählen die sogenannten „Sonnenscheinkinder“ – explorativ, freundlich, mit hoher Selbstregulationsfähigkeit und kontaktsuchend.
b. das langsam auftauende Temperament (slow-to-warm-up babies): Diese Kinder verhalten sich eher zurückgezogen und beobachtend, verfügen über eine hohe Selbstregulationsfähigkeit und sind wenig reizoffen.
c. das schwierige Temperament (difficult babies): diese Kinder sind oftmals sehr explorativ, haben aber eine niedrige Selbstregulationsfähigkeit und sind sehr reizoffen; zu ihnen zählen die sogenannten „Schreibabys“.
Wichtig hierbei zu beachten ist die Passung bzw. das Zusammentreffen der unterschiedlichen Faktoren. So ist es auch für feinfühlige Eltern herausfordernder, eine sichere Bindung mit einem Kind mit einem schwierigen Temperament einzugehen; dennoch kann dieses durchaus gelingen. Wenn jedoch Eltern, die nur über geringe intuitive kommunikative Kompetenzen verfügen, ein Kind mit einem schwierigen Temperament haben, ist das Risiko für eine unsichere Bindung bzw. auch für die Entwicklung einer Bindungsstörung durchaus erhöht.
2.3.4 Bindungsstile im Erwachsenenalter
Zur Untersuchung von Bindungsstilen im Erwachsenenalter – hier spricht man von Bindungseinstellung – entwickelte Mary Main das Adult Attachment Interview (AAI) (Gloger-Tippelt 2012). Hierbei zeigten sich ähnliche Unterschiede wie bei Kindern. So konnten die autonome Bindungseinstellung, die distanziertbeziehungsabweisende Bindungseinstellung, die präokkupiertverstrickte Bindungseinstellung und die vom unverarbeiteten Objektverlust geprägte Bindungseinstellung unterschieden werden (Grossmann/Grossmann 2006).
Die autonome Bindungseinstellung von Eltern, die eine realistische und nicht idealisierende Erinnerung an die eigene Kindheit sowie positive und negative reflektierte Gefühle gegenüber Bindungspersonen umfasst, korrelierte überwiegend mit dem sicher gebundenen Bindungsstil ihrer Kinder.
Eltern mit distanziert beziehungsabweisender Bindungseinstellung haben oft viele Erinnerungen an ihre eigene Kindheit verdrängt, idealisieren diese, betonen ihre eigene Unabhängigkeit und Stärke und beharren darauf, dass es ihnen an nichts gefehlt habe. Dieser Bindungsstil korreliert mit dem unsicher-vermeidend gebundenen Bindungstyp bei Kindern.
Die präokkupiert-verstrickte Bindungseinstellung ist durch eine übermäßig detaillierte und wenig distanzierte Erinnerung an die eigene Kindheit sowie eine noch starke Abhängigkeit gegenüber den ursprünglichen Bindungspersonen gekennzeichnet. Elternteile mit der präokkupiert-verstrickten Bindungseinstellung haben oft unsicher-ambivalent gebundene Kinder mit erschwerten Ablöseprozessen.
Menschen mit einer von einem unverarbeiteten Objektverlust geprägten Bindungseinstellung haben oftmals schwere traumatisierende Verlusterlebnisse in ihrer Kindheit erfahren, die sie nicht bearbeiten konnten; dieses kann sich dann auch transgenerational in einem desorganisiert gebundenen Bindungsstil ihrer Kinder fortsetzen.
2.3.5 Die Relevanz des Bindungssystems
Bindungen werden als dauerhafte, dyadische Beziehungen definiert und werden nicht nur für die frühe Kindheit angenommen, sondern für den gesamten Lebensverlauf. Nicht jede Bezugsperson wird zur Bindungsperson, aber ein Kind ist in der Regel an mehr Personen gebunden, als nur seine Eltern.
In vertrauten Situationen und bei ausgeglichener Befindlichkeit gehen Kinder eher dem Interesse nach Neuem nach; in unvertrauten Situationen überwiegt das Bedürfnis nach emotionaler Sicherheit und sie suchen Rückhalt bei den Menschen, zu denen sie eine sichere Bindung entwickelt haben. Dieses lässt sich auch auf das Erwachsenenalter übertragen: In einer Erstsemesterveranstaltung werden die Studierenden vorrangig das Bedürfnis haben, mit ihnen vertrauten Menschen zusammenzusitzen – im letzten Semester ist das Bedürfnis, sich nach außen und beispielsweise in Richtung Berufswelt zu orientieren, meistens relativ groß.
Eine Bindungsperson qualifiziert sich dadurch, dass sie vom Kind als personifizierte emotionale und empathische Sicherheitsquelle identifiziert wird, von der aus das Kind, je nach Situation und Kontext, regelmäßig exploriert und zurückkehrt, um emotional aufzutanken. Ein typisches Beispiel ist das von der Bezugsperson wegrobbende und sich doch immer wieder umdrehende Kleinkind, das sich auf diese Weise der Anwesenheit und der Aufmerksamkeit durch die Bezugsperson versichert. In Situationen der Verunsicherung und Angst wird das Bindungssystem aktiviert, d.h., Menschen suchen entsprechend ihres Bindungsstils besondere Nähe oder besondere Distanz zu den relevanten Bezugspersonen. Aus diesem Grunde begegnen SozialarbeiterInnen ihren KlientInnen auch oft in solchen Situationen, in denen deren Bindungssystem aktiviert ist – d.h. also in Notsituationen oder in Momenten, die von gefühlter oder realer Bedrohung geprägt sind.