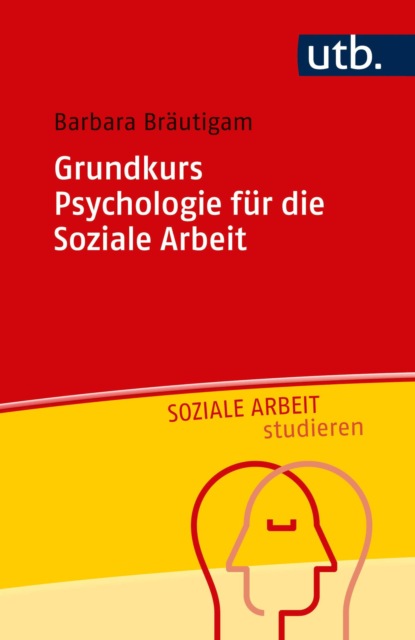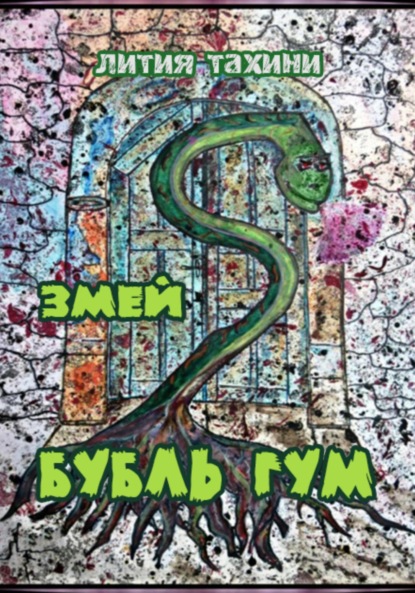- -
- 100%
- +

Dieses Beispiel stellt die Aktivierung einer Bindungsreaktion in einer für Max bedrohlichen Situation dar. Die bedrohliche Situation besteht zum einen darin, dass Max sich generell in seinen Rückkehrwünschen bedroht sieht, da hierzu noch keine verlässliche Entscheidung getroffen wurde. Zum anderen werden in dem plötzlichen Akt des Zimmer-Verlassens durch die Mutter möglicherweise alte Verlassenheitsängste aktiviert. Max hat als kleines Kind öfter die Erfahrung gemacht, dass seine Wünsche nach Nähe und Trost offenbar nicht aushaltbar sind und nicht erfüllt werden können, und reagiert zunächst mit Frustration, die sich dann in Aggression kehrt, wenn er den Wunsch nach Nähe verspürt. Für seine Eltern, die vermutlich über eine distanziertbeziehungsabweisende Bindungseinstellung verfügen, sind seine „Nähewünsche“ als solche nicht mehr erkennbar. Beide Eltern verfügen nur über ein sehr geringes Erinnerungsvermögen an ihre eigene Kindheit, verbalisieren wenig ihre Gefühle und pochen sehr auf ihre Autonomie und Unabhängigkeit. Max maskiert seine Nähe- und Trostbedürfnisse hinter pseudoautonomem, ruppigem und aggressivem Verhalten. Max‘ Eltern können demzufolge sein Verhalten aus gut nachvollziehbaren Gründen nur als gegen sich gerichtet erkennen.
Bindungsstile können sich im Laufe des Lebens modifizieren oder durch korrigierende Erfahrungen verändert werden. Zu den wesentlichen protektiven Faktoren zählt eine längere und stabile Beziehung an eine Bezugsperson – dieses kann z.B. eine Großmutter, ein Pflegevater oder auch eine langjährige sozialpädagogische Familienhelferin sein – eine stabile Partnerschaft im Erwachsenenalter oder auch eine psychotherapeutische Behandlung (Kißgen 2009).
Anhand von Bindungstheorien ist es also insgesamt möglich, Verhalten sowie Erlebens- und Verarbeitungsweisen von kleinen Kindern in emotionalen Notsituationen bzw. körperlich bedrohlichen Situationen zu beschreiben und zu erklären. Bindungssysteme werden jedoch nicht nur in der Kindheit, sondern ein Leben lang in Notsituationen aktiviert. Auch SozialarbeiterInnen selbst müssen also – beispielsweise in Krisensituationen – darauf achten, dass KlientInnen ihre eigenen Bindungsbedürfnissignale erkennen und wenn möglich auch zeigen dürfen. Ein weiteres gutes Beispiel dafür ist, dass es für Menschen auf der Flucht von immenser Wichtigkeit ist, einen wie auch immer gearteten Kontakt zu ihren Angehörigen in ihrer Heimat zu haben, sodass die Schaffung oder Ermöglichung von Internet- und/oder telefonischen Verbindungen beispielsweise in Notunterkünften oder Flüchtlingsheimen unter Bindungsgesichtspunkten als absolut elementar anzusehen ist.
2.4 Entwicklungsfaktoren und -risiken in der Schwangerschaft
Die meisten Frauen erleben Schwangerschaft als einen schönen und unkomplizierten Prozess. SozialarbeiterInnen sind aber häufig mit den Risiken und Belastungen rund um die Schwangerschaft bei den betroffenen Frauen und Familien beschäftigt. Aus diesem Grund werden in diesem Kapitel die entwicklungsbezogenen Risiken der Schwangerschaft beschrieben.
Ein Risiko jeder Schwangerschaft ist die Fehlgeburt. Bereits nach der Zeugung beginnt der biologische Entwicklungsprozess eines Individuums. Etwa zehn Tage nach der Empfängnis bilden sich die ersten Zellen an der Uteruswand der Mutter. Allerdings überleben nicht einmal die Hälfte aller befruchteten Eizellen die ersten zwei Wochen (Myers 2014). Die Zahl der (in diesem frühen Stadium der Schwangerschaft meist unbemerkten) Fehlgeburten liegt in den ersten vier Wochen bei fast 50%.
Fehlgeburten werden in Anamnesen und Genogrammen, bei denen es um die Erfassung individueller und familienbezogener Lebenserfahrungen geht, oft verschwiegen – aus Scham, dem Gefühl vermeintlicher Bedeutungslosigkeit oder auch aus der Empfindung heraus, allein damit zu sein. Sie haben aber in der Regel für die Mütter, Väter und die Geschwister eine hohe psychische Bedeutung und können auch eine Belastung darstellen, die umso stärker ist, desto tabuisierter sie gehandhabt werden.
Andere Risiken für die Entwicklung des Kindes in der Schwangerschaft sind Erkrankungen der Mutter, beispielsweise durch Virusinfektionen, oder unerwartete Komplikationen während der Geburt. Ein plötzlicher Sauerstoffmangel während der Geburt kann beispielsweise zu schweren Folgeschäden führen, die die werdenden Eltern oft unvorbereitet schwer treffen. Sich in dieser Situation um Eltern zu kümmern und Unterstützung anzubieten, ist oft die Aufgabe von in Kliniken tätigen SozialarbeiterInnen.
Auch das Verhalten der Mutter kann Schädigungen für das Kind verursachen. So schaden Nikotin, Alkohol sowie der Konsum anderer Drogen – mit Ausnahme von Koffein – der Entwicklung des Embryos und späteren Fötus. Es sei an den eingangs beschriebenen Fall von Lisa erinnert, bei der der Drogenkonsum der Mutter mit hoher Wahrscheinlichkeit ein Auslöser der Frühgeburt gewesen ist. Weitere Folgeschäden können Missbildungen und/oder Verhaltensstörungen sein. Die Zahl der jährlich in Deutschland mit alkoholbedingten Schädigungen auf die Welt gebrachten Kinder liegt in den 2010er Jahren bei etwa 10.000, ca. 2000 Babys erfüllen das Vollbild des „fetalen Alkoholsyndroms“. Dieses kann sich in drei Bereichen entfalten: in körperlichen Fehlbildungen, Wachstumsstörungen und Schädigungen des zentralen Nervensystems. Diese Gruppe bildet ein nicht zu vernachlässigendes Klientel von SozialarbeiterInnen (Pfinder/Feldmann 2011, ter Horst 2010).
SozialarbeiterInnen arbeiten nicht nur mit den hiervon betroffenen Kindern, sondern auch mit ihren Eltern, und insbesondere mit ihren Müttern. Sie haben die Aufgabe, in der Arbeit mit drogen- und alkoholabhängigen potenziellen und schwangeren Müttern präventiv tätig zu sein und diese aufzuklären. Wenn die Kinder geboren wurden, sind sie weiter unterstützend tätig in der Elternarbeit.
Unterschätzt werden nach wie vor die Folgen einer unerkannten und nicht behandelten postpartalen Depression. Etwa 10–15% (Bühring 2012) der Mütter erleiden eine postpartale Depression, die sich von dem zwei- bis fünftägigen „Babyblues“ unmittelbar nach der Geburt in ihrer Länge und ihrem Ausmaß unterscheidet. Erschwerend für die Erkennung und Behandlung dieser Erkrankung kommt hinzu, dass der gesellschaftliche Druck auf die Frauen, jetzt glücklich mit ihrem neugeborenen Kind sein zu müssen, nach wie vor enorm hoch ist und die Scham, diesen Erwartungen nicht entsprechen zu können, umso höher. Aus sozialarbeiterischer Sicht ist insbesondere darauf zu achten, die postpartale Depression als solche zu enttabuisieren, über Behandlungsmöglichkeiten zu informieren, Betroffene ggf. an psychiatrische oder psychotherapeutische Fachkräfte weiter zu vermitteln sowie die sozialen Netzwerke der Betroffenen zu aktivieren, um diese auch informell zu unterstützen. Insbesondere aufsuchende Hilfeformen sind ausgesprochen geeignet, die Rate unerkannter und unbehandelter postpartaler Depressionen zu senken (Hübner-Liebermann et al. 2012). Die postpartale Psychose, eine Erkrankung, bei der die betroffene Frau unter extremen Angst-, Wahnvorstellungen oder Halluzinationen leidet, ist eher selten und betrifft 0,1–0,2% der Mütter. Sie bedürfen in der Regel einer sofortigen stationären psychiatrischen Behandlung, wobei idealerweise Fachkräfte der Sozialen Arbeit die Zusammenarbeit verschiedener Professionen koordinieren sollten.
2.5 Entwicklung in der Säuglings-und Kleinkindzeit
„Für Joey sind fast alle Begegnungen mit der Welt dramatisch und vom Gefühl bestimmt. Elemente und Wesen dieser dramatischen Zusammentreffen sind für uns Erwachsene nicht offensichtlich. Von allen Dingen im Zimmer erregt der Sonnenschein an der Wand Joeys Aufmerksamkeit am meisten und hält ihn in Bann. Die Helligkeit und Intensität faszinieren ihn. Im Alter von sechs Wochen ist seine Sehfähigkeit schon recht gut entwickelt, wenn auch zur Perfektion noch einiges fehlt. Er erkennt bereits verschiedene Farben, Formen und Intensitätsgrade. Von Geburt an hat er starke Vorlieben für bestimmte Dinge, die er ansehen möchte, für Dinge, die ihm gefallen. An erster Stelle steht dabei die Intensität einer Wahrnehmung […]“ (Stern/Bruschweiler-Stern 2004, 24).
Dieses Zitat stammt aus dem fiktiven „Tagebuch eines Babys“ des britischen Entwicklungspsychologen Daniel Stern, bei dem höchst eindrücklich die Wahrnehmung eines Sonnenstrahls durch einen Säugling beschrieben wird. Bereits Neugeborene verfügen über ein differenziertes Wahrnehmungsvermögen: Sie schmecken und unterscheiden von Anfang an zwischen „süß“, „sauer“ und „bitter“. Nach wenigen Tagen erkennen sie ihre Mutter am Geruch. Sie hören bereits seit dem sechsten Schwangerschaftsmonat und orientieren sich als Neugeborene in Richtung einer Schallquelle. Sie sind in der Lage, Objekte, Muster, Figuren oder Formen zu erkennen, wenn sie sie auch noch nicht mit den Augen fixieren können, und sie unterscheiden Farbtöne und Helligkeitsabstufungen. Im Unterschied zu Sigmund Freud, der den Säugling noch als passives und einzig und allein an seiner Lustbefriedigung orientiertes Wesen ansah, hat der Entwicklungspsychologe Martin Dornes (1993) das Bild des kompetenten und an Interaktion interessierten Säuglings geprägt. Im Folgenden werden zum einen die Entwicklung des Selbst, und zum anderen die frühe Entwicklung kognitiver, emotionaler und selbstregulatorischer Prozesse beschrieben.
2.5.1 Die Entwicklung des Selbst
Daniel Stern (1979)schildert die Entwicklung des Selbstempfindens in vier Stadien. Das erste Stadium wird durch ein sogenanntes unreflektiertes Selbstempfinden gekennzeichnet; das Neugeborene ist ganz mit sich und seinen vegetativen Prozessen beschäftigt, von denen es beherrscht und manchmal auch gequält wird. Stern hat für dieses Stadium den schönen Begriff des auftauchenden Selbst geprägt; der dritte Lebensmonat, der auch den Übergang von der Neugeborenen- zur Säuglingszeit darstellt, ist oft ein Zeitpunkt, an dem viele Kinder erst „richtig“auf die Welt kommen.
Ab dem dritten Monat erfolgt laut Stern die Bildung eines Kernselbst. Das Kind spürt, dass es von der Mutter körperlich getrennt ist, und es existiert ein primär körperliches Selbstempfinden. Ab diesem Zeitpunkt werden bereits zwei entgegengesetzte Grundbedürfnisse erkennbar, die den Menschen ein Leben lang begleiten werden: das Bedürfnis nach Bindung und das Bedürfnis nach Exploration und Autonomie. Lichtenberg (1991) spricht von fünf Motivationssystemen, die er bereits dem Säuglingsalter zuschrieb. Dazu gehören die Notwendigkeit biologische Bedürfnisse wie Essen und Schlafen zu erfüllen, das Bedürfnis nach Bindung, das Bedürfnis nach Exploration und Selbstbehauptung, das Bedürfnis nach Rückzug, wenn unangenehme Dinge passieren, und das Bedürfnis nach Sinnlichkeit und Sexualität.
Ungefähr mit Beginn des siebten Lebensmonats wird, so Stern, das Stadium des subjektiven Selbst erreicht. Dieses bedeutet, dass das Kind ab diesem Zeitpunkt die zentrale Erfahrung von Intersubjektivität macht – Erlebnisse und Gefühle können mit anderen geteilt werden. Interessanterweise geht dieses Stadium mit einem bedeutsamen Schritt in der motorischen Entwicklung einher: Etwa ab diesem Zeitpunkt können sich die meisten Kinder auf irgendeine Weise von ihren Bezugspersonen wegbewegen. Charakteristisch ist ein eifriges Wegrobben, das von einem in regelmäßigen Abständen den Kopf in Richtung der Bezugsperson Wenden begleitet wird – nach dem Motto: „Bist Du noch da? Na dann ist gut, dann kann ich weiter. “
In dieser Sequenz bildet sich das Grundkonzept bzw. die Grundspannung komplementärer menschlicher Bedürfnisse ab, die bereits bei der Beschreibung des Bindungsbegriffs (s. Kapitel 2.3.1) benannt wurde: Es geht um die Befriedigung des Explorationsbedürfnisses – die Suche nach Veränderung – und um die des Bindungsbedürfnisses – der Wunsch nach einer sicheren Rückzugsmöglichkeit. Ungefähr zur selben Zeit setzt das sogenannte „Fremdeln“ ein, das sich vor allem in der Abwendung des Blicks und lauten Unmutsäußerungen manifestiert, wenn eine sich dem Kind nicht ganz so vertraute Person plötzlich nähert. Dieses Phänomen tritt auf, wenn sich bereits eine Bindung an eine Bezugsperson etabliert hat, also Vertrauen entstanden ist. Unter funktionalen Gesichtspunkten erklärt sich das Fremdeln aus der neu entstandenen Fähigkeit zu eigener Fortbewegung. Das Kind kann sich selbst wegbewegen und sich vor Fremden und nicht fürsorgemotivierten Personen quasi schützen (Bischof-Köhler 2011).
Etwa ab dem 15–18. Lebensmonat setzt das vierte Stadium des Selbstempfindens ein, welches Stern als das verbale bzw. konzeptuelle Selbst bezeichnet. Das Kind wird sich seiner selbst als „ich“ bewusst. Bis zu dieser Zeit ist das sog. Playmate-Verhalten zu beobachten. Die Kinder lächeln oder spielen mit dem Spiegelbild wie mit einem Spielpartner, identifizieren es aber nicht als ihr eigenes Abbild. Nun erkennen Kinder ihr eigenes Spiegelbild.
Auch motivational geschieht in diesem neuen Stadium des Selbstempfindens eine Veränderung: Die Kinder bekommen ein Gefühl für ihre eigene Leistung. In einem Experiment wurde deutlich, dass Kinder ab dem Zeitpunkt, an dem sie sich selbst im Spiegel erkennen können, nicht mehr gelassen darauf reagieren, ob sie oder jemand anderes den letzten Stein auf einen selbst gebauten Turm legen. Sie geben deutlich zu erkennen, die Erfahrung des Selbst-fertiggestellt-Habens machen zu wollen (Bischof-Köhler 2011). Diese Phase geht mit einer zunehmenden Fähigkeit zu symbolisieren, d.h. in Als-ob-Möglichkeiten zu denken, einher. Es ist eine Phase, in der man Kinder wie selbstverständlich mit einem Auto am Ohr durchs Zimmer streifen sieht – sie „telefonieren“ dann, bzw. tun so, als ob.
„In der Ausgestaltung von Als-ob-Situationen – ich tue so, als wenn ich einkaufen gehe, indem ich Mamas Schlüssel, ihre Schuhe und eine Plastiktüte als Handtasche nehme – macht sich das Kind eine weitere Realität verfügbar. Mit symbolischen Gesten und Handlungen setzt es Erfahrungen und Ereignisse in Szene, die von realen Ereignissen und Gegenständen entkoppelt sind. Das Spiel ist geprägt von Intensität, Ernsthaftigkeit, Freude, Kreativität und Konzentration; es folgt einem inneren ‚Faden‘ und führt zu Zufriedenheit und Sättigung“ (Rass 2011, 91).
Die Fähigkeit zur Symbolisierung ist eine zentrale Voraussetzung für die Entwicklung späterer Verbalisierungs- und Abstraktionsfähigkeiten und auch dafür, Emotionen in Sprache zu übersetzen und nicht unmittelbar auszuagieren. Jugendliche mit dissozialen Störungen – eine häufige Klientel von SozialarbeiterInnen – sind oftmals genau in dieser Fähigkeit beeinträchtigt; ihnen fehlt die Möglichkeit, ihre Wut zu verbalisieren, sodass sie sie in gewalttätigen Handlungen ausdrücken müssen.
2.5.2 Kognitionen, Emotionen und die Fähigkeit zur Selbstregulation
Jean Piaget (1896–1980) gilt als einer der wichtigsten Entwicklungspsychologen, der sich mit der geistigen Entwicklung von Säuglingen und Kindern beschäftigte. Er verstand diese geistige Entwicklung als Prozess der aktiven Konstruktion von Wissen in der Interaktion des Individuums mit der Umwelt. Das Kind bezeichnete Piaget als einen von einer inneren Neugier getriebenen Wissenschaftler, der aktiv seine Umwelt erkunde (Piaget 2003, Sodian 2012). Dabei beschrieb er den Erkenntnisprozess im Wechselspiel von zwei komplementären Mechanismen. Den einen nannte Piaget Assimilation. Assimilation geschehe immer dann, wenn etwas Neues in bestehende mentale Strukturen integriert werden könne. Dieser reiche aber allein nicht aus, um sich den Lernzuwachs von Kindern zu erklären:
„Wenn nur Assimilation an der Entwicklung beteiligt wäre, gäbe es keine Variationen in der Struktur des Kindes. Infolgedessen würde es keine neuen Inhalte erwerben und sich nicht weiterentwickeln“ (Piaget 2003, 55).
Den anderen und ergänzenden Mechanismus bezeichnete Piaget als Akkomodation. Hierbei müssen sich die mentalen Strukturen an die Umweltanforderungen anpassen und entwickeln sich auf diese Weise weiter. Das Wechselspiel dieser beiden Mechanismen soll an folgendem Beispiel illustriert werden:

Piaget umschrieb die ersten zwei Lebensjahre als sensumotorisches Stadium, in dem die kognitiven Grundlagen für die sensorischen und motorischen Handlungen – die sensumotorischen Schemata – gelegt werden. Dazu zählen z.B. das Saugschema und die Exploration mit dem Mund. Jean Piaget fand auch heraus, dass Kinder bis zu einem bestimmten Alter – er schätzte es bei acht Monaten – keine Objektpermanenz haben. Sie gehen also davon aus, dass ein Gegenstand – z.B. ein Ball –, der aus ihrem Blickfeld verschwindet, dann auch nicht mehr existiert. Nach heutigen Erkenntnissen weiß man allerdings, dass Piaget die kognitiven Fähigkeiten jüngerer Kinder deutlich unterschätzte, dass sich die Fähigkeit zur Objektpermanenz deutlich früher einstellt und prozesshaft verläuft, als Piaget dieses angenommen hatte (Sodian 2012).
Bereits im Säuglingsalter können kulturübergreifend sieben bis zehn Basisemotionen beobachtet werden. Dazu zählen Freude, Angst, Trauer, Wut, Ekel, Verachtung, Überraschung, Interesse, Scham und Schuld (Izard 1999, Dornes 2012). Im Film „Alles steht Kopf“, der vom Emotionsforscher Dacher Keltner mitentwickelt wurde, wird sichtbar, wie sehr Gefühle die Weltwahrnehmung dominieren und bei gleichzeitigem Auftreten auch verwirren können. Emotionen sind immer von physiologischen Reaktionen und kognitiven Bewertungen begleitet, wobei manchmal die Emotion der Kognition vorausgeht und manchmal umgekehrt die Kognition die Emotion bestimmt (Myers 2014). Auf dieser Basis arbeitet beispielsweise die kognitive Verhaltenstherapie mit depressiven Menschen, in dem sie mit ihren Klienten positive Umdeutungen von chronisch als negativ erlebten Situationen übt (s. Kapitel 6.3). Säuglinge und Kleinkinder sind noch nicht in der Lage, negative Emotionen kognitiv zu beeinflussen, und sind ihren Bedürfnissen und Gefühlen daher – anders als Erwachsene – ausgeliefert. Sie brauchen in der Regel Unterstützung bei ihrer Emotions- und Spannungsregulation.
Besonders evident wird dies bei sogenannten Trotzanfällen. Trotzanfälle, die in der Regel im dritten und vierten Lebensjahr auftreten, resultieren entwicklungspsychologisch betrachtet aus einer faktischen Diskrepanz zwischen dem wachsenden Autonomieanspruch des Kindes auf der einen und seinen im Vergleich dazu noch nicht ausreichenden Fähigkeiten auf der anderen Seite. Das Kind kann weder alles, noch darf es alles. Infolgedessen ist es häufig frustriert und drückt in Trotzanfällen seine Wut und seinen Ärger aus. Ebenso kann Trotzverhalten entstehen, wenn das Kind sich schämt und diese Scham nicht aushalten kann (Wurmser 1998). Trotzanfälle können aber auch dann auftreten, wenn sich das Kind gar nicht in Interaktion befindet. Beispielsweise kann es darum gehen, dass ein Kind sich zwischen zwei Spielzeugen oder Aktivitäten nicht entscheiden kann und der entstehende Motivkonflikt zu einer totalen Handlungsblockade führt.
„Mit dem Ich als erlebtem Zentrum des Wollens und der Möglichkeit, sich Handlungsalternativen vorzustellen, entsteht also die Notwendigkeit, interne Motivkonflikte zu managen. Das Kind muss also als nächstes lernen, dass Selbst-Wollen-Können nicht bedeutet, alles gleichzeitig wollen zu können“ (Bischof-Köhler 2011, 160).
Diese Fähigkeit erwirbt das Kind aber meist erst nach dem vierten Lebensjahr. In den Trotzanfällen verbirgt sich manchmal auch eine interaktive Machtthematik; das Kind möchte in diesem Alter seine Bezugspersonen herausfordern. In der Regel wird dieser Aspekt aber von den erwachsenen Interaktionspartnern überschätzt, die strafend oder ignorierend auf das trotzige Verhalten reagieren. Dieses resultiert oftmals aus der gefühlten Ohnmacht, die sich vom Kind auf den Erwachsenen überträgt. Auch die Mutter kann nichts daran ändern, dass ihr zweijähriger Sohn noch nicht in der Lage ist, die Schleife am Schuh zu binden, und sie kann ihn in dieser Situation nicht zufriedenstellen.
„‚Nein‘ und ‚Selbermachen-Wollen‘ ist die Devise; diese Phase führt unausweichlich zum Zusammenprall mit den grenzsetzenden Erwachsenen, aber auch zur narzisstischen Kränkung, dass die Geschicklichkeit noch fehlt, um gewisse Handlungen fehlerfrei durchzuführen […] eine existenziell wichtige Aufgabe […] ist, dem Kind die Erfahrung zu vermitteln, dass es eine aversive Position einnehmen kann und dass in der Folge die Gemeinsamkeit gefahrlos wiederherstellbar ist“ (Ornstein/Rass 2014, 30f.).
Der Umgang mit diesem Phänomen ist insbesondere bei der Elternarbeit, wie auch in der direkten sozialpädagogischen Arbeit mit kleinen Kindern, enorm reflexionsbedürftig, weil Trotzreaktionen wie wenig andere Phänomene, autoritäre, machtdemonstrierende und z.T. auch gewalttätige Impulse in uns selbst oder bei den betroffenen Eltern hervorrufen (Brisch 2015). Zwischen dem dritten und vierten Lebensjahr resultieren viele Kinderschutzfälle daraus, dass Eltern mit ohnmächtiger Wut auf das, von ihnen als bösartig und ungehorsam interpretierte Verhalten ihrer Kinder reagieren.
Eine sozialpädagogische Aufgabe könnte in dieser Situation beispielsweise sein, die an der Interaktion beteiligten Menschen darin zu stützen, die Ohnmacht auf beiden Seiten – auf Seiten des Kindes, etwas nicht zu können, und auf Seite der Erwachsenen, nicht helfen zu können, – auszuhalten und eher in die Trost-, denn in die Bestrafungsreaktion zu gehen. Dazu bedarf es allerdings auf Seiten der SozialarbeiterInnen, gelegentlich einen – freundlichen – Blick auf die eigenen trotzigen Seiten zu werfen (Bräutigam 2016).
2.6 Entwicklung der Kindheit
„Kindsein war: hinfallen, im Tunnel schreien, ins Badewasser pinkeln, Läuse haben, nicht auf Gehwegplatten mit Sprung treten, Brille kriegen, schaukeln und kotzen, nicht den Boden berühren!, Brottasche schleudern, Muttervaterkind spielen, Scherben sammeln, Schlüssel verlieren, aus der Zahnlücke Blut saugen, Puppe operieren, der Katze das Laufen auf zwei Beinen beibringen […] “ (Budde 2010).
In Bezug auf die kognitive Entwicklung beginnt laut Piaget etwa nach Abschluss des zweiten Lebensjahrs das sog. präoperatorische Stadium, das in etwa bis zum siebten Lebensjahr anhält (Sodian 2012). Es bilden sich auf Menschen und auf Gegenstände bezogen stabile mentale Repräsentationen. Die Kinder sind nicht mehr nur auf das Hier und Jetzt bezogen, sondern es entsteht langsam eine Repräsentation von Vergangenheit und Zukunft und die Vorstellungskraft nimmt zu. Nach wie vor sind bestimmte logische Operationen, z.B. Reversibilität, noch nicht möglich. In sozialer Hinsicht spricht Piaget von Egozentrismus, der auch noch bei Vorschulkindern herrsche. Kinder in diesem Alter seien noch nicht in der Lage, aus der Perspektive eines Dritten zu sehen (Myers 2014). Auch hier unterschätzte Piaget jedoch die kindlichen Fähigkeiten (s. Kapitel 2.6.1 :das Maxi-Paradigma).