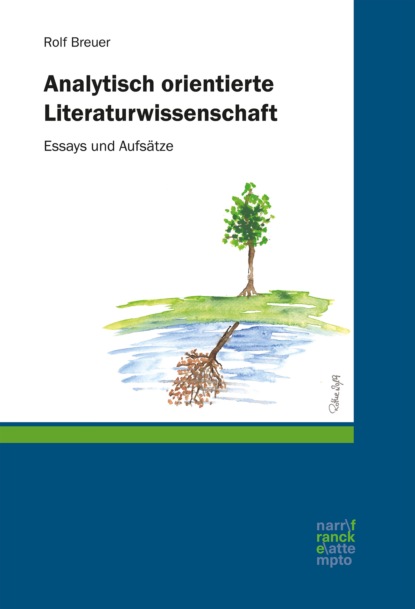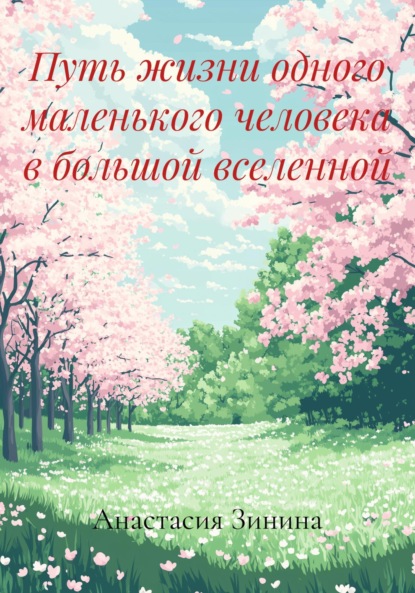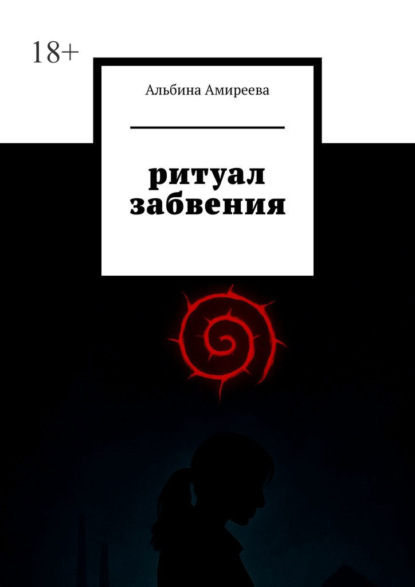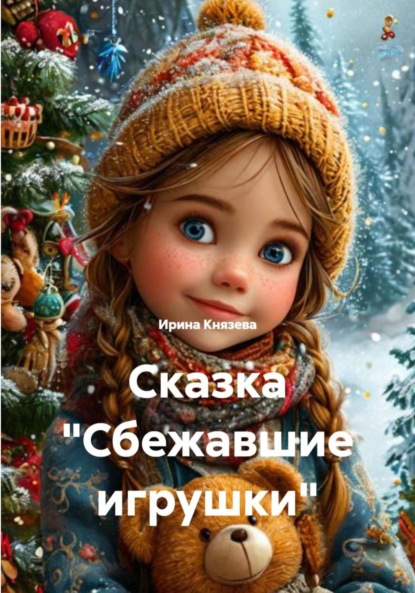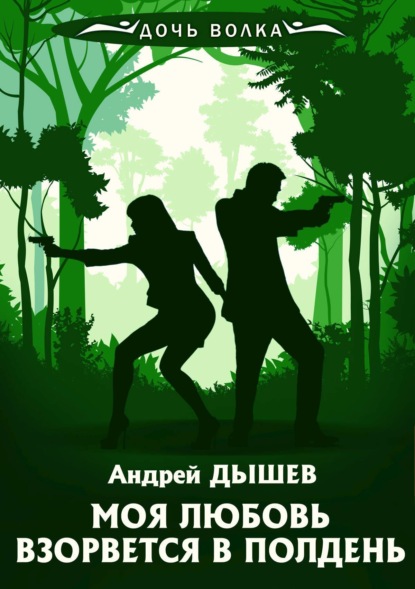- -
- 100%
- +
Bei Kunstwerken liegt die Sache etwas anders, allerdings nicht diametral entgegengesetzt. Und zwar liegt ein Unterschied darin, dass man bei den Werken, über die man spricht, offenbar davon ausgeht, dass es lohnt, sie dem Verschwinden im Abgrund der Zeit zu entreißen, weil sie unersetzlich sind, was so viel heißt wie: sie sind durch leichter zugängliche Werke der Gegenwart nicht zu ersetzen. Bei Alltagskommunikation trifft das fast nie zu. Wie soll man die unersetzlichen Werke der Literatur aber verständlich erhalten? Man kann nicht beim Autor nachfragen, was er meinte, und es wäre auch gar nicht sinnvoll, denn man ist nicht direkt von ihm angesprochen. Insofern hat der „Dekonstruktionismus“ recht, wenn er zeigen möchte, dass die Werke für die heutigen Leser oft eine andere Bedeutung haben als der Autor vermutlich beabsichtigte. Das ist sogar eine ganz alte Einsicht, denn die Verfahren der Literaturwissenschaft sind entwickelt worden, weil die Autorenintention oft nicht (mehr) eindeutig zutage liegt, das Werk also zum Problem geworden, andererseits interessant geblieben ist. Kunstwerke sind, gerade wenn sie interessant sind, reicher als der Autor wusste, und das gilt sogar bei Alltagskommunikation, wo ebenfalls jede Äußerung mehr sagt als gemeint ist. Nur darf das Fremde, das Unzugängliche, die Distanz eben gerade nicht eingeebnet werden, denn warum sollte ich Shakespeare lesen, wenn ich doch immer nur wieder mich selbst auffände? All die Hilfstätigkeiten und Hilfswissenschaften – Handschriftenkunde, Archivstudien, Kenntnisse der Periode, des Autors, der Gattungskonventionen usw. – ergäben keinen Sinn, wenn wirklich der Interpret oder auch nur kollektive Verstehenstraditionen die Bedeutung des Werks (ganz) erschüfen.
Ein weiteres Beispiel für die in bestimmten Kreisen so beliebte Einebnung der Distanz zwischen Subjekt und Objekt in der Literaturwissenschaft ist die Theorie, Literatur und Literaturtheorie beziehungsweise Literaturkritik hätten denselben ontologischen Status und seien ununterscheidbar. Auch diese These ist nicht ganz falsch. Angesichts einer humorlosen Abhandlung über den Witz oder einer trockenen Statistik über die Liebe unter Jugendlichen heute hat sicher schon mancher die Grenzen einer naturwissenschaftlich distanzierenden Geisteswissenschaft gespürt. In diesem Sinne sagte Friedrich Schlegel, Poesie könne nur durch Poesie kritisiert werden. Für das Verhältnis zwischen Beobachter und Welt ist die These (aus dem Neuplatonismus stammend) vielleicht am schönsten in Goethes Xenie ausgedrückt: „Wär’ nicht das Auge sonnenhaft, / Die Sonne könnt’ es nie erblicken“. Aber selbst ein philosophischer Laie erkennt schnell, dass das nur ziemlich vage stimmen kann. Augenhaft muss Goethes Auge auch gewesen sein, denn um die Aussage machen zu können, dass Augen sonnenhaft sind, um die Sonne erblicken zu können, musste er vorher Augen erblickt haben, was nach seiner Aussage nur gelingt, wenn sie – auch – augenhaft sind. Wie alles andere, was Augen sonst noch sehen können, müssten Augen aber auch sein. Man erkennt, dass die Aussage letztlich ziemlich nichtssagend ist. Tatsächlich ist es mit unseren Augen so, dass sie besonders gut in dem Bereich der elektromagnetischen Wellen sehen können, in dem die Sonne besonders intensiv abstrahlt. Unsere Augen sind entstanden unter dem jahrmillionenlangen Einfluss des Lichts der Sonne. Wenn man das auf das Verhältnis zwischen Sprache und besprochener Welt übertragen darf, so heißt es: Von der Objektsprache (Dichtung) muss ein Einfluss ausgehen auf die Beschreibungssprache (Literaturwissenschaft), sonst kann diese jener nicht gerecht werden. Aber die Beschreibungssprache braucht nicht zu werden wie die Objektsprache – sie darf es sogar nicht, denn die Sonne kann sich ja gerade nicht sehen (und sogar das Auge kann sich selbst nicht sehen). Und: Die Sonne ist das Primäre, das Auge das Sekundäre.
Nun wird in der Praxis meistens nicht so heiß gegessen wie in der Theorie gekocht. Noch habe ich keine Dissertation gesehen, die ich für einen Roman hätte halten können, auch wenn die Wissenschaftsprosa mancher neuerer Autoren nicht dem Ideal durchsichtiger Klärung von Sachverhalten folgt, sondern Eigenwert zu beanspruchen scheint. Aber ich habe immerhin schon eine Habilitationsschrift in der Hand gehabt, deren Verfasserin sich weigerte, in der Bibliographie zwischen Primär- und Sekundärliteratur zu unterscheiden, weil das nicht auf der Höhe der Theorie gewesen wäre, und das in einer Arbeit, die bisher vernachlässigte und in Vergessenheit geratene Romane erschließen will, wo also jeder Leser gerne auf einen Blick sehen würde, welche Romane denn da wiederentdeckt werden. Da die Theorie aber besagt, dass es keine Wahrheit gibt, Tarskis Differenzierung zwischen Objektsprache und Metasprache aber getroffen wurde, um Aussagen Wahrheit zusprechen zu können, ist es tatsächlich widerspruchsfrei, nicht zwischen logischen Ebenen zu unterscheiden. Da kann man dann nur sagen: Hat es auch Methode, so ist es doch Wahnsinn. Und man sieht, wie wichtig der Grundsatz der Fremdkontrolle ist, denn Auswüchse wie diese sind nur in einer Situation des Ingroup-Provinzialismus verstehbar.
Und wieder zeigt sich das Autoritäre der Theorie, Literatur und Literaturwissenschaft seien ununterscheidbar. Eine Studie, die durch ihren Stil verlangt, dass sich der Leser ganz auf sie einlassen muss, um sie nachvollziehen zu können – etwas, das das Kunstwerk verlangen darf –, will nicht durch Argumente einen freien Leser überzeugen, sondern durch imperiale Gesten beeindrucken. Der Ornithologe will fliegen.
Im Zusammenhang der Theorie, Literatur und Literaturwissenschaft seien untrennbar, wird auf Einwände hin gelegentlich geantwortet, die traditionelle Differenzierung zwischen den logischen Ebenen des Kommentierten und des Kommentars sei vielleicht bei traditioneller Literatur angebracht gewesen, etwa bei realistischen Romanen des vorigen Jahrhunderts, die ihrerseits von einer objektivistischen Konzeption der Wirklichkeit, vom Glauben an Wahrheit, vom Gedanken an die Trennung von Subjekt und Objekt usw. durchdrungen seien; sie sei aber auf jeden Fall unangebracht bei literarischen Werken, die selbst die Trennung von Subjekt und Objekt der Beschreibung in Frage stellen. Tatsächlich gibt es ja seit einigen Jahrzehnten, vor allem im angelsächsischen Sprachraum, eine umfangreiche Tradition von Erzählliteratur dieser Art. Meta-Literatur ist ein Beispiel, also Literatur, deren Gegenstand die Niederschrift des Werks selbst ist, etwa Becketts Malone stirbt. Sodann gibt es Romane, die wie Literaturkritik aussehen, etwa Julian Barnes’ Flauberts Papagei. Und schließlich gibt es eine Vielzahl fiktiver Autobiographien und Biographien, bei denen die Darstellung objektiv gegebener Realität und fiktionale Dichtung ineinander übergehen, früh schon Virginia Woolfs Orlando und kürzlich Robert Nyes Memoirs of Lord Byron oder Peter Ackroyds Chatterton. Solche Literatur kann in Beziehung gesetzt werden zu der zunehmenden Tendenz des allgegenwärtigen Mediums Fernsehen, die Trennung zwischen Realität und Fiktion verschwimmen zu lassen. Man denke nur an die stufenlose Linie vom traditionellen Spielfilm über den nachgestellten Kriminalfall bis hin zu Reality-TV und Kriegsberichterstattung aus dem Hotelfenster heraus, und das Ganze vielleicht noch dauernd von Werbespots und Videoclips unterbrochen, und man wird einsehen, dass die alte Differenzierung mit bloß zwei Kategorien (real oder fiktiv) zu grobschlächtig ist. Aber gerade wenn es für die Menschen de facto immer schwieriger wird zu unterscheiden, muss die begriffliche Differenzierung umso sorgfältiger sein. Bei zunehmender Brutalität an den Schulen sagt der Pädagoge ja auch nicht: Dann geben wir eben die Unterscheidung von Gewalt und Friedfertigkeit auf!
Natürlich muss das Handwerkszeug der Literaturwissenschaft, die Begrifflichkeit usw. angesichts neuer Gattungen und Gattungsmischungen geschärft und erweitert werden, aber deswegen müssen nicht etwa die Kategorien aufgeweicht werden. Einen Prozess der Aufweichung von Objekten kann ich gerade nur mit einer harten Sprache feststellen, einen geschichtlichen Entwicklungsprozess nur mit statischen Begriffen. Außerdem scheint die Theorie auch hier weiter zu sein als die Praxis. Die fernseherfahrenen Kinder der Gegenwart jedenfalls unterscheiden in ihren Reaktionen (zum Beispiel im Grad ihrer Angst) deutlich zwischen Realität und Fiktion auf dem Bildschirm. Schon Aristoteles baute seine Funktionsbestimmung der Tragödie darauf auf, dass der Zuschauer auf eine auf der Bühne gespielte Gewalttat anders reagiert als auf eine vor unseren Augen auf der Straße.
Es braucht den Theoretiker oder Interpreten auch nicht zu beirren, dass ein Autor wie beispielsweise Ackroyd offenbar selbst an die neuen Theorien glaubt, die er seinen Romanen zugrunde legt, und sie nicht etwa nur als Spielvorlage betrachtet. Wie man im Sommer 1993 in der Times lesen konnte, hält Ackroyd Einsteins Relativitätstheorie – ganz im Sinn poststrukturalistischer Wissenschaftssoziologie – für einen Mythos. Naturwissenschaftliche Theorien sind gewiss Modelle, aber deswegen noch keine Fiktionen im Sinne von Dichtungen. Und so hat auch trotz manch kühner allgemeiner Meta-Theorie noch kein Wissenschaftssoziologe ernstlich konkret gesagt, wieso das heliozentrische Weltbild oder die Theorie Harveys vom Blutkreislauf nur fiktionale Erzählungen sein sollen. Als Dichter darf Ackroyd das natürlich denken, und man kann ihn trotzdem schätzen, so wie man ja auch kein mittelalterlicher Katholik sein muss, um Dantes Göttliche Komödie zu bewundern, kein Anhänger der höfischen Liebe, um Chaucers Troilus und Criseyde zu lieben. (Allerdings darf man Dantes oder Chaucers Weltbild auch nicht absurd oder verächtlich finden, sonst wird einem die nötige Empathie fehlen.) Man könnte sogar argumentieren, dass Literatur gerade da ihre ureigenste Provinz hat, wo sie interessante Gedankenspiele vorführt, die in der Wirklichkeit unmöglich sind, sei es praktisch wie oben bei Borges, sei es logisch wie in Wells’ Zeitmaschine.
Einige Geschichtstheoretiker behaupten, Geschichtsschreibung sei Fiktion, habe denselben ontologischen Status wie Dichtung. So hat man im Gefolge von Hayden Whites Thesen argumentiert, dass es keine historischen Tatsachen gebe, sondern dass die Geschichtsschreibung die Tatsachen erschaffe. Der Historiker konstruiere Geschichte, ganz wie der Romancier, der seine literarische Welt im Schreiben entwirft.1 Tatsächlich geht der Historiker bei seiner Rekonstruktion der Geschichte von einem gewissen Vorverständnis aus, muss entscheiden, was (ihm) wichtig ist und was nicht, muss das Material ordnen, muss Kausalbeziehungen herstellen, dem Verlauf der Ereignisse Bedeutung geben, nicht im Sinn eines höheren Ziels, aber doch in dem Sinn, dass wir bei aller zwischenmenschlichen Kommunikation ständig interpretieren, wie uns das Handeln anderer betreffen mag, wie es aufzufassen ist, ob beispielsweise als Bedrohung, als Angeberei oder als gutgemeint. Der Historiker ist zwar ein Spezialist für bestimmte öffentliche Bereiche menschlichen Handelns, vor allem in der Vergangenheit, und er arbeitet seine Darstellung und Deutung genauer aus, geht methodischer vor, macht seine Vorannahmen transparent usw., aber prinzipiell verschieden von der alltäglichen Erklärungsarbeit des Menschen ist sein Tun nicht. So lautet die These der Subjektivisten im Grunde: Alle Denk- und Sprachtätigkeit der Menschen, ob Wissenschaft, Alltag oder Dichtung, ist ontologisch gleich.
Die Geschichtskonstruktionen oder -rekonstruktionen erfolgen durch Versprachlichung (daher die poststrukturalistische These, alles sei Sprache, alles sei Text), und zwar in Form von Erzählungen, womit die narrativen Verfahren ins Spiel kommen: Erzählstandpunkt, Metapher, Vergleich, Beispiel, Litotes usw. Da auch die Dichter so vorgehen (ihre Welt besteht nur aus der Sprache, die sie konstruiert), seien Geschichtsschreibung und Dichtung auch in diesem Sinne ontologisch gleich. Richtig ist zwar, dass in früherer, dem naturwissenschaftlichen Objektivitätsideal verpflichteter Geisteswissenschaft viele Historiker ernstlich glaubten, ihre Geschichtsschreibung stelle alles so dar, wie es wirklich gewesen sei. Und richtig ist, dass zum Beispiel Vorannahmen die Darstellung der „Tatsachen“ einfärben, sogar bestimmen können, etwa im Fall, dass jemand den Eindruck gewonnen hat, das Dritte Reich sei als Tragödie (für Deutschland) aufzufassen, das heißt, als schuldhaft-unverschuldetes Verhängnis, woraufhin er die ungeheure Fülle des Materials auf diese Vorannahme hin auswählen und interpretieren wird. Wenn aber in der bisherigen Theorie, der ich zuneige, zwischen fiktionalen und diskursiv-expositorischen Textsorten differenziert wird, dann nicht deshalb, weil die eine narrative Elemente enthielte und die andere nicht, denn in der Tat enthalten beide narrative Elemente; vielmehr differenziert man deshalb, weil fiktionale Texte zu anderen Fragen einladen als expositorische. Während man bei wissenschaftlichen und alltäglich-diskursiven Texten trotz der erzählerischen Elemente letztlich nach Informationsgehalt, Plausibilität und Wahrheit fragt, interessiert man sich bei fiktionalen Texten für die Kühnheit der Metaphern, für die rhetorische Brillanz, für magisch-rituelle Qualitäten wie Reim, Metrum und Rhythmus, für den architektonischen Bau, für die Übereinstimmung von Form und Inhalt usw.
In Molières Der Bürger als Edelmann erfährt der neureiche Monsieur Jourdain von seinem schmeichlerischen Rhetoriklehrer, dass er Prosa spricht, wenn er spricht, und ist freudig angetan von dieser Auszeichnung. Er kann aber natürlich gar nicht anders als Prosa sprechen, wenn er den Mund auftut, und so ist es auch mit den Historikern, mit uns allen: Wir sind noch keine Dichter, weil wir bei einer Dienstbesprechung oder einem Brief an die Versicherung narrative Verfahren benützen. Vornehmer ausgedrückt: Erzählstrukturen sind kein Differenzmerkmal zwischen geisteswissenschaftlicher Forschung und fiktionalen Texten; vielmehr ist Fiktionalität, zumindest zu einem erheblichen Teil, eine pragmatische Kategorie. Wir behandeln fiktionale Texte anders als diskursive, und man kann auch durchaus einen fiktional gemeinten Text (etwa einen historischen Roman) wie einen diskursiven behandeln und einen diskursiven (Gibbons Geschichte des Verfalls und Untergang des Römischen Reichs beispielsweise) wie einen fiktionalen.
Nun haben die Thesen der subjektivistischen Geschichtstheoretiker zwar viel Aufmerksamkeit erregt, sind aber von den Praktikern unter den Historikern ziemlich überwiegend ignoriert oder abgelehnt worden. Viele Literaturwissenschaftler jedoch haben die Auffassung, Geschichte sei nicht Rekonstruktion von Wirklichkeit, sondern vom Historiker konstruierter Text, begrüßt, und psychologisch kann man die Attraktivität der konstruktivistischen Theorien ja auch gut verstehen, würden sie doch die Literaturwissenschaft zur zentralen geisteswissenschaftlichen Disziplin machen. Tatsächlich aber können Menschen sehr gut unterscheiden zwischen Sinneseindrücken oder Erinnerungen an Sinneseindrücke auf der einen Seite und Phantasien oder Erinnerungen an Phantasien auf der anderen Seite. Vermutlich ist es ein Selektionsvorteil, wenn man das kann, und deshalb gibt es dazu auch einen Forschungszweig (Self-Awareness Studies, Reality Control Studies).
Aber von seiten vieler Romanciers und Dramatiker scheint es Schützenhilfe für die Poststrukturalisten zu geben. Der von manchen als faction bezeichnete, zwischen fiction und fact angesiedelte Roman beispielsweise ist oft als Indiz für die Auflösung der Differenz Kunst / Leben beziehungsweise der Textsorten Fiktion / expositorische Texte gedeutet worden. (Und auch in den anderen Künsten gibt es vergleichbare Tendenzen, von Warhol bis zu konkreter Musik.) Das Thema kann hier nicht ernstlich erörtert werden, aber so viel ist klar: Wenn sich die Objekte (in diesem Fall die Gattungen oder Textsorten) mischen, wenn sie vielleicht sogar zu etwas Neuem fusionieren, dann müssen sich deshalb keineswegs die Kategorien der Beschreibung mischen, dürfen es sogar nicht. Das wäre das Ende der analytischen Chemie, wenn sich, weil Wasserstoff und Sauerstoff eine Verbindung zu H2O eingehen, auch die chemischen Bezeichnungen zu etwas Neuem verbinden müssten. In der Kunst und natürlich auch im Spaß kann man das alles machen, aber das hat nichts mit ontologischen oder erkenntnistheoretischen Notwendigkeiten zu tun und braucht nicht, ja darf nicht auf die Literaturwissenschaft abfärben.
Sie ist eine Wissenschaft und muss insofern zu ihrem Gegenstand in einer gewissen kritischen Distanz mit analytischem Auflösevermögen verbleiben. Das Bekenntnis zu radikaler Subjektivität, die Annäherung der Geisteswissenschaften an die Künste, des Subjekts an das Objekt, führt zu Selbstgerechtigkeit, Kritikunfähigkeit und Narzissmus.
From Theories of Deviation to Theories of Fictionality: The Definition of Literature
This essay focuses on the various ways in which literature has been differentiated from non-literature. The criteria of differentiation show themselves to be quite heterogeneous, even incommensurable. Older – essentialist – theories, based on epic and lyric poetry, distinguished between poetic and non-poetic forms of language. Later – relational – theories, often based on the novel, have argued that it is the reference of language to reality that distinguishes fiction from non-fiction. Still more recent theories, accompanied by new forms of literature, see the difference in the eye of the beholder or, rather, reader – and this is a pragmatic criterion of differentiation. Since each perspective yields valuable insights, the question is how the three criteria – essentialist, relational and pragmatic – relate to one another.
1. Language and form as the distinguishing criterion of poetry
Until the 18th century, epic poetry and certain types of poems – ode, elegy, nature poetry – were the key genres of literature. A poet striving for honour and glory had to excel in these genres, in which Homer and Vergil were considered to be the greatest models, with Dante, Camões, Milton and others as the respective national examples.
These epic poems, odes, sonnets, and epistles differed from discursive texts – historiography, homilies, philosophical treatises, laws, or everyday speech etc. – in their use of language, namely in such deviations from everyday speech as verse, metre, rhyme, poetic diction with liberties in vocabulary (archaisms, for instance) and syntax (a freer order of words).
Such poetic text-types with their ritualistic and magical elements corresponded to the world-view of pre-modern times. In a magical conception of language, the speaker is understood to act upon the world in a direct way. Speaking of the devil may make him appear. Ritualistic language usage – as in litanies – points to the fact that sometimes it is not so much the information that counts, but rather the way in which the message is conveyed.
This is the original, and proper, province of literature, not only in text-types like charms that are expressly magical, but more generally in all forms of poetry with devices like alliteration and rhythm, metaphor and simile, invocation, burden etc. When more rational, critical conceptions of language superseded these older conceptions, poetry became the reserve of such ancient language usage. Imagery and all rhetorical and formal devices of more modern literary works of art became, as it were, the vanishing grade (“Schwundstufe”) of the former magical practices. As a consequence, poetry became the realm of speech where deviation from the norms of discursive speech is constitutive, and, again as a consequence, deviation from the norms of everyday and discursive usage of language became the decisive criterion of poetics.
2. The reference of language to reality and reader-expectation as the new criteria in defining fictional texts
The situation changed with the rise of the novel to the position of literary key genre, if only slowly because at first the new genre had no aesthetic prestige. (This paper will confine itself to prose narratives, but a similar case could be made for drama.) The novel came along like everyday speech, without rhetorical ornamentation and it claimed to be the depiction of real events. An arbitrarily chosen passage taken out of context could not be recognised as poetic, and it was not meant to.
The development from epic poem to prose novel is connected with the rise of the bourgeoisie to the position of the economically and, later, politically dominant social class. Concomitant with this political and social revolution was a change in values: from a heroic and aristocratic ideal of life to an unheroic and bourgeois lifestyle, from an emphasis on the public sphere to an emphasis on privacy, from a cyclical conception of time to a conception of time as linear and with an open future, from an oral culture to a civilisation based mainly on writing and reading, and, in this process, the conception of language and speech changed dramatically, roughly speaking: from poetry to prose.
The rise of the natural sciences played an important role, too. The elimination of God and teleology from the understanding of nature in physics, geology, biology etc. was accompanied by a purification of the language of the natural sciences. Nature was no longer regarded as a book, the meaning of which had to be interpreted, but was taken as pure facticity without meaning. The importance of the subject of perception and cognition was, accordingly, reduced, first-person sentences were given up in favour of passive constructions, finite verb-forms given up in favour of nominal constructions; all of this stresses the results rather than the research. Furthermore, rhetorical devices like metaphors, irony, hyperbole etc. are avoided and literal expressions are favoured in order not to draw the reader’s attention to the writer and not to give a chance to a subjective colouring of data, argumentation and conclusions. (The fear is that in being forced to accept the language of a researcher, one is forced to accept ideas that make sense only in the idosyncratic mode of speaking of the writer.) Two other famous attempts to purify language of being affected by the object discussed is the introduction of distinctions between logical planes by Bertrand Russell and between semantic planes by Alfred Tarski; according to these distinctions, a statement may not refer at the same time to the facts of the case and to its own truth value. (An example is the ancient Liar Paradox, where a statement is made about a Cretan and, at the same time, about the truth value of the statement itself.) Thus, the language of science attempts, as much as possible, and in direct opposition to the language of poetry, to avoid the subjective colouring of results. It also, and more generally, denies any direct association with the objects discussed, because, if there were an iconic connexion between object and language, the definition of the object, the collection of data, the results of the argumentation would be influenced by the language used; language might even construe the problem which it then must clarify. (At this point, I will not discuss the question of whether this programme is fully possible.)
The rise of the novel belongs to this context. If the language of poetry can be defined by deviation from the norm of everyday speech and discursive statements, then linguistic non-deviation from the norm is equivalent to non-poetry, and the novel, therefore, appears as a discursive text, particularly close to the genre of historiography. Whoever wanted to present a story as history had to forego deviations of language, style, and form. Thus, the modern (realistic) novel belongs to the great movement of disenchantment of the world in Western civilisation since the Renaissance.
Defoe’s Robinson Crusoe, often called the first modern novel, presents itself as the unadorned autobiographical report of a castaway; Goethe’s epistolary novel, Die Leiden des jungen Werthers, presents itself as the authentic collection of letters between two lovers and their circle of friends. Single passages here and elsewhere in novels cannot be recognised as part of a work of art – with exceptions, it must be admitted: Fielding’s narrator in Tom Jones reveals himself as the creator and legislator of the world of his hero and, thus, reveals the novel as a novel; the grammar of Jane Austen’s passages of free indirect style is clearly not in the way of everyday speech. (The genre of the romance is a different matter: Gothic Novel, Science Fiction, Fantasy etc. are in another literary tradition than the novel.)