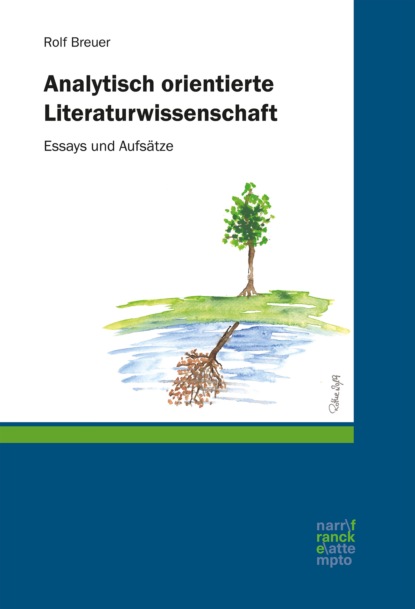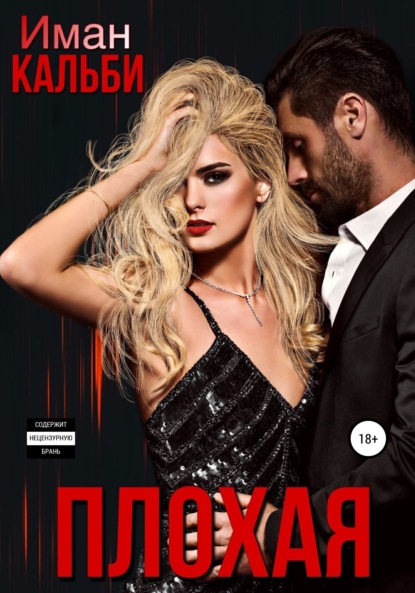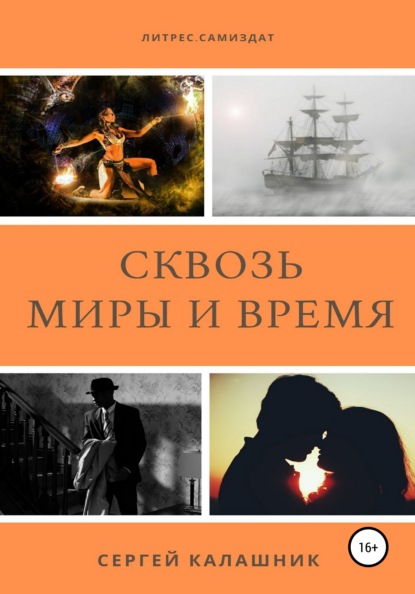- -
- 100%
- +
fell upon the entrance of the night preceding the twenty third day of Octob. in the year of the Julian Calendar, 710,16
also auf 6 Uhr abends am 22.10.4004 v. Chr.
Das änderte sich um dieselbe Zeit, in der Hurd, Rousseau und die anderen bereits genannten Autoren schrieben. Georges Buffon (1707-88) setzte 1749 in seiner Théorie de la Terre das Alter der Erde erstmals dramatisch höher an. Die von ihm öffentlich genannte Zahl von 70.000 Jahren war allerdings immer noch geleitet von religiöser Rücksichtnahme; privat gab Buffon zu, dass auch diese Zahl noch viel zu niedrig angesetzt sei. Endlich, bereits im 19. Jahrhundert, gelangte die Geologie zu Vorstellungen, wie wir sie heute von der Erdgeschichte haben. Der Name, der hier in erster Linie genannt werden muss, ist Charles Lyell (1797-1875), Schotte und mit mehreren Büchern um die Mitte des 19. Jahrhunderts Begründer der modernen Geologie. Er revolutionierte die Ideen über das Alter der Erde, indem er die alten Katastrophen-Szenarien (Neptunismus oder Vulkanismus) ersetzte durch die Vorstellung eines allmählichen Entwicklungsprozesses,17 übrigens zum Teil bereits beeinflusst von Darwins Origin of Species.
Parallel verlief die Entwicklung der Kosmologie. Der erste, der Zeitspannen in Betracht zog, die der Wirklichkeit nahekamen, war Immanuel Kant (1724-1804). In seiner Allgemeinen Naturgeschichte und Theorie des Himmels … (1755) beschrieb er die gesamte Naturordnung nicht als etwas zur Zeit der Schöpfung Vollendetes, sondern als etwas, das noch immer im Entstehen begriffen sei. Diese allmähliche Bildung der Ordnung aus dem Chaos brauchte ganz offensichtlich bisher unvorstellbare Zeiträume, und Kant spricht denn auch von Hunderten von Millionen Jahren. Allerdings blieb seine Schrift bis ins 19. Jahrhundert fast unbeachtet, und vieles war tatsächlich eher Spekulation als gesicherte Erkenntnis und gehört insofern zur Vorgeschichte der wissenschaftlichen Kosmologie. Gleichwohl ist Kants Buch von erstaunlicher Kühnheit und prophetischer Weitsicht. Er erkannte, dass viele bisher als Sterne oder Nebel angesehene Objekte am nächtlichen Himmel vielleicht keine Sterne innerhalb der gerade erst18 als Galaxie erkannten Milchstraße sind, sondern selbst Galaxien, nur sehr weit entfernt.
5. Die Entdeckung der Geschichtlichkeit der Sprachen (Friedrich Schlegel, Franz Bopp, Jacob Grimm)
Die Sprachwissenschaft ist eine weitere Disziplin, die in dem Zeitraum zwischen der Mitte des 18. und der Mitte des 19. Jahrhunderts die Geschichtlichkeit ihres Gegenstands erkannte, nämlich die der menschlichen Sprache, die vorher als unwandelbar gegolten hatte. (Man erinnere sich an die verschiedenen Experimente um herauszufinden, welche Sprache Adam und Eva im Paradies gesprochen hatten, und dabei ging man selbstverständlich davon aus, dass das eine bekannte Sprache sein müsse, vielleicht Hebräisch.)
Genauer betrachtet lassen sich bei der Entwicklung der Sprachwissenschaft zwei große Richtungen unterscheiden, die damals entstanden: eine mehr sprachphilosophische, die zur allgemeinen Sprachwissenschaft führt und die uns hier nicht interessiert, sowie eine sprachhistorische, die zu den Einzeldisziplinen Germanistik, Romanistik usw. führt.19 Diese eigentliche Sprachwissenschaft – die erste institutionalisierte Sprachwissenschaft im modernen Sinn der Wortes Wissenschaft überhaupt – ist diachronisch ausgerichtet. Nach einigen Anfängen im 18. Jahrhundert20 beginnt diese vergleichende und historische Sprachwissenschaft mit Friedrich Schlegel (1772-1829), Franz Bopp (1791-1867) sowie Jacob Grimm (1785-1863) und ihren berühmten einschlägigen Werken aus den Anfangsjahren des 19. Jahrhunderts.21 Das Ziel dieser Sprachwissenschaft ist die Erforschung genetischer Sprachverwandtschaften. Den Sprachwissenschaftlern fiel auf, wie ähnlich sich die grundlegenden Wörter in bestimmten Sprachen sind: beispielsweise drei oder ist oder Bruder. Noch wichtiger sind jedoch die Übereinstimmungen der grammatischen Strukturen.
Als Ergebnis zahlreicher Detailstudien wurde deutlich, dass die meisten zwischen Island und Indien gesprochenen Sprachen „verwandt“ sind, zu einer großen „Sprachfamilie“ gehören. Diese Sprachengruppe nannte man Indogermanisch oder Indoeuropäisch. Ihre Verwandtschaft ergibt sich aus der weitgehenden Übereinstimmung in der gesamten formalen Struktur, d.h. in der Flexion der Nomina und Verba, in der Wortbildung, im Wortschatz, im Lautstand und in der Syntax. Da die Ähnlichkeiten der Sprachen immer größer werden, je weiter man im Vergleich zurückgeht, nahm man an, dass es eine gemeinsame Ursprache gegeben habe, das Urindogermanische. Heute nimmt man an, dass die Indogermanen ursprünglich in Mitteleuropa oder in Osteuropa lokalisiert waren und sich im 4. Jahrtausend von dort ausbreiteten.
Nun sind die Ausdrücke verwandt und Sprachfamilie allerdings nur metaphorisch zu verstehen, denn natürlich kann eine Sprache nicht eigentlich von einer anderen „abstammen“, da sie ja nichts Konkretes und unabhängig von den Sprechenden Bestehendes ist. „Verwandte Sprachen sind in Wirklichkeit ein und dieselbe Sprache, die im Laufe der Zeiten im Munde der Sprechenden vielfach verändert wurde.“22 Im Grunde also erkannte man, dass Sprachen sich verändern, historische Gebilde sind, auch wenn sich bei weiteren Forschungen zeigte, dass die Entwicklung komplizierter verlief als man zuerst glaubte.
6. Die Entdeckung gesellschaftlichen Wandels: Die Historiographie
Der eine oder andere wird sich vielleicht gefragt haben, wo denn die Geschichtsschreibung selbst bleibt, die historische Disziplin par excellence, hier verstanden als die Wissenschaft von der Geschichte der menschlichen Gesellschaft (eingeschlossen Politik, Krieg, Kultur). Tatsächlich begann die Entdeckung der Geschichtlichkeit der Welt nicht auf dem Felde der menschlichen Gesellschaft. Bis in die Anfänge des 19. Jahrhunderts hinein war man sich weitgehend nicht klar, „welch tiefe Spuren die Zeit im menschlichen Leben und Wirken hinterlassen hatte.“23 Vor allem aber entnahmen frühere Geschichtstheorien – etwa die christliche Auffassung von der Heilsgeschichte – ihre Kategorien zum Verständnis der Zeitläufe nicht diesen selbst. Geschichte ist aber nicht verständlich aus dem Studium der Bibel, sondern nur aus ihr selbst: und diese reflexive Formulierung ist beabsichtigt, denn, wie die Doppeldeutigkeit des Wortes Geschichte anzeigt, ist Geschichte sowohl Geschehen wie auch Beschreibung (und damit Verstehen) des Geschehens.
Als Vorläufer einer solchen von historischem Bewusstsein getragenen Geschichtsphilosophie ist Giambattista Vico (1668-1744) zu nennen. Und dann muss Herder mit seinen vier Bänden Ideen zur Philospohie der Geschichte der Menschheit (1784-91) erwähnt werden; hier wird zum ersten Mal versucht, Naturgeschichte und Menschheitsgeschichte zusammen zu sehen, womit eine Tradition begründet wird, die dann von Georg Wilhelm Friedrich Hegel (1770-1831), Auguste Comte (1798-1857) und Karl Marx (1818-83) fortgeführt wurde. Ihre Sicht der Geschichte war jedoch noch weitgehend theologisch: säkularisierter Rest der christlichen Idee der Heilsgeschichte. Erst die moderne „bürgerliche“ Geschichtswissenschaft seit Leopold von Ranke (1795-1886) und seiner Geschichte der germanischen und romanischen Völker von 1494 bis 1535 (1824) glaubt nicht länger, den Gang der Geschichte, ihre Richtung zu kennen, und schreibt Geschichte nicht mehr im Sinne eines solchen Vor-Urteils (wenn auch Ranke als konservativ eingestellter Katholik glaubte, dass es in Gott einen Sinn gebe, nur eben uns unerkennbar.)
7. Die Einführung der Zeit in die Physik: Die Thermodynamik
Auf diese Art war um die Mitte des 19. Jahrhunderts geschichtliches Denken in viele Wissenschaften eingedrungen. Eine große Ausnahme jedoch gab es und zwar diejenige Wissenschaft, die die fortgeschrittenste war und das Modell für Wissenschaftlichkeit abgab: die Physik. Und es ist auch schwer einzusehen, wie die Wissenschaft von den beobachtbaren Naturvorgängen und ihren Gesetzmäßigkeiten historisiert sollte werden können, läuft doch der Begriff der Gesetzmäßigkeit auf zeitlose Gültigkeit hinaus. Zwar hat sich auch in der Physik vieles, das einst als unwandelbar galt – etwa das Molekül –, als der Veränderung unterworfen herausgestellt, aber der Kernbereich – die Naturgesetze – eben nicht.
Ihre bis dahin höchste Ausprägung hatte die Physik in der klassischen Mechanik von Isaac Newton (1643-1727) gefunden, dem System der Naturbeschreibung auf der Basis der Gravitationskräfte. Nach dieser Auffassung ist die Welt eine Maschine, und daher spricht man von „mechanistischem“ Denken. Die Zukunft ist durch die Gegenwart bzw. jeden beliebigen Moment der Vergangenheit determiniert. Die klassische Mechanik ist zwar nicht „statisch“, denn sie untersucht ja nicht zuletzt die Bewegungen von Körpern unter dem Einfluss von Gravitationskräften, aber in dieser sogenannten klassischen „Dynamik“ ist die Zeit lediglich ein geometrischer Parameter. Vergangenheit und Zukunft spielen ein und dieselbe Rolle. Insofern kennt dieses Weltbild keine qualitativen und keine unvorhersehbaren Veränderungen, kein echtes ,Werdenʻ.
Das änderte sich mit der Formulierung des Zweiten Hauptsatzes der Thermodynamik, der den Begriff der Evolution in die Physik einführte.24 Dieser Zweite Hauptsatz wurde 1850 von Rudolf Clausius (1822-88) aufgestellt. Die Fassung, die für die Zwecke dieser Argumentation am besten geeignet ist, besagt, dass Wärme von selbst nur von höherer zu niederer Temperatur übergeht. Man kann den Zweiten Hauptsatz auch den Satz von der Vermehrung der Entropie nennen; er besagt dann, „daß bei einem in einem abgeschlossenen System ablaufenden natürlichen (irreversiblen) Prozeß Zustände wachsender Wahrscheinlichkeit durchlaufen werden, bis der Prozeß schließlich im Gleichgewicht, dem Zustand maximaler Wahrscheinlichkeit, endet.“25
Das bedeutet, dass einige Gesetze der Thermodynamik nicht symmetrisch gegenüber Zeitumkehr sind. Zukunft und Vergangenheit spielen verschiedene Rollen. Das Naturgeschehen hat einen Zeitsinn. Bringt man beispielsweise zwei Körper mit verschiedenen Temperaturen in enge Berührung, so stellt sich nach einer bestimmten Zeit ein thermisches Gleichgewicht her; das Umgekehrte hat man noch nie beobachtet. Wenn eine Porzellantasse auf den Küchenboden fällt, zerbricht sie – jedenfalls meistens; das Umgekehrte, dass sich nämlich ein Scherbenhaufen spontan zu einer Tasse zusammenfügt, hat man noch nie beobachtet. Man spricht hier von „irreversiblen Prozessen“, und der Zweite Hauptsatz der Thermodynamik drückt die Tatsache aus, dass irreversible Prozesse eine Richtung der Zeit einführen. Und ohne die Richtung der Zeit einzuführen, kann man keine Prozesse, die eine Entwicklung einschließen, auf nicht-triviale Weise beschreiben. Damit erhalten die Phänomene der unbelebten Natur eine geschichtliche Dimension, erhält der Begriff der Entwicklung einen Sinn auch in der Welt von Masse und Energie.
8. Der Weg zu Darwins Abstammungslehre (Carl von Linné, Johann Wolfgang von Goethe, Erasmus Darwin, Jean-Baptiste de Lamarck, Charles Darwin)
Ansätze zu einem geschichtlichen Denken in der Biologie gibt es seit alters her, aber stets nur als unsystematische Ahnungen. Normalerweise ging man von der Konstanz der Arten aus, und dieses statische Denken in der Biologie feierte im Zeitalter der Aufklärung gerade noch einmal einen großen Triumph, und zwar im Werk Carl von Linnés (1707-78),26 dem wir das System der Benennung der Pflanzen und Tiere und überhaupt die Systematisierung der Vielfalt der Lebewesen verdanken, eine Taxonomie, die von der Unveränderlichkeit der Arten ausgeht.27
Dann aber setzte sich immer unabweisbarer der Gedanke durch, dass auch die Lebewesen geschichtlich geworden sind, wie der Kosmos und die Erde. Goethes Idee der „Ur-Pflanze“28 gehört hierhin, betrifft allerdings eher die Veränderungen beim Wachstum der einzelnen Pflanzenart, ähnlich wie Rousseaus Denken die Entwicklung des einzelnen Menschen vom Säugling über das Kind zum Erwachsenen. Auch Erasmus Darwins (1731-1802) Zoonomia or the Laws of Organic Life (1794-96) ist zu erwähnen,29 worin bereits vieles angedeutet ist, was der berühmte Enkel dann, auf breite Datenbasis gestützt, zu einer systematischen Theorie ausführen sollte.
Der erste, der eine echte – wenn auch falsche – Evolutionstheorie aufstellte, war Jean-Baptiste de Lamarck (1744-1829). Seine Philosophie zoologique von 1809 – zu ihrer Zeit übrigens fast gänzlich ignoriert – leitet die Historisierung der Natur ein.30 Lamarcks Evolutionstheorie ist jedoch keine Deszendenztheorie;31 vielmehr findet nach Lamarck die spontane Urzeugung von Leben aus unbelebter Materie immer wieder statt, und diejenigen Arten, deren Urzeugung am längsten zurückliegt, entfalten sich zu den höchsten Individuen. In dieser Sicht ist der Mensch die älteste Spezies; die Würmer etwa gehören zu den jüngsten Arten, was man daran erkennt, dass sie noch nicht Zeit genug hatten, sich weiterzuentwickeln!
Eine echte Deszendenztheorie – und damit die Vollendung der Historisierung der belebten Natur – ist dann die Evolutionstheorie von Charles Darwin (1809-1882), vorgelegt in dem Werk On the Origin of Species by Means of Natural Selection …, 1859 publiziert, aber schon seit 1837 in den Grundgedanken konzipiert.32 Mit dieser Deszendenztheorie, die hier nicht vorgestellt zu werden braucht, ist die Biologie – auch – eine historische Wissenschaft.
Mit Darwins Evolutionstheorie ist der Höhepunkt der Historisierung der Welt und ihrer Phänomene zwischen circa 1760 und 1860 erreicht – Höhepunkt insofern, als diese Theorie von allen Historisierungen die größten Auswirkungen auf das Weltbild der Menschen hatte. Deswegen kam sie ja auch relativ spät: sie steht dem Wortlaut der Heiligen Schrift entgegen; sie machte die Annahme eines Schöpfergottes unnötig oder verschob den Schöpfungsakt mindestens in den fast unendlich weit entfernten Moment des Urknalls; mit anderen Worten: Sie eliminiert die Teleologie aus den Naturwissenschaften, also die These, dass alles auf ein Ziel hin – von Gott – eingerichtet sei; und sie nimmt dem Menschen seine besondere Stellung im Reich des Lebendigen. So nannte Sigmund Freud Darwins Abstammungslehre eine der großen „Kränkungen“ des Menschen durch wissenschaftliche Erkenntnis in den Jahrhunderten seit Beginn der Neuzeit: Er ist nur mehr ein hochentwickeltes Tier.33
Конец ознакомительного фрагмента.
Текст предоставлен ООО «ЛитРес».
Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на ЛитРес.
Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.