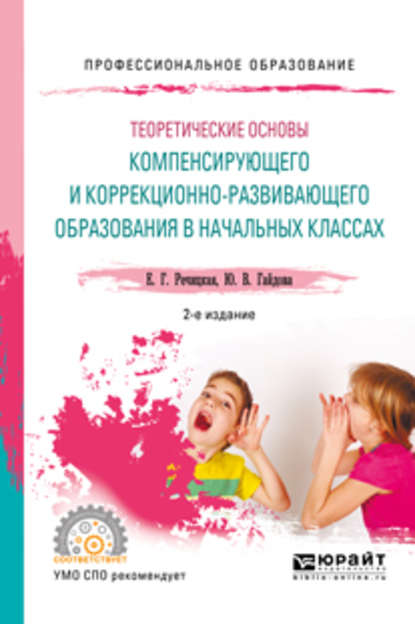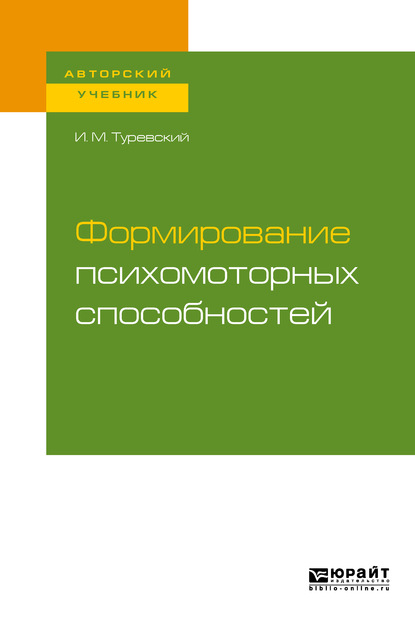- -
- 100%
- +
Rudolf und Gisela waren bleich und wirkten müde.
Latour erhob sich. »Wenn ich vorschlagen dürfte, die Hoheiten gleich in ihre Zimmer zu bringen. Ruhe wäre fürs Erste das Beste.«
Elisabeth nickte zustimmend. Sie winkte die Kinder zu sich, breitete die Arme aus und drückte die beiden zum Abschied kurz und zart. Danach verließen sie mit Latour den Raum.
Elisabeth blickte eine Weile auf die geschlossene Tür und drehte sich dann wieder zum Schreibtisch. Dort lag der angefangene Brief. Sie hatte gehofft, die Zeilen an ihre Schwester Helene würden ihr helfen, mit der Schwermut des heutigen Tages besser zurecht zu kommen. Neun Jahre, dachte Elisabeth. Neun Jahre ist es nun schon her. Und die Trauer wird nicht leichter.
Es klopfte und der Diener brachte auf einem Tablett drei Gläser Limonade. Nachdem er gegangen war, zerriss sie den Brief und ließ die Stücke auf dem Tisch liegen. Was sie nun brauchte, war Bewegung und frische Luft. Gerne hätte Elisabeth mit Ida über alles gesprochen, aber ihre Vertraute würde erst später am Nachmittag ins Schloss zurückkehren. Sie war noch unterwegs, um schöne Leichen zu besorgen.
Elisabeth wollte ihr Appartement nicht durch das Gardezimmer verlassen. Schon oft hatte sich ihre Idee als nützlich erwiesen, eine Wendeltreppe einbauen zu lassen, die das Schreibzimmer mit ihrem Gartenappartement im Erdgeschoss verband. Unbemerkt konnte sie auf diesem Weg das Schloss verlassen.
»Komm, Houseguard«, sagte Elisabeth und klatschte in die Hände. Mit einer Hand hielt sie die Schleppe des Kleides hoch, die andere lag auf dem Geländer. Die Mode der weiten Röcke machte das Treppensteigen nicht gerade einfach. »Wir machen einen Spaziergang!«, rief sie dem Wolfshund zu.
Latour würde sie finden, wenn er sich um die Kinder gekümmert hatte, um ihr von den Ereignissen zu berichten. Hier aber wollte sie nicht bleiben.
Houseguard zögerte. Elisabeth wusste, dass ihm die offenen Stufen unheimlich waren. Die Aussicht auf den Spaziergang war aber verlockend. Einen Augenblick später hörte sie seine Krallen auf dem Metall der Treppe kratzen.


Der schlichte Ziegelbau, vor dem Ida stand, erinnerte an eine Fabrik. Neben der Tür hing ein blank poliertes Messingschild. Ida studierte die Inschrift. Sie hatte gefunden, was sie suchte. Aber was nun? Sie betrachtete nachdenklich die lange Metallstange mit Griff, die zur Türglocke gehörte.
Ida zögerte. Sie konnte unter keinen Umständen einfach anläuten und nach schönen Leichen verlangen. Schon gar nicht so, wie sie aussah. Ihre feine Kleidung und der Sonnenschirm, den sie auf der Schulter trug, verrieten, dass sie nicht aus dieser Gegend war. Bevor sie ihren Wunsch vortrug, wollte sie Amalie Buback erst einmal kennenlernen und prüfen. Die Frau musste verschwiegen sein. Sie könnte herausfinden, in wessen Auftrag Ida unterwegs war. Unter allen Umständen musste sie Tratsch über Elisabeths Wunsch nach schönen Leichen vermeiden.
Schließlich gab sich Ida einen Ruck und zog am Griff. Drinnen hörte sie eine Glocke schellen. Erwartungsvoll blickte sie zur Tür. Niemand öffnete. Nach einer Minute klingelte sie erneut und schließlich ein drittes Mal. Aber niemand kam.
Was sollte sie tun? Der Fiaker, der sie von Schönbrunn nach St. Marx gebracht hatte, wartete an der Ecke. Der Kutscher lehnte beim Vorderrad und hatte die Arme verschränkt. Er starrte nicht in ihre Richtung, aber Ida war sicher, er beobachtete sie aus den Augenwinkeln. Sie hatte den ganzen Weg vergeblich gemacht.
Ein Bursche kam die Straße heruntergelaufen. Er hielt mit der Hand seine Kappe auf dem Kopf, damit sie nicht herunterfiel. Das einfache, weite Hemd und die etwas zu kurzen Hosen ließen vermuten, dass er ein Handwerker war.
Vor Ida blieb der Bursche stehen. »Wollen Sie zu ihr?« Er deutete mit dem Kopf auf die Tür.
»Ich möchte mit Amalie Buback sprechen«, erwiderte Ida.
»Sie ist auf dem Friedhof.«
»Auf dem Friedhof? Nicht in ihrem Atelier?«
»Wir haben einen, der sich erschossen hat und gleich eingegraben wird. Ich muss die größere Kamera bringen. Was weiß ich, wieso. Sie ist da immer sehr heikel.« Er steckte den Schlüssel ins Schloss und sperrte auf. »Sie können drinnen warten, wenn Sie fotografiert werden wollen.«
»Es geht nicht um ein Foto von mir, sondern…« Ida brach ab und fuhr nach einer kleinen Pause fort. »Ich muss persönlich mit Amalie Buback sprechen. Daher möchte ich, dass Sie mich zu ihr führen.«
Wieder zuckte der Bursche mit der Schulter. »Ich hole die andere Kamera.« Er verschwand im Haus.
Durch die offene Tür sah Ida in einen großen, hellen Raum. Licht flutete durch die hohen Fenster und das verglaste Dach. Verschiedene Sitzmöbel standen herum. Bei einem Stuhl ragte eine Stange aus der Lehne, an deren Ende sich eine halbrunde Halterung befand.
Ida hatte so etwas schon einmal gesehen. Wer sich fotografieren ließ, konnte dort seinen Kopf einspannen lassen, um ihn ruhig zu halten.
Aus einem Nebenraum brachte der Bursche die hölzerne Kamera auf einem Stativ. Schwarzer Stoff hing von ihr herab. »Ich hab’s eilig«, sagte er. Nachdem er abgesperrt hatte, lief er die Straße hinauf.
Ida konnte kaum mit ihm Schritt halten. Das lange Kleid war eindeutig ungeeignet für diesen Ausflug.


Elisabeth hatte nicht vor, ziellos im Schlosspark herumzuwandern. Mit schnellen Schritten ging sie hinter dem Schloss Richtung Obeliskenallee. Als sie und ihr Hund die ersten Bäume der Allee erreichten, schnupperte Houseguard an den Stämmen und hob bei jedem das Bein.
Von der Seite des Schlosses, an der ihr Gartenappartement lag, kam ein Mann in einem unauffälligen grauen Anzug. Er trug einen Hut und hielt den Kopf gesenkt.
»Flott«, trieb sie den Wolfshund an. »Es gibt auch oben Bäume.«
Houseguard löste sich ungern von der interessanten Duftmarke und kam ihr nach. Elisabeths Vorsprung wuchs, weil sie mehr lief als ging.
Die Kaiserin war auf Latours Bericht gespannt. Sie konnte sich noch immer nicht vorstellen, was genau geschehen war. Allerdings zweifelte sie nicht daran, in Latour einen verlässlichen Erzieher gefunden zu haben.
Elisabeth hatte Josef Latour während ihres zweijährigen Aufenthalts auf Madeira kennen und schätzen gelernt. Er war mehrmals als Gesandter des Kaisers zu ihr gekommen. Seine Aufgabe war es, die Briefe des Kaisers zu überbringen und die Rechnungen einzusammeln, die während des Aufenthalts von Elisabeth und ihrem fast hundertköpfigen Hofstaat angefallen waren.
Der Landsitz Quinta Vigia war von ihr gemietet worden, weil sie den Blumengarten liebte, der ihn umgab. Außerdem hatte sie von der Terrasse den schönsten Blick auf das Meer. Elisabeth hielt sich mehrere Hunde und in einer Voliere bunte Papageien. Sie fühlte sich wie damals in ihrer Kindheit auf Schloss Possenhofen in Bayern.
Mit Latour saß sie meistens im Freien und genoss die milde Seeluft Madeiras. Ihr Arzt meinte, sie würde eine heilende Wirkung auf Elisabeths angegriffene Lunge haben.
Verschämt hatte Latour einmal erwähnt, dass die milde Wärme Madeiras für ihn in den Wintermonaten eine willkommene Abwechslung zur Kälte in Wien war. Er berichtete bei jedem Besuch von Neuigkeiten aus der Hauptstadt des Reiches. Die meiste Zeit redete er vom Kaiser und den Kindern. Obwohl er es nie aussprach, verstand Elisabeth, dass sie nicht nur ihr Mann, sondern auch der Hof und die Menschen des Landes vermissten.
Im Laufe der Zeit besserte sich nicht nur ihre Gesundheit, vor allem fühlte sich Elisabeth sicherer und stärker.
Aus dem Spiegel in ihrem Ankleidezimmer blickte ihr nicht länger Sisi entgegen, das süße Mädchen, in das der Kaiser so verliebt war, über das aber seine Mutter Sophie, sein Bruder Ludwig Viktor und viele andere bei Hof den Kopf schüttelten. Sie war kein Kind mehr, das sich von ihnen belehren oder erziehen ließ, wie es in den ersten Jahren ihrer Ehe mit Franz Joseph geschehen war.
Aus Sisi war Kaiserin Elisabeth geworden, eine erwachsene Frau von einzigartiger Schönheit. Auf ihren Spaziergängen in der Hauptstadt Madeiras, Funchal, hatte sie die bewundernden Blicke der Menschen gespürt. Ihre Hofdamen berichteten, dass Elisabeths Anmut Gesprächsthema auf der ganzen Insel war.
Die Unterhaltungen mit Josef Latour hatten zu Elisabeths neuem Selbstbewusstsein beigetragen. Sie redete mit ihm über Poesie, Philosophie und die Kunst der alten Griechen. Elisabeth spürte seinen Respekt für ihre Bildung.
Sie begriff, dass er zwischen dem Kaiser, dem Hof und ihr vermitteln wollte. Er achtete dabei ihre Zurückhaltung und zeigte, wenn auch auf stille Weise, Verständnis. Besonders hoch rechnete sie ihm an, dass er sie mit keiner Silbe zur Rückkehr mahnte. Latour erwähnte höchstens die Spekulationen der Presse über ihre Abwesenheit, die zuerst Monate, nun aber schon zwei ganze Jahre andauerte.
Das leise Bellen ihres Hundes holte Elisabeth in die Gegenwart zurück. Sie sah sich nach Houseguard um und bemerkte dabei fünfzig Schritte hinter sich den Mann im grauen Anzug. Er blickte zu Boden und schlenderte zur Seite hinter den Stamm einer hohen Kastanie. Elisabeth verdrehte die Augen.
Für wie dumm hielten sie ihre Bewacher eigentlich?
Der Wolfshund erschien hechelnd neben ihr. Nebeneinander schritten sie auf das Ziel von Elisabeths Spaziergang zu: die kleine Gloriette.


Ida hatte schon einige Male vom St. Marxer Friedhof gehört, den sie nun betrat. Der Bursche stapfte durch ein Gittertor. Ohne sich ein einziges Mal umzudrehen, lief er durch eine lange Allee. Die Bäume trugen das zartgrüne Laub des späten Frühlings. Flieder und andere blühende Büsche nahmen dem Ort etwas von der Traurigkeit, die hier zu fühlen war.
Wege zweigten nach links und rechts ab. An beiden Seiten waren Gräber und Grüfte angelegt.
Ida wollte dem Burschen schon zurufen, ein wenig langsamer zu gehen, als er von allein stehen blieb. Er deutete auf eine Grabstätte. Ein steinerner Engel lehnte an einem Sockel, auf dem eine Säule stand. Das obere Ende war bewusst so gestaltet, dass die Säule wirkte, als wäre sie in der Mitte abgebrochen.
W. A. MOZART
1756 - 1791
»Mehr ist auch von ihm nicht übriggeblieben«, sagte der Bursche mit Spott in der Stimme.
Ida wollte einwerfen, dass Mozarts Musik unsterblich war, kam aber nicht dazu. Der Bursche war schon weiter. Er bog nach links ab und Ida hörte eine Frau rufen.
»Peter, na endlich.«
Als Ida in den Nebenweg trat, blieb sie mit einem Ruck stehen und bekreuzigte sich hastig.
Auf zwei einfachen Holzblöcken stand ein offener Sarg aus dunkler Eiche. Der Deckel lag daneben im Gras. Am Grab stützten sich zwei kräftige Männer in dreckigen Hosen auf ihre Schaufeln. Gelangweilt verfolgten sie, was die Frau tat. Es musste die Photographin Amalie Buback sein. Sie hatte ihr rotblondes Haar unter die gleiche Kappe gestopft, wie sie auch der Bursche trug. Ein paar Strähnen hingen schlampig bis zu ihren Schultern herab.
»Sie sucht dich«, erklärte der Bursche und zeigte auf Ida.
»Kommen Sie morgen wieder.«
Nie zuvor war Ida so respektlos angesprochen worden. Was bildete sich diese Photographin ein? Die knielangen Hosen und ihre grüne Jacke waren Männerkleidung und passten weder zu einer Frau noch auf den Friedhof. Wo blieb die Ehre für die Verstorbenen? Idas Entrüstung wuchs.
Peter stellte die Kamera neben dem Ende des Sarges auf, wo sich der Kopf des Toten befand.
Es war nicht der erste Tote, den Ida sah. Auf dem Anwesen ihrer Eltern in Ungarn hatte es mehrere Todesfälle gegeben. Die Neugier hatte die kleine Ida damals in die Kammer schleichen lassen, in der die Toten aufgebahrt wurden. Der Anblick hatte seinen Schrecken verloren.
Um zu beweisen, dass sie sich nicht einfach so fortschicken ließ, trat Ida zwei Schritte näher. Bisher war ihr der Blick auf den Toten nicht möglich gewesen. Was sie nun sah, ließ sie die Hand vor den Mund schlagen.
Der Mann im Sarg musste ungefähr in ihrem Alter sein. An seiner Schläfe klaffte eine Wunde, die Ränder dunkel und von Blut verkrustet. Jemand hatte mit fleischfarbener Schminke darüber gemalt, was die schreckliche Tatsache nicht verbergen konnte, dass an dieser Stelle eine Revolverkugel eingedrungen war.
Amalie fotografierte von der anderen Seite.
»Der Mund… drück ihn ein wenig nach oben, Peter!«, verlangte Amalie. Ohne Zögern trat Peter zu der Leiche und bearbeitete die Mundwinkel mit den Fingern.
»Das reicht.« Amalie verschwand unter dem schwarzen Tuch. »Abnehmen!«, rief sie.
Peter zog den Deckel vom Objektiv. Laut zählte die Photographin bis zehn. Dann setzte Peter den Deckel wieder auf.
Amalie kam unter dem Tuch hervor. »Noch zwei. Eines wird sicher gelungen sein.« Sie verschob die Kamera leicht zur Seite.
Die Totengräber murrten.
»Ihr könnt ihn gleich eingraben«, versprach Amalie. Sie zog etwas aus der Hose. Die Männer streckten sofort die Hände aus und sie ließ Münzen hineinfallen. Schnell verschwand das Geld in den Hosentaschen der Totengräber.
Noch immer wartete Ida neben einem Fliederbusch. Der Duft der letzten Blüten hatte eine beruhigende Wirkung auf sie.
»Fertig.« Amalie klatschte in die Hände. »Du bringst alles ins Atelier, Peter.« Sie ging los und blieb vor Ida stehen.
»Wollen Sie ein Foto? Kind? Heirat? Oder geht es um einen Verstorbenen?«
Amalie musste Idas Überraschung bemerkt haben, denn sie setzte hinzu: »Das sind die drei häufigsten Gründe, wieso sich Menschen fotografieren lassen.« Mit einem Blick auf Idas Kleidung fügte sie hinzu: »Einfache Leute, die nicht so viel Geld haben.«
Ida sah über Amalies Schulter zum Sarg, dem die Totengräber den Deckel aufsetzten.
»Schulden sollen der Grund gewesen sein. Spielschulden«, erklärte die Photographin. »Der junge Mann hat keinen anderen Ausweg gefunden. Der Vater ist nicht einmal zum Begräbnis erschienen. Die Mutter war allein. Der Priester hat sich geweigert, den Sohn einzusegnen, da er den Freitod gewählt hat. Von mir wünschte sie sich eine letzte Erinnerung an den Sohn. Ihr Mann darf davon nichts wissen.«
»Sie machen das oft, nicht wahr? Fotos von Toten?«, sagte Ida.
»Deshalb liegt mein Atelier neben einem Friedhof.«
»Man hat Sie mir als Photographin von Toten empfohlen«, fuhr Ida fort.
»Was kann ich also für Sie tun?«
»Zuerst muss ich Sie um absolute Diskretion bitten.«
»Sehe ich wie eine Klatschbase aus?«
Ida kam ins Stammeln. »Nein, nein.«
»Na also.« Amalie ging flott.
Da Ida Spaziergänge mit Elisabeth gewohnt war, fiel es ihr nicht schwer, mit der Photographin Schritt zu halten.
»Wieso sind Sie hergekommen?«, wollte Amalie wissen.
»Es geht um Fotos schöner Leichen, die jemand erwerben möchte.«
Die Photographin blieb stehen und sah Ida amüsiert an. »Sollen die Fotos schön sein oder die Leichen?«
»Beide.«
»Damit kann ich dienen.«
Ida war erleichtert, dass Amalie vorerst nicht fragte, für wen die Fotos sein sollten.
Nachdem sie in das Atelier zurückgekehrt waren, vereinbarte Ida mit Amalie den Preis für die Fotos und den Ort der Übergabe. Sie achtete darauf, dass er weit genug von Schloss Schönbrunn entfernt lag, damit Amalie Buback keinen Verdacht schöpfte.
Sie sah zwar nicht aus wie eine Klatschbase, aber die Kaiserin von Österreich war auch keine normale Kundin.


Elisabeth liebte die kleine Gloriette. Hier konnte sie den Menschen entfliehen, die im Park spazieren durften. Der Zutritt zum Pavillon war nur ihr gestattet und selbst im Hochsommer blieb der Innenraum angenehm kühl. Sie saß an einem kleinen weißen Tisch, der die Form eines Seerosenblattes hatte. Die Sitzfläche der beiden Stühle war ebenso gestaltet. Jedes Mal, wenn sie sich hier zurückzog, bewunderte sie die kunstvollen Wandgemälde und das rosafarbene Marmorbecken an der Wand, aus dem ständig Wasser plätscherte.
»Majestät?«
»Latour, treten Sie ein.«
»Der Gardist bei Ihrem Appartement hat mir gesagt, Sie wären hier.«
»Mein Schicksal ist es, auf Schritt und Tritt beobachtet zu werden.« Sie deutete Latour, Platz zu nehmen. »In diesem Fall ist es ausnahmsweise ein Glück. Wie geht es Gisela und Rudolf?«
»Giselas Aja hat beide zu Bett gebracht. Ich werde später noch einmal nach ihnen schauen.« Latour rang noch ein wenig nach Luft. »Verzeihen Sie, Majestät, aber der Weg herauf ist recht steil.«
Houseguard kratzte an der Tür. Latour stand auf, um ihm zu öffnen. Der riesige Wolfshund ließ sich zu Füßen seiner Herrin auf den Boden sinken. Er seufzte tief und legte den Kopf zwischen die Pfoten.
»Nun erzählen Sie«, verlangte Elisabeth. Ihre Betroffenheit wurde immer größer, je länger Latour sprach.
»Dieses Leid«, sagte Elisabeth leise, nachdem der Lehrer geendet hatte. »Die arme Familie. Ich werde ihnen eine Unterstützung in dieser schweren Zeit zukommen lassen.«
»Ich habe dem Naturkundelehrer den morgigen Tag frei gegeben.«
»Das ist gut so.« Elisabeth seufzte tief und faltete die Hände im Schoß. Als sie aufsah, bemerkte sie Latours besorgte Miene. Sie neigte fragend den Kopf.
»Majestät, ich hoffe, Sie haben nicht den Eindruck, ich hätte meine Kompetenz überschritten.«
»Ich finde diese Art des Lernens ausgezeichnet. Der fürchterliche Vorfall war von niemandem vorherzusehen.« Elisabeth sah die Erleichterung in Latours Gesicht. Sie seufzte. »Der 29. Mai ist also nicht nur für mich ein Trauertag.«
Eine Pause entstand.
»Es war genau heute, am 29. Mai, vor neun Jahren«, sagte Elisabeth, ohne den Oberst anzusehen, »als meine erste Tochter Sophie auf einer Reise durch Ungarn Fieber bekam. Kurz darauf starb sie. Sie war zwei Jahre alt.« Leise fügte sie hinzu: »Ich mache mir bis heute Vorwürfe deswegen.«
»Majestät…« Latour suchte nach Worten.
Elisabeth hob die Hand. »Es gibt keinen Trost. Nur Trauer, mit der man zu leben lernt.«
Sie erhob sich. Houseguard war sofort auf den Beinen. Latour öffnete ihr die Tür und Elisabeth verließ die kleine Gloriette. Während sie ihren Sonnenschirm aufspannte, fragte die Kaiserin: »Ich will Anweisung geben, dass die Familie des Imkers eine Unterstützung erhält. Wie ist der Name?«
»Habe ich das nicht erwähnt?«, fragte Latour zerstreut. »Der Imker hieß Oberland. Alfred Oberland. Er hat in der Hofbibliothek gearbeitet und den Kronprinzen in Musik unterrichtet. Und manchmal«, Latours Stimme wurde leiser, als er sich erinnerte, »spielte er für die kaiserlichen Hoheiten auf der Geige.«


Als Elisabeth in ihr Appartement zurückkehrte, war das Abendessen vorbei. Sie war froh, keine Ausrede erfinden zu müssen, wieso sie am Essen nicht hatte teilnehmen können. Die Waage hatte am Morgen knapp 52 Kilogramm gezeigt und das war für Elisabeth entschieden zu viel. Ein Fastentag würde ihr guttun.
Sie begab sich in das Ankleidezimmer, wo sie bereits von den Kleiderzofen erwartet wurde. Es waren schüchterne Mädchen, die unter Anleitung einer älteren Zofe beim Auskleiden halfen. Eine Zofe hielt den seidenen Hausmantel der Kaiserin bereit und Elisabeth schlüpfte hinein. Es war angenehm, den kühlen Stoff auf der Haut zu spüren.
Im Toilettezimmer wartete Fanny Feifalik auf sie. Fanny knickste, als Elisabeth eintrat, und rückte ihr den Stuhl vor dem Spiegel zurecht.
»Ich kann es heute kaum erwarten, meine Augen zu schließen«, sagte Elisabeth. Sie nahm wahr, wie Fanny nickte und die Lippen zusammenpresste. Am Morgen hatte sie noch ein paar tröstende Worte verloren, doch Elisabeth hatte ihr befohlen, zu schweigen.
»Ida?«, rief sie. Sie war gewohnt, dass ihre Hofdame immer in der Nähe war. Aber Ida kam nicht. Sie konnte sich doch nicht schon zurückgezogen haben? Elisabeth fiel ein, dass Ida einen Photographen hatte aufsuchen wollen, um ihr Bilder von Verstorbenen zu besorgen. So reizvoll sie die Idee am Vortag gefunden hatte, so wenig gefiel sie ihr heute.
Mit geschulten Händen löste die Friseuse die kunstvoll hochgesteckte Frisur der Kaiserin, bis die Haare offen fast bis zum Boden fielen. Behutsam glättete sie das Haar mit einer Bürste.
»Reich mir mein Album, Fanny«, verlangte Elisabeth.
»Wo kann ich es finden, Majestät?«
»Es liegt wohl in meinem Gartensalon auf dem Tisch.«
Fanny unterbrach das Bürsten und ging nach unten. Doch sie brachte jenes Album, das Elisabeth für die schönen Leichen vorgesehen hatte.
Elisabeth reagierte gereizt. »Nein, das andere. Das volle Album.«
Fanny entschuldigte sich und eilte davon. Mit einem dicken, in Leder gebundenem Buch kehrte sie wieder. Elisabeth legte es sich auf die Knie und begann darin zu blättern. Es war eine Sammlung von Photografien verschiedener Frauen, die in ihren Augen Schönheiten waren. Sie hatte den Auftrag gegeben, dass alle Botschafter aus den verschiedenen Ländern Lichtbilder der schönsten Frauen senden sollten.
Pauline Metternich, die Frau des österreichischen Botschafters in Paris, hatte Elisabeth jedoch Fotos von Frauen der Halbwelt geschickt. Elisabeth und »Mauline Petternich«, wie die Kaiserin sie gerne nannte, konnten sich nicht ausstehen. Die Frau des Botschafters lebte nach dem Motto: Tue Gutes und rede darüber. Elisabeth empfand das als geschmacklos.
»Sie dachte wohl, ich merke das nicht«, sagte Elisabeth zu Fanny, während sie durch die Seiten blätterte. »Aber einige dieser Frauen sind wahre Schönheiten. Die Metternich sollte sich an ihnen ein Beispiel nehmen.«
Fanny unterdrückte ein Lachen. Die Prozedur des Bürstens nahm einige Zeit in Anspruch. Elisabeth gähnte und wollte zu Bett gehen. Im Toilettezimmer ließ sie sich die Zahnbürste reichen, auf die aus einem Tiegel schon ein Klecks Zahncreme aufgetragen worden war.
Nach dem Zähneputzen begab sich Elisabeth in das eheliche Schlafzimmer. Eine Zofe nahm ihr den Morgenmantel ab, unter dem sie nackt war. Nachdem sie sich hingelegt hatte, arrangierte die andere Zofe ihr Haar rund um ihren Kopf auf dem Laken. Kopfkissen gab es keines, da es Falten im Gesicht verursachen konnte.
Auf den Bauch ließ sich Elisabeth ein nasses Laken legen. Die Kälte sollte helfen, die schlanke Taille zu bewahren. Zum Abschluss öffneten die Zofen die Fenster und ließen die Nachtluft in das Zimmer. Zwei Kerzen auf einem Tisch in der Ecke spendeten ein wenig Licht.
Franz Joseph, mit Nachthemd und langen Unterhosen bekleidet, schlüpfte auf seiner Seite des Bettes unter die Decke und wünschte Elisabeth eine gute Nacht.
Das Ehepaar lag nebeneinander im Doppelbett. Nah und doch so weit voneinander entfernt, dachte Elisabeth. Statt der Freiheit, nach der sich Elisabeth so sehr sehnte, kannte ihr Mann bloß die eiserne Pflicht, mit der er sein Weltreich regierte. In diesem riesigen Imperium war Platz für Millionen von Menschen, und doch kam ihr vor, als gäbe es keinen Platz für sie. Elisabeth drehte den Kopf zu Franz Joseph, der auf dem Rücken lag und die Augen geschlossen hatte.