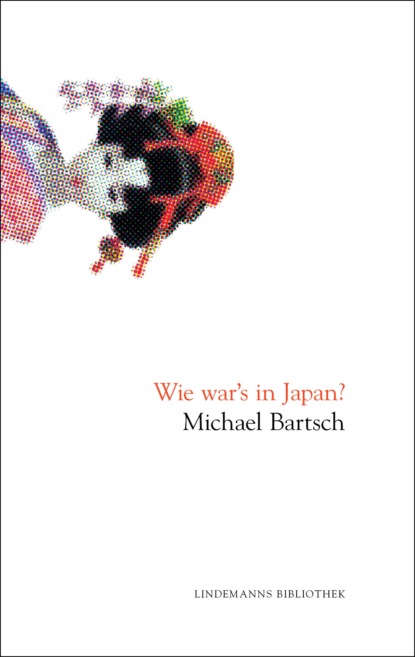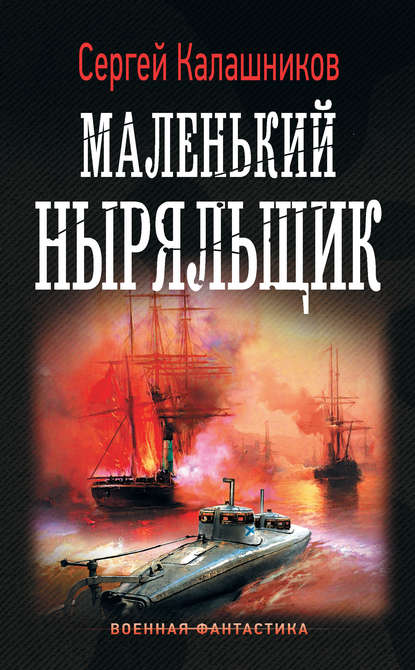Unklare Verhältnisse
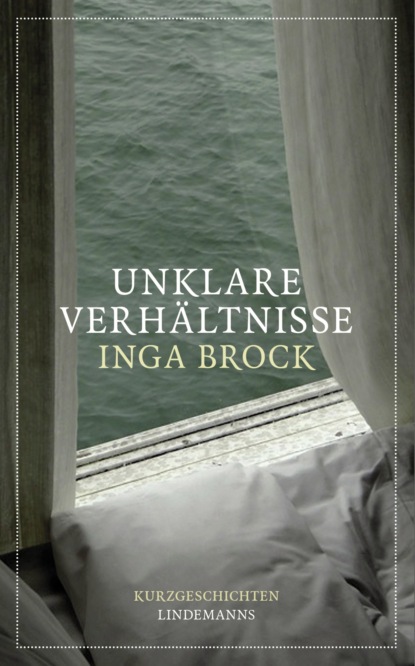
- -
- 100%
- +
Er heißt Friedrich Laubenstein. Ein schöner Name, finde ich jedenfalls.“
Sein erster Brief kam zu Weihnachten. Er war sechs Seiten lang und in grüner Tinte geschrieben. Die Oma weinte, während sie ihn las. Noch nie hatte jemand für sie einen derart liebevollen und besorgten Ton angeschlagen. Und wie lange war es her, dass sich jemand für sie, nur für sie, so viel Zeit genommen hatte? Am Ende des Briefes stand ein Heine-Zitat: „Herz, mein Herz, sei nicht beklommen,/ Und ertrage Dein Geschick./ Neuer Frühling gibt zurück,/ Was der Winter Dir genommen.“
Wer, bitte schön, hätte sich da nicht verliebt?
Friedrich Laubenstein ist fünfzehn Jahre jünger als die Oma. Er ist vermögend und Besitzer einer Kunststofffabrik im Karlsruher Rheinhafen, die er nun endlich auflösen möchte.
Den ersten Brief der Oma erhielt er noch im alten Jahr; geschrieben in einer Mischung aus ergebener Dankbarkeit und freudiger Erwartung, altmodisch mit topaktuellem Inhalt.
Die Oma schlief nur noch sehr wenig. Wenn überhaupt, dann nur mithilfe ihres Radios, das Schlager spielte, Operetten, bekannte Opern, und tagsüber Glückwünsche übermittelte.
„Alles könnte man mir nehmen, nur die Musik, die nicht.“
Morgens erwachte sie voller Hoffnung und Freude darauf, ihn genau an diesem Tag wiederzusehen. Denn natürlich hatte sie ihn eingeladen, schon weil es sich so gehörte. Gut möglich, dass er sich bei ihr melden würde oder auf einen spontanen Besuch vorbeikäme. Heute. Oder schon bald.
Sie ließ sich neue Dauerwellen machen, bestellte sich beim Baur-Versand zwei neue Blusen und zog sich die Augenbrauen fast bis zum silbrig weißen Haaransatz nach, bis an die Oberkante ihrer erstaunlich kleinen Ohren. Die Schwiegertochter verdrehte entsetzt die Augen, als sie das einmal sah. Sie hätte die Oma auf keinen Fall ermutigt, wenn sie von Friedrich Laubenstein gewusst hätte.
Auf den Tag genau sechs lange Wochen wartete die Oma, bis endlich Antwort von ihm kam. Was ihr dabei am meisten half, war die Tatsache, dass lange Briefe Zeit brauchen.
Dieses Mal schrieb er mehr Persönliches. Dass er Kohelet verehre, einen Propheten des Alten Testaments, dessen Namen sich die Oma aber nie merken konnte; wie wichtig ihm sein Glaube sei, dass er jeden Sonntag in die Kirche gehe und: dass das Leben zuweilen traurig sein konnte. Das verstand die Oma.
Auch deshalb hatte sie das letzte Mal eine Kirche betreten, als der Opa gestorben war. Dem Kirchengott hatte sie nie verzeihen können.
Friedrich Laubenstein beschrieb mit grünen nach rechts geneigten und sehr schwungvollen Worten, wie schön Baden-Baden im Frühling sei. Ob er vielleicht auf einen gemeinsamen Spaziergang entlang der Oos hoffen dürfe?
„Intellektuell bin ich ihm natürlich nicht gewachsen“, sagte die Oma glücklich, „wirklich, ich glaube, er ist mir haushoch überlegen.“
Wo die Liebe hinfällt, dachte sie und träumte.
Beide Briefe liegen auf dem Nachttisch der Oma, und jeden Abend und in jeder Nacht, die seitdem vergeht, liest sie darin, obwohl sie sie längst auswendig kennt. Sie weint viel und wartet. Manchmal wird sie wütend, aber nur ein bisschen.
Einmal hat sie bei ihm angerufen. Sie suchte im Telefonbuch nach seiner Privatnummer, trank ein Gläschen Topinambur und lauschte auf das Tuten im Hörer. Eine Frau nahm ab, und sie sagte, dass sie gern Herrn Laubenstein sprechen würde. Die Frau bat sie, einen Moment zu warten. Dann hörte sie seine Stimme im Hintergrund.
„Ich rufe morgen zurück.“
Was er nicht tat.
„Bestimmt hatte er Damenbesuch.“ Entrüstung.
Manchmal malt sich die Oma aus, wie sie sich eines Tages unverhofft auf der Straße treffen und begrüßen, als habe ihnen und ihrer Liebe die ganze Welt bis dahin riesige Steine in den Weg gelegt. Oder wie sie sich in einem Café gegenübersitzen und sich anschauen ohne zu reden, ganz selbstverständlich und völlig unbefangen.
„Für so was musste ich fünfundachtzig werden“, sagt sie weinend, für so viel Liebe und so viel Schmerz. Das Briefpapier ist schon ganz brüchig vom vielen Zusammenfalten. Die Oma musste die Stellen mit Tesafilm verstärken. Der Gang zum Briefkasten ist einer der Höhepunkte ihres Tages, obwohl ihre Schritte immer schwerer werden.
Jetzt ist sie wieder gestürzt und hat sich die linke Hand gebrochen und den Unterarm. Aber erschöpft war sie schon zuvor. Und sehr viel krummer und meistens ganz still.
Die Enkeltochter hat etwas herausgefunden.
„Du, er ist verheiratet“, sagt Svenja vorsichtig und schiebt der Oma das Schälchen mit den Salzletten zu.
„Habe ich mir gedacht“, sagt sie und hört sich gleichzeitig tapfer und mitgenommen an. Die Enkeltochter weiß beim besten Willen nicht, ob die Oma sie tatsächlich richtig verstanden hat.
Das hier ist für Mark
Mir wäre es lieber gewesen, ich hätte alles erzählen können und irgendwer hätte ein Diktiergerät mitlaufen lassen. Es hätte mir jede Menge Arbeit und Nerverei erspart, aber man hat mir gesagt, dem Gutachter sei es lieber so. Also bitte. Außer rumsitzen, das stimmt schon, kann ich ja sowieso nichts mehr machen. Jetzt fange ich an:
Ich bin in einem kleinen Kaff im Schwarzwald geboren. Es heißt Marschalkenzimmern. Es lohnt sich nicht, dort hinzufahren, allenfalls durchzufahren, denn die Landschaft ist schön und wohl das, was Städter unter idyllisch verstehen. Im Sommer blühen schier endlose Rapsfelder und fast immer weht ein leichter, angenehmer Wind, der die Gräser zum Wogen bringt. Am Straßenrand wechseln sich Kruzifixe mit kleinen Holzkreuzen und Grablichtern ab, die einen Andreas, Mike oder Axel unvergessen machen wollen.
Der Ort selbst ist winzig und unterscheidet sich in fast nichts von all den anderen kleinen Käffern, die Brachfeld heißen, Hopfau oder Niederdornstetten. Es gibt immerhin keine typischen Ramschläden mit Kuckucksuhren, Bollenhutpüppchen und Wurzelholzschund, aber auch keinen Supermarkt, keine Schule, keinen Arzt, nur ein paar Bauernhöfe, eine Kirche und eine Wirtschaft, die „Zur Linde“ heißt und meinen Eltern gehört. Ich danke Gott jeden Tag, dass ich nicht mehr dort leben muss.
Die „Linde“ liegt an der Hauptstraße, die weiter nach Dornhan führt. Dort bin ich zur Schule gegangen. Eine beschissene Schule mit beschissenen Lehrern und beschissenen Mitschülern. Dass aus mir schließlich doch noch was geworden ist, habe ich nur mir selber und Gott zu verdanken. Das weiß ich genau.
Glauben und Gott, das ist sehr wichtig für mich. Ich habe schon als kleines Mädchen in der Bibel gelesen wie andere in ihren Hanni-und-Nanni-Büchern oder in „Blitz, der schwarze Hengst“. Vielleicht weil es bei uns außer der alten Hausbibel meiner Großeltern und den Lesezirkelheftchen, die in der Gaststätte auslagen, nicht viel zu lesen gab. Ich kann heute noch ganze Passagen auswendig, aber ich verschone Sie lieber, keine Angst. Dass so was nicht besonders gut ankommt, habe ich schnell gemerkt. Meine Eltern könnten Ihnen da bestimmt auch etwas dazu sagen, wenn sie noch wollten (obwohl ich sagen muss, dass sich immer mehr Menschen, vor allem junge, wieder Gott zuwenden. Ist doch so, oder?).
Ich hatte jedenfalls schon immer das sichere Gefühl, dass Gott gut auf mich aufpasst und der einzige ist, der mir zuhört und mich WIRKLICH versteht. Er ist auch jetzt bei mir und hat mich schon so oft getröstet, dass ich ihm ewig dafür dankbar sein werde.
Seit ich etwa vier Jahre alt war, gehe ich regelmäßig in die Kirche. Allein. Da fand auch noch nie jemand etwas dabei. Meinen Eltern war es nur recht, da mussten sie sich schon nicht mit mir abgeben. Was für andere ein Geheimversteck auf dem Dachboden oder ein besonders verwunschenes Fleckchen im Wald war, das war für mich die St.-Nikolas-Kirche. Ich spielte dort, malte dort, träumte, weinte, summte, lachte, lauschte, hoffte. Ich gehörte bald ebenso zum Inventar wie die Haushälterin des Pfarrers, die sich um die Kerzen, Pflanzen, Gesangsbücher und den Opferstock zu kümmern hatte, der stumme Organist und der Pfarrer selbst. Ein lieber Mensch übrigens. Keiner von den Päderastentypen, darauf brauchen Sie sich gar nicht erst einzuschießen.
Ich war schon immer anders. Meine Mutter wollte mir meine schweren Haare manchmal zu Zöpfen flechten, aber das habe ich nie zugelassen. Ich weigerte mich auch regelmäßig Kniestrümpfe anzuziehen, wenn es draußen warm war, oder Ohrenschützer aufzusetzen, wenn es kalt war. Ich fing an zu schreien, wenn meine Mutter mir Malzbier vorsetzte, weil sie Angst hatte, ich würde ewig zu dünn bleiben. Ich wurde stocksteif, wenn sie versuchte, mich in den Arm zu nehmen, was selten genug geschah (Achtung, Gutachter, es lag an MIR, nicht an ihr), und ich ignorierte ihre Bitten, ich solle doch pünktlich zum Essen heimkommen und meine Zahnspange regelmäßig tragen. Sie hatte mir nichts zu sagen: Mit Ach und Krach den Hauptschulabschluss geschafft und dann immer nur Bier gezapft und dem Alten die Hausschuhe hinterhergetragen. Sie konnte mich mal.
Er selber war auch nicht viel besser, fast immer hielt er sich aber aus allem raus. Schlauer war er schon. Nur schlagen hätte er mich nicht dürfen, auch wenn in der Bibel darüber was anderes steht. Schlagen, das war seine Aufgabe, wenn sie nicht mehr weiterkam. Meine Mutter stand dann dabei und kuckte zu. Gefreut wird sie sich haben.
Ich bin mit sechzehn zu einer Schwester meines Vaters nach Freudenstadt gekommen und habe dort mein Abitur gemacht. Im gleichen Jahr fing ich an, Chemie zu studieren. Hört sich nicht sonderlich spannend an, es liegt mir aber. Jetzt hab ich einen Assistentinnenjob an der Uni Karlsruhe und nicht übermäßig viel zu tun. Man darf nicht faul sein, ich weiß, und ich bin es auch nicht. Ich brauche nur viel Zeit für andere Dinge.
Ich sehe gut aus. Ich bin groß, aber nicht zu sehr, schlank, habe lange schwarze Haare, große Brüste und einen festen, kleinen Hintern. Ein „Männertyp“, gar keine Frage. Im Labor läuft ihnen regelmäßig der Sabber runter. Eklig, aber ich weiß mich zu wehren.
Bevor Sie sich jetzt fragen, ob ich eventuell noch Jungfrau sein könnte, und alles auf meine verklemmte Sexualität schieben wollen: Nein, ich bin keine Jungfrau mehr. Ich wurde auch nie vergewaltigt oder habe andere fürchterliche Erlebnisse in dieser Richtung hinter mir. Zum ersten Mal Sex hatte ich mit einem Jungen aus dem Nachbarhaus, als ich siebzehn war. Ich glaube, er hieß Frieder. Es war schmerzhaft und irgendwie enttäuschend, ansonsten aber nicht weiter der Rede wert. Und es ist auch nicht so, dass ich als „alte Bibeltreue“ eine lustfeindliche Einstellung oder noch nie etwas von Selbstbefriedigung gehört hätte. Vergessen Sie’s also.
Geahnt habe ich schon immer, dass irgendwo einer ist und auf mich wartet, einer, der es wert ist, der mich erkennen kann und ich ihn, auch im biblischen Sinn.
Es war an einem dieser wunderbaren Abende, an denen man merkt, dass der Frühling es bald geschafft hat: Die Vögel sind wieder da und zwitschern laut, Grünes zeigt sich an Bäumen und Sträuchern, das Licht wird weicher, die Leute schauen freundlicher und sind es auch, man kriegt Lust auf Sommer und Eis und Flugzeuge, die am Himmel brummen, und kleine Kinder, die auf Wiesen Fangen spielen. All so was eben. Ich war auf dem Weg von der Uni nach Hause und hatte es nicht eilig. Ich hatte es eigentlich nie eilig (es war, bis zu diesem Zeitpunkt, ja nie einer da, der auf mich gewartet hätte). Vor mir schob eine kleine dralle Frau einen Zwillingskinderwagen. Sie blieb so plötzlich stehen, dass ich ihr nur noch mit einem Satz zur Seite ausweichen konnte. Wir mussten beide lachen, sie entschuldigte sich und wir kamen miteinander ins Gespräch. Sie erzählte mir aufgeregt, dass ihr gerade schlagartig eingefallen sei, dass sie beim Einkaufen das Allerwichtigste vergessen hätte: die Milch für die Kinder. Ich fragte sie, ob es weit sei bis zum Laden, und sie erklärte mir, dass das nicht das Problem sei. Sie könne die Kinder aber unmöglich vor dem Supermarkt stehen lassen, bei all den Irren, die heutzutage herumliefen. Guter Witz! Also müsse sie die Kinder mit hineinnehmen, das sei aber deswegen ungünstig, weil sie endlich mal schliefen.
Liebe deinen Nächsten wie dich selbst! Ich bot ihr an, sie zu begleiten und vor dem Supermarkt auf die Zwillinge aufzupassen. Sie machte so ein Aufheben um mein Angebot, das könne sie doch nicht annehmen, das sei ja unglaublich lieb von mir, das gehe aber doch wirklich nicht und so weiter. Ich bereute schon meinen spontanen Gutmensch-Entschluss und war kurz davor, sie mit ihren Bälgern stehen zu lassen, als sie endlich unter der Voraussetzung einwilligte, mich anschließend auf ein Glas Wein in ihre Wohnung einzuladen.
Nichts passiert einfach so. Das zumindest dürfte Ihnen doch klar sein, oder?
Als wir eine halbe Stunde später vor ihrer Haustüre standen, waren die Zwillinge wach und plärrten. Sie drückte mir einen der beiden in die Arme und ging vor mir her in den vierten Stock. Ich hörte IHN schon, je näher wir zur Wohnungstür kamen. Er sang.
Ein junger Mann, Typ ewiger Soziologiestudent, machte die Tür auf und die Musik wurde noch lauter.
Das ist, was ich hörte:
Ich kann dich spür’n,
will dich nicht verlier’n,
so viele Nächte lang gewartet,
so viele Träume ungeträumt,
ich werde immer bei dir bleiben,
so vieles haben wir versäumt.
Irgendwo anders – wartet unser Glück,
irgendwo anders – wir beide Stück für Stück,
irgendwo anders – ich glaube fest daran,
irgendwo anders – wir beide, Frau und Mann.
Soll ich noch etwas über die Melodie schreiben? Also, sie ist eingängig. Eingängig, aber nicht schnulzig. So ein bisschen wie Musik von Xavier Naidoo. So ein bisschen jedenfalls, okay?
Der Zwillingsvater glotzte mich an. Ich merkte, wie ich rot wurde. Ich fragte ihn, wer der Sänger sei, und er kapierte erst nicht, was ich meinte.
„Sie meint die CD“, sagte seine Frau.
Er nahm mir das Kind ab.
„Mark Torani.“
Ich hatte den Namen noch nie gehört, aber die Verbindung war sofort da. Es hing wohl mit der Art zusammen, wie er sang, mit dem „Schmelz“, wie man sagt und dabei jede Empfindung abwürgt, weil es so dermaßen abgedroschen klingt. Ich würde es vielleicht „Rauch“ nennen, auch bescheuert, aber besser kann ich es nicht beschreiben. Ich hatte jedenfalls den Eindruck, dass der, der da singt, nur für mich singt. Und genau so war es ja auch.
Ein unbeschreibliches Glücksgefühl durchflutete mich. Ich weiß nicht, ob das irgendjemand nachvollziehen kann, der die wahre Liebe noch nicht erlebt hat, aber als ich Marks Musik und seinen Namen zum ersten Mal hörte, war es in etwa so, als hätte ich einen winzigen Zipfel von Gott gesehen. Verstehen Sie? Wohl kaum.
Der Schlussakkord verklang und das Lied fing von vorne an.
„Genial, oder?“, fragte der Studententyp, „ich hab’ die Repeat-Taste gedrückt.“
Ich blieb noch eine Weile, in der die beiden vollauf damit beschäftigt waren, ihre Kinder abzufüllen und ruhigzustellen. Ich saß alleine auf dem winzigen Balkon, trank das Glas Rotwein, das die Frau mir gebracht hatte, schaute in den wunderschönen Abendhimmel und hörte Mark zu. Die Wolken sahen ganz zart und leicht aus, rosa und weiß und gelb, und ich spürte, wie nahe Gott mir war und wie viel Mut er mir machte.
So fing es an mit Mark und mir.
Er heißt übrigens wirklich Torani, sein Vater ist Italiener. Sein richtiger Vorname lautet allerdings „Marco“, aber die Plattenfirma fand Mark irgendwie besser. All so was findet sich auf seiner Homepage: seine Biografie, seine Veröffentlichungen, seine Tourpläne, seine Fan-Adresse, seine Merchandisingprodukte, sein Gästebuch, sein Forum. In der Mehrzahl sind es natürlich Frauen, die ihm schreiben, und es ist unglaublich, was diese Schlampen sich erdreisten. Es scheint sie auch nicht zu stören, dass jeder LESEN kann, was sie gerne mit ihm machen würden. Es gibt wohl keine, die nicht mit Freude für ihn ihr Höschen zur Seite schieben würde. Als ob Sex das wäre, wonach er suchte. „Gott ist die Liebe, und wer in der Liebe bleibt, bleibt in Gott und Gott bleibt in ihm.“ Aber von so was haben diese Weiber natürlich nicht die leiseste Ahnung.
Das erste Mal geschrieben habe ich ihm etwa vor einem Jahr. Wie viel mir seine Musik bedeutet und wie tief mich seine Stimme berührt, dass alles, was er singt, auf mich geschrieben zu sein scheint, wie wichtig seine Musik für mein Leben ist und so weiter. Ich bin nicht blöd, ich weiß, dass er viele solcher Briefe bekommt. Jede dieser Schreckschrauben, die ihm täglich in sein Gästebuch sülzen, fühlt sich auserkoren und schreibt das Gleiche. Der Unterschied ist allerdings, dass ich tatsächlich meine, was ich schreibe, und vor allem, dass diese Tanten an seine Mailadresse schreiben oder an die Anschrift des Fanclubs, was lachhaft ist. Jeder weiß, dass er diese Briefe nie zu lesen kriegt.
Ich habe ihm gleich beim ersten Mal nach Hause geschrieben und den Brief persönlich eingeworfen. Was war ich doch glücklich! Schon allein das Gefühl, das ich hatte, als ich die letzten paar Schritte auf seine Haustür zuging – genau den Weg, den er sonst immer geht, ER, immer, mit seinen Füßen, die seinen Körper tragen. Es ist unbeschreiblich schön gewesen.
Mark lebt in Stuttgart, das ist über die Autobahn nicht mal eine Stunde von hier. Eine Studienkollegin von mir arbeitet dort am Institut für Organische Chemie und Mark hat vor ein paar Jahren, so steht es übrigens auch in seiner Biografie, ebenfalls in Stuttgart studiert. Chemie nicht, natürlich nicht, das passt nicht zu ihm. Außerdem hätten wir uns dann nie so gut ergänzt. Wenn auch nur für kurze Zeit.
Er war für vier Semester am Institut für Erziehungswissenschaften und Psychologie eingeschrieben und hat es geschafft, neben seiner Musik auch den einen oder anderen Schein zu machen. Wer seine Musik und seine Texte hört, weiß, dass er kein Dummer ist. Die meisten Musiker haben wohl schlichtere Gemüter als Mark. Vermute ich.
Ich traf mich also mit meiner Bekannten der guten alten Zeiten wegen, ließ Chemikergequatsche über mich ergehen und fragte irgendwann, ob sie für einen Kollegen von mir nicht die Adresse eines alten Schulfreundes rausbekommen könnte. Marco Torani hieß er und habe wohl auch mal an ihrer Uni studiert. Es war so was von einfach! Eine Woche später hatte ich seine Anschrift. Er wohnte noch immer in der Paulinenstraße, Paulinenstraße 12, 2. Stock.
Es ist ein altes, sehr schönes Haus. Gründerzeit oder Jugendstil, keine Ahnung, mit Architektur kenne ich mich nicht aus. Die Fassade entlang der Fenster ist mit girlandenartigen Rahmen versehen, in der Mitte des Hauses sitzt eine Art Erker. Es ist riesig, fünf Stockwerke. Die einzelnen Zimmer haben hohe Decken und auch die sind mit Stuck verziert. „Herrschaftlich“, kam mir in den Sinn, als ich das erste Mal davorstand. Das Haus grenzt direkt an die Paulinenstraße und damals war ich froh darüber. Es fällt nicht besonders auf, wenn jemand vorbeigeht, einen Blick in die Räume wirft und dann noch einen Brief in den Kasten steckt. Es wäre schrecklich gewesen, wenn er mir dort schon beim ersten Mal begegnet wäre. Nicht, dass ich das nicht gewollt hätte, im Gegenteil! Aber es wäre zu früh gewesen. Ich wollte, dass Mark die Chance hat, auf mich vorbereitet zu sein. Ich hatte mich schließlich mein ganzes Leben lang auf ihn vorbereiten können.
Gibt es etwas, das mehr über einen Menschen aussagt als die Handschrift? Nicht vieles. Ich habe mir deshalb die Mühe gemacht, einige Schriftproben von mir beizufügen. Damit Sie etwas zu tun haben.
Ich habe sofort gespürt, dass dieser erste Brief tatsächlich von Mark persönlich stammte, obwohl das von außen erst mal nicht zu merken war. Den von mir frankierten und adressierten Rückumschlag hatte er mit einem Stempelabdruck versehen, auf dem sein Profil zu sehen war. Überflüssig zu sagen, dass er im Profil sehr schön ist. Den Brief selbst hatte er mit schwarzer Tinte geschrieben. Ich füge ihn diesem Bericht bei. Ich bin mir sicher, dass es nur wenige Männer gibt, die eine ähnlich sanfte Handschrift haben, leicht nach links geneigt (Stärke!), mit langen Bögen und winzigen I-Punkten. Und erst, was er geschrieben hatte: wie sehr er sich gefreut habe, wie anspornend mein Brief gewesen sei und dass er sich von Herzen wünsche (von Herzen!), dass ich ihm auch weiterhin gewogen bleibe. So schön altmodisch konnte er sich ausdrücken! Und kein Wort der Verwunderung oder des Ärgers darüber, dass ich ihm zu nah gekommen war, indem ich den Brief bei ihm eingeworfen hatte. Ich schwebte im siebten Himmel und wurde noch ein bisschen mutiger.
Beim nächsten Mal schickte ich ihm (zusammen mit einem wirklich sehr guten Foto von mir sowie einer Einladung) mein Lieblingszitat aus der Bibel – das mit Gott und der Liebe und „Gott bleibt in ihm“ (1. Johannes 4, 16). Ich weiß nicht, was ihn letztlich dazu veranlasst hat zuzusagen, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass es das Zitat aus der Bibel war.
Das Foto von mir ist vor ein paar Jahren bei einer Feier am Institut gemacht worden (Abzug liegt bei) und zeigt mich in sehr ausgelassener Stimmung: Ich tanze, lache und habe dabei die Augen geschlossen. Meine Haare umgeben mich wie ein Kranz, meine Zähne blitzen, sogar meine Zunge ist zu sehen. Ich trage ein weißes Top und eine enge blaue Jeans. Auf der Einladung stand: Wollen wir uns sehen? Sonst nichts. Reicht ja auch.
Mit Prominenten ist es doch so: Kein Mensch, jedenfalls keiner, der nicht ebenfalls Sänger ist oder sonst irgendwie bekannt, traut sich, einen „Star“ so zu behandeln, als wäre er der nette Typ von nebenan. Und wie soll so jemand sicher sein, dass sein Gegenüber nicht ausschließlich den Star in ihm sieht, das Geld und den Ruhm? Nach meinem ersten Brief an Mark behandelte ich ihn also „ganz normal“. In der Liebe ist alles erlaubt, heißt es doch, oder? Mark biss natürlich an und hatte das Glück seines Lebens direkt vor seiner Nase. (Und das meine ich jetzt kein bisschen zynisch. Dass er sein Glück mit Füßen treten würde, wusste ich zu diesem Zeitpunkt ja noch nicht.)
So einfach war das also. Prominente sind eben auch nur Menschen, ähnlich einsam und gestört wie wir alle, verloren, bis Gott uns findet und wir ihn.
Im Radio, sofern deutsche Titel gespielt werden oder Englisch für den Zuhörer kein ernsthaftes Verständigungsproblem darstellt, wimmelt es von versteckter und direkter Anmache. Schon mal darauf geachtet? Menschen, die einsam sind, kann das schwer zusetzen, keine Frage, und insofern hatte Ihre Kollegin (die Polizeipsychologin) natürlich recht. Aber ich war das letzte Mal einsam, als ich noch in Marschalkenzimmern lebte und den Weg zur St.-Nikolas-Kirche noch nicht kannte. Danach nie wieder. (Hallo Gutachter! Dick markieren!)
Zunächst dachte ich, ich sei in meinem zweiten Brief zu weit gegangen, denn er meldete sich sehr lange nicht. Erst hinterher habe ich erfahren, dass sein Vater in dieser Zeit im Sterben gelegen hatte, und dann schämte ich mich für meine Ungeduld. Es ist schlimm, wenn die eigenen Eltern sterben. Für die meisten jedenfalls.
Sein Antwortbrief (liegt nicht bei) war gar kein Brief, sondern eine Postkarte. „Wann? Bald?!“ stand darauf und „M.“ Die Vorderseite war die Schwarz-Weiß-Fotografie eines Seesterns. Sie hing lange Zeit gerahmt über meinem Bett.
Mit meiner dritten Nachricht habe ich mir dann Zeit gelassen. Er hatte angebissen und, so leid es mir tat, ich musste ihn zappeln lassen. Das alte Spiel. In der Liebe und im Krieg ...
Nach zwei Wochen, in denen ich, abgesehen von der Zeit, in der ich an der Uni war, fast ununterbrochen seine CDs hörte, schrieb ich ihm ebenfalls eine Postkarte.
Vorn war eine liegende Frau zu sehen. Ein Spätwerk von Picasso, glaube ich. Auf die Rückseite schrieb ich: „Freitag, 13. August, 18.00 Uhr, Eingang Botanischer Garten, Karlsruhe. Deine R.“
„R“ steht für Rahel, so heiße ich. Natürlich ist das nicht der Name, den meine Eltern für mich ausgesucht haben. Ihre Wahl fiel damals auf „Ingrid“. Noch Fragen?
Rahel nenne ich mich seit meiner Freiburger Zeit. Der Name stammt aus dem Alten Testament. Rahel war Jakobs Lieblingsfrau, aber es hat eine Zeit gedauert, bis er sie „haben“ konnte. Gottes Werk. Natürlich. Davon abgesehen passt der Name wirklich perfekt zu meinem Äußeren.
Er kam. Und es wurde ein unglaublicher Abend. Ich hatte Tage damit zugebracht, mir über meine Kleidung Gedanken zu machen. Und dann trugen wir beide das Gleiche! Jeans und ein weißes Hemd. Wir lachten, als wir uns trafen, wir strahlten, wir umarmten uns, drückten unsere Wangen aneinander und noch ein bisschen mehr und verteilten Luftküsse. Es war von Anfang an so einfach zwischen uns.