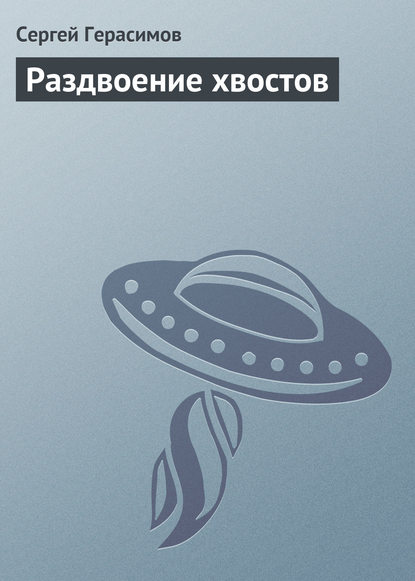- -
- 100%
- +
Die Theorie der Bildung und Erziehung im Kontext der Einwanderungsgesellschaft Bundesrepublik hat in den letzten fünfundzwanzig Jahren einen tiefgreifenden Wandel von einer defizitorientierten „Ausländerpädagogik“ über eine im wesentlichen an Bildungsinhalten ausgerichteten „multikulturellen Pädagogik“ zu einer vor allem die Konstruktion des Selbstverständnisses von Kindern und Jugendlichen im Immigrationsprozeß thematisierende „interkulturelle“ Pädagogik durchlaufen. Dabei schwankt die interkulturelle Pädagogik der späten achtziger Jahre12 zwischen einer Pädagogik besserer Lebenschancen für alle Kinder im Horizont einer gerechten Republik sowie einer postmodern instrumentierten Ermutigung zur Differenz, die zugleich mit der kritisch-befreienden Dekonstruktion bestehender Selbstverständnisse einhergehen soll. Ein näherer Blick auf vielfältige pädagogisch-politische Konfliktfelder wie den muttersprachlichen Unterricht, die Auflösung eigenständiger Ausländerfachbereiche an kommunalen Volkshochschulen, den Streit um die eventuelle fundamentalistische Orientierung in ihren Lebenschancen eingeschränkter muslimischer Jugendlicher und die nach wie vor überdurchschnittlich hohe Sonderschulüberweisungsrate von Kindern italienischer und türkischer Herkunft zeigt auch ein anderes Bild: Wenn nicht alles täuscht, klagen unterschiedliche Minderheitengruppen mit ihren zum Teil strittigen politischen Vorschlägen wie Quotierungen, Maßnahmen zur Subventionierung ethnischer Zusammenhänge sowie staatsrechtlicher Anerkennung als Minderheiten etwas ein, das sich der einfachen Alternative von Ethnisierung bzw. Selbstethnisierung hier und staatsbürgerlich-demokratischer Assimilation dort entzieht. Dabei geht es um mehr als lediglich darum, in unterschiedlichen Bildungseinrichtungen zu einer wechselseitigen Erweiterung der Kenntnis von Lebensformen für Kinder mit und Kinder ohne deutschen Paß zu gelangen. Im Kern aller vermeintlichen oder wirklichen Wünsche nach ethnischer Segregation oder einer am Vorbild der USA gewonnenen Quotierungsdiskussion geht es um das Einklagen nicht nur besserer sozialer Chancen, sondern auch und vor allem um eine Politik der Achtung,13 mit anderen Worten: um den Kampf für ein Bildungssystem, in dem sich niemand für seine Herkunft schämen muß bzw. in dem alle – trotz unterschiedlicher Herkunft – auf mindestens einige Gehalte der ihnen zugeschriebenen Tradition stolz sein können. Wie das Verhältnis von Repräsentation und Artikulation von Migrantenkulturen im Bildungswesen im einzelnen umgesetzt wird, wird auch in Zukunft Gegenstand politischen Streits sein. Worauf es ankommt, ist die Behauptung, daß die Theorie der interkulturellen Bildung neben ihrem Beharren auf Chancengleichheit, auf Toleranz und Erweiterung von sozialer Wahrnehmungsfähigkeit den Fragen von Selbstachtung, Selbstrespekt und Selbstwert – also wiederum Begriffen, die einer Semantik moralischer Gefühle entspringen – bisher noch nicht genügend Aufmerksamkeit gewidmet hat.14
Trauer, Schande, Scham, Schuld und Verantwortung, Gedenken und Erinnerung waren die zentralen Begriffe der Gedenkstättenpädagogik; Probleme der moralischen Motivation, bedeutsamer affektiver Beziehungen und einer loyalitätsgebundenen Moral die Hauptthemen der Weiterentwicklung des sozialkognitivistischen Paradigmas; Selbstachtung und Selbstrespekt die wichtigsten Bezugspunkte einer interkulturellen Bildung, die die Herstellung materieller Chancengleichheit, eines universalistischen Verfassungspatriotismus15 und einer kulinarischen Erweiterung von Lebenschancen nicht für das Ende der Debatte hält. In allen drei Feldern rückte die Frage nach den „moralischen Gefühlen“ ins Zentrum: bei der Gedenkstättenpädagogik in ihrer begrifflichen und sachlichen Begründung; bei der sozialpädagogischen Moralerziehung als Ausweg aus der Erklärungsschwäche eines reinen Kognitivismus; bei der interkulturellen Bildung als politisch-moralische Hypothese über eine bisher weitgehend übersehene wesentliche Dimension.
Eine auf einer Theorie moralischer Gefühle aufbauende grundbegriffliche und forschungsbezogene Neuorientierung wird die normative Grundlegung der Pädagogik nicht unberührt lassen. In einer Zeit, in der eine blinde und oftmals staatstreue Wertediskussion sowie der anschwellende Ruf nach einer Erneuerung der Erziehung zu politischer Loyalität nach wie vor die öffentliche Debatte bestimmen, kommt es darauf an, jene Charaktereigenschaften intellektueller und eben affektiver Art zu identifizieren, die es Kindern und Heranwachsenden ermöglichen, zu Wertzumutungen aller Art reflektiert Stellung zu beziehen und ein gutes, weil selbstbestimmtes und auf andere bezogenes, ja glückliches Leben zu führen. Ich bezeichne diese Charaktereigenschaften mit einem bewußten Rückgriff auf die antike Bildungstheorie als „Tugenden“. Tugenden lassen sich – unabhängig davon, ob man das klassische Gespann von Gerechtigkeit, Mut, Klugheit, Besonnenheit sowie Glaube, Liebe und Hoffnung oder einen anderen Kanon in Betracht zieht – als das Ensemble jener individuellen Verhaltensdispositionen analysieren, deren Zusammenspiel ein befriedigendes menschliches Leben verheißt.
In der antiken Philosophie bezeichnete der Begriff Tugend (griechisch „Arete“, lateinisch „virtus“) ganz allgemein die spezifische Leistungsfähigkeit oder Tauglichkeit – heute sprechen wir von Funktionalität – von Dingen, Organen, Menschen oder auch Handlungen, von der Tauglichkeit des Leibes, eines Nutztieres, der Dienlichkeit argumentativer Praxis, ja sogar von Diebstählen. Bei Aristoteles erst wird Tugend zum Begriff für eine spezifisch menschliche Eigenschaft, zu einer anthropologischen Kategorie. Vor allem aber stehen die so ausgewiesenen menschlichen Fähigkeiten für ihn immer im Horizont der Frage nach dem Glück.16
Gleichwohl: Wer von Tugenden hört, fühlt sich schnell an „Werte“ erinnert, an moralisierende Zumutungen der Gesellschaft, sich so oder so zu verhalten. Eben darum geht es nicht. Es geht vielmehr um die Frage, über welche Fähigkeiten, heute spricht man von Handlungskompetenzen oder auch von „Schlüsselqualifikationen“, Individuen verfügen müssen, um sich gesellschaftlichen Zumutungen gegenüber behaupten und ein glückliches Leben im Verein mit anderen anstreben zu können. Damit ähnelt die Tugendlehre auf den ersten Blick der in den späten sechziger Jahren entwickelten Konfliktpädagogik sowie der emanzipatorischen Erziehung, die ja vor allem auf die Stärkung individueller Kritikfähigkeit setzten. Auf den zweiten Blick unterscheidet sie sich von beiden erheblich. Sie unter- und überbietet nämlich beide Positionen. Anders als die klassenkampftheoretisch ansetzende Konfliktpädagogik verfügt sie über keine politischen Vorgaben mehr, anders als die emanzipatorische Erziehung aber traut sie sich gleichwohl zu, die Frage nach dem „Wozu“ der Emanzipation zu stellen, ohne sie indes abschließend beantworten zu wollen. Anders auch als die stark von moralischen, christlichen Fragestellungen bestimmten Pädagogiken der achtziger und neunziger Jahre mit ihrem Akzent auf Frieden, Verschonung der Umwelt sowie Gerechtigkeit zwischen den Geschlechtern und Generationen nimmt die Theorie der Tugenden den unvertretbaren Glücksanspruch der Individuen ernst. Sie verhält sich damit zu Forderungen einer universalistischen Moral positiv, aber nicht mehr naiv. Sie weiß, daß auch das allgemeine Wohl nur zu erzielen ist, wenn jenseits aller wertenden Vorgaben Lebensglück und Lebenssinn der einzelnen nicht nur berücksichtigt werden, sondern im Zentrum politischer und pädagogischer Bemühungen stehen. Genauer: Sie weiß, daß umfassende Gerechtigkeit in einer Gesellschaft nur zu erreichen ist, wenn dieses Ziel mit den Wünschen und Ansprüchen der Individuen auf ein erfülltes Leben wenigstens nicht kollidiert und dazu in einem fruchtbaren Spannungsverhältnis steht. Daß keine Politik Glück – sei es individuell oder kollektiv – herstellen kann, ist die leidvolle Lehre aus der Geschichte des Kommunismus im zwanzigsten Jahrhundert. Daß das Streben nach dem Glück jedoch, wenn es der materiellen und gesetzlichen Absicherung ermangelt, schnell in massives Unglück umschlagen kann, das lehren nicht nur bald fünfzehn Jahre Neoliberalismus. Daß eine Gesellschaft, die die Frage nach dem Glück nicht öffentlich stellt und sie ganz und gar im Umkreis des Privaten hält, stagniert, war und ist die Herausforderung, die der Feminismus einer patriarchalisch geprägten Welt nach wie vor stellt.
Niemand hat die inneren Spannungen, die einer materialistischen Tugendlehre innewohnen, genauer gesehen als der heute bisweilen für veraltet gehaltene Bertolt Brecht. Am Ende der Flüchtlingsgespräche läßt er seinen Helden Kalle sagen: „Ich fordere Sie auf, sich zu erheben und mit mir anzustoßen auf den Sozialismus – aber in solch einer Form, daß es hier im Lokal nicht auffällt. Gleichzeitig mache ich Sie darauf aufmerksam, daß für dieses Ziel allerhand nötig sein wird. Nämlich die äußerste Tapferkeit, der tiefste Freiheitsdurst, die größte Selbstlosigkeit und der größte Egoismus.“17
Das Thema der Tugenden, der persönlichen Eigenschaften zumal von Politikern, hat in den letzten Jahren besonders in Deutschland eine überraschende Aktualität gewonnen. Der eine hat kurz nach seinem Amtsantritt sein politisches Amt als Finanzminister fluchtartig aufgegeben, der andere gibt die Rolle des „elder statesman“: Erinnert sich noch jemand an die bittere Auseinandersetzung zwischen Oskar Lafontaine und dem damaligen Kanzler Helmut Schmidt in den frühen achtziger Jahren, als dieser – schon damals besorgt um den „Standort Deutschland“ – Disziplin, Fleiß und Ausdauer forderte? Der Chef der saarländischen SPD hielt dem Kanzler damals vor, lediglich „Sekundärtugenden“ gefordert zu haben, mit denen man ebenso gut ein Konzentrationslager leiten könne. Schmidt, als ehemaliger Wehrmachtsoffizier verständlicherweise tief getroffen, reagierte beleidigt. Dabei hatte Lafontaine, der bei den Jesuiten in die Schule gegangen ist, ganz recht. Die Tradition der abendländischen Tugendlehre bezieht bezüglich der Unterschiede von Primär- und Sekundärtugenden keine andere Position. Unter den „Kardinaltugenden“, so meinte etwa Thomas von Aquin im dreizehnten Jahrhundert, sei die vornehmste die Klugheit, die Gerechtigkeit die zweite, die Tapferkeit die dritte, Zucht und Maß aber die vierte.18 „Klugheit“ bedeutet bei Thomas nicht die Fähigkeit zum vorsichtigen Abwägen, sondern die Fähigkeit zum Erkennen der Wahrheit.
Aber sogar wenn Lafontaine gegen Schmidt recht gehabt hätte – was spricht in einer weitgehend von Traditionsschwund, Pluralismus und Multikulturalismus bestimmten Gesellschaft dafür, den alten abendländischen und zopfig gewordenen Tugenddiskurs wieder aufzunehmen? Sollte Helmut Kohls vor zwanzig Jahren pathetisch verkündete „geistig-moralische Wende“, die glücklicherweise eine Wortblase blieb, vor derlei Begriffen nicht ebenso warnen wie die letztlich konservativen Appelle der Kommunitaristen, die zur Lösung aller Gegenwartsprobleme immer nur das „Ehrenamt“ anzubieten haben?19 Über Tugenden und ihre Theorie zu reden ist schon allein deshalb sinnvoll, weil sie nach Lage der Dinge das einzige Programm darstellen, das eine materialistische Ethik zeitgemäß zu Wort kommen läßt. Man mag zu dem britischen Soziologen Anthony Giddens, der sich zum intellektuellen Sprachrohr des zwar der Labour Party angehörenden, jedoch neoliberal regierenden Premiers Tony Blair gemacht hat, stehen wie man will – wenn er in seinem Buch Jenseits von links und rechts20 gegen den allgemeinen Produktivismus eine „Politik des Glücks“ fordert, nimmt er das zentrale Problem einer Arbeitsgesellschaft ohne Arbeit ins Visier. Das „Glück“ aber, der Wunsch nach einem materiell mehr oder minder sorgenfreien, von sinnvollen Zielen und befriedigenden menschlichen Beziehungen erfüllten Leben ist – jedenfalls der Tradition nach – auf das engste mit den Tugenden verbunden. So sah es Aristoteles, der in der Nikomachischen Ethik notierte: „Es liegt weiterhin auf der Hand, daß wir nach der menschlichen Tugend fragen. Denn wir suchten von vornherein das menschliche Gute und die menschliche Glückseligkeit.“21
Tatsächlich scheinen die Beziehungen zwischen Glück und einem erfüllten, guten Leben22 jedoch komplex, geradezu paradox zu sein: „Das schwerste Gewicht beugt uns nieder, erdrückt uns, preßt uns zu Boden. In der Liebeslyrik aller Zeiten aber sehnt sich die Frau nach der Schwere des menschlichen Körpers. Das schwerste Gewicht ist also gleichzeitig ein Bild intensivster Lebenserfüllung. Je schwerer das Gewicht, desto näher ist unser Leben der Erde. Desto wirklicher und wahrer ist es. Im Gegensatz dazu bewirkt die völlige Abwesenheit von Gewicht, daß der Mensch leichter wird als Luft, daß er emporschwebt und sich von der Erde, vom irdischen Sein entfernt, daß er nur noch zur Hälfte wirklich ist und seine Bewegungen ebenso frei wie bedeutungslos sind.“23
Milan Kunderas Roman Die unerträgliche Leichtigkeit des Seins erschien 1985 im französischen Exil, vier Jahre vor dem Fall der Berliner Mauer. Mit dem Jahr des Mauerfalls verbindet sich nicht nur die Erinnerung an das Ende des Kalten Krieges und an die Vereinigung der getrennten deutschen Teilstaaten, sondern auch an das unwiderrufliche Ende einer verzerrten, mißbrauchten und falsch verwirklichten Utopie, des Sozialismus. Gleichwohl fällt auf, daß der Niedergang der staatsbürokratischen Diktaturen in Ost- und Mitteleuropa keineswegs überall der Demokratie den Sieg gebracht hat und daß der Kapitalismus, auf sich allein gestellt, nicht so effizient ist, wie es vor dem Hintergrund des Staatssozialismus schien. Seit die alten Gespenster, nämlich massenhafte Arbeitslosigkeit und vermeintlich steigende gesellschaftliche Gewalt, auferstanden sind, scheint auch im siegreichen Westen der Eindruck unüberwindbar, daß die guten Zeiten endgültig vorüber sind. Von den USA bis nach Deutschland wird verkündet, daß die Generation der heute Achtzehn- bis Zwanzigjährigen den durchschnittlichen Lebensstandard ihrer Eltern nicht mehr werde halten können, daß das über Steuern verteilbare Bruttosozialprodukt abnehme, daß angesichts der globalen und nationalen Probleme Maßhalten, Solidarität, Bescheidenheit, Patriotismus und Disziplin auf der Tagesordnung stünden. Der Begriff „Individualismus“, einst hochgeschätzt, wurde wieder zu einem Slogan, der nicht nur positive Assoziationen hervorrief; der Begriff der „Gemeinschaft“, in Deutschland des Mißbrauchs wegen, den die Nationalsozialisten mit ihm getrieben haben, verpönt, gewann über die US-amerikanische Kommunitarismusdebatte neue Dignität, eine einst hedonistische Linke sucht Bindung, Verantwortung, Verbindlichkeiten und Autorität. Ging es einst um die Kritik an einem oft als repressiv empfundenen Moralismus, so beherrschen heute ethische Debatten, religiöse Sehnsüchte und – aller Rede von „Streitkultur“ zum Trotz – neue Formen der Unduldsamkeit das öffentliche Terrain.
Milan Kunderas Roman, der sich mit den politischen und erotischen Schicksalen dissidenter Intellektueller unter der tschechoslowakischen Parteidiktatur auseinandersetzt, spielt in den letzten Jahren des „Realen Sozialismus“, in der Zeit des Spätstalinismus, einer Epoche, die nicht wenige Beobachter mit einem Etikett aus der neueren Geschichte als „Ancien Régime“ bezeichnet haben. Als „Ancien Régime“ gelten in der Historiographie jene Jahrzehnte vor der Französischen Revolution, als sich die bürgerliche Gesellschaft ökonomisch zwar schon durchgesetzt hatte, das politische und kulturelle Leben aber nach wie vor von einem mehr oder minder verantwortungslosen Adel geprägt wurde, der sich objektiv überlebt hatte.
Der französische Staatsmann, Schriftsteller und Diplomat Talleyrand, der 1754 noch unter dem Ancien Régime geboren war und bis 1838, im Zeitalter der Restauration, lebte, begann seine Karriere als kirchlicher Funktionär, um sich dann der siegreichen Revolution zur Verfügung zu stellen und kirchliches Vermögen zu liquidieren. Als Royalist verdächtigt, emigrierte er 1792 in die USA, kehrte 1799 nach Frankreich zurück, um Napoleon als Außenminister zu unterstützen und ihm schließlich, weil er mit dessen Eroberungspolitik nicht einverstanden war, die Gefolgschaft aufzukündigen. Nach Napoleons endgültiger Niederlage vertrat Talleyrand Frankreich auf dem Wiener Kongreß, trat 1815 zurück, um fünfzehn Jahre später die bürgerliche Julirevolution zu unterstützen und als Botschafter in London zu wirken. Von Talleyrand, dem der Verrat – an einzelnen Personen und politischen Regimes – ebenso nahe war wie die Treue zu sich selbst und zu Frankreich, wird ein Ausspruch aus seiner letzten Lebensphase überliefert: Niemand könne die ganze Süße des Lebens erfahren haben, der nicht unter dem Ancien Régime gelebt habe. Daß die Revolutionäre diese Süße ablehnten, sich schon in ihrer äußeren Gestalt ernst und gefaßt gaben, wird an den vielfältigen Porträts deutlich, in denen streng wirkende, schwarz gekleidete Männer auftreten. Auf den klassizistischen, historischen Gemälden etwa Jacques Louis Davids präsentieren sich die Revolutionäre im Gewande altrömischer Senatoren mit strengem Faltenwurf und kühlen Farben. In Talleyrands Aussage über die Süße des Lebens, die sofort Erinnerungen an das Rokoko, an Bilder anmutig tändelnder, leichtsinniger höfischer Gesellschaften, etwa auf den Bildern Watteaus oder in den Opern Rossinis, provoziert, drückt sich in nostalgischer Weise die Erfahrung eines Epochenbruchs aus. Heute wissen wir, daß diese Süße kaum für verarmte und hungernde Bauern, unterdrückte Frauen, bettelarme Tagelöhner oder gepreßte Soldaten, kurz: für die Mehrheit der Bevölkerung galt.
Über Sinn und Unsinn, über den offensichtlich ideologischen Charakter wie kulturgeschichtlichen Erfahrungsgehalt von Talleyrands Aussage soll hier nicht gesprochen werden. Worum es hingegen gehen soll, ist die Frage, ob das Bild, das wir uns im Rückblick – sei es von der Bundesrepublik Deutschland, sei es von der DDR – machen, tatsächlich dem Blick Talleyrands auf das Ancien Régime entspricht, wonach das Leben im „Realen Sozialismus“ in Wirklichkeit – wie Milan Kundera es suggeriert – bei aller Repression leicht, weil verantwortungslos war und dementsprechend das Leben in den westlichen Gesellschaften des Kalten Krieges eine leichtsinnige Existenz unter der Käseglocke sinnlos gewordenen Wohlstandes gewesen ist. Eine reumütige Linke, die angesichts rechter Jugendgewalt die Rückkehr zu konservativen Tugenden in Politik, Erziehung und Gesellschaft fordert, unterstützt diesen Eindruck: „Es ist leider so“, so schon vor Jahren ein reumütiger Altachtundsechziger, „daß die ‚Rechten‘ näher an der neuen Realität sich bewegen. Die alten Themen des konservativen Weltbildes – Leistung, Werte, Verantwortung, Autorität, Orientierung – haben eine neue Aktualität. Es ist mithin überaus leicht und verführerisch, die gesellschaftlichen Veränderungen, die den konservativen Wertekanon plausibel machen, darum als einen allgemeinen Rechtsruck wahrzunehmen. Es ist paradox: Die linken Bedrohungsbilder von der rechten Übermacht sind zum ersten Mal realistisch, nicht weil die Rechte stark ist, sondern die Linke gegenüber der Realität schwach. Der konservative Wertekanon ist nicht zufällig näher an der Aktualität. Denn er entspringt einer pessimistischen Anthropologie und der Bewahrung des historisch älteren Wissens von dem barbarischen Kern der Zivilisation.“24
Haben wir zu leichtsinnig, am Ende gar unverantwortlich gelebt, waren die Prinzipien, für die wir in Erziehung, Politik und Gesellschaft eintraten, nämlich Liberalität, Autonomie, Antiautoritarismus und kritische Rationalität, ideologische Luxusgüter, süße Täuschungen – kaum anderes als die Hündchen und Bonbonnieren auf den Bildern Watteaus? Erweist sich im Rückblick der Aufklärungs- und Liberalisierungsschub der sechziger Jahre gleichsam als Sumpfblüte, die nur unter der Käseglocke des Kalten Krieges auf Kosten jener gedeihen konnte, die unter der Repression des bürokratischen Sozialismus ihr Leben fristen mußten? Steht daher die Ablösung jenes individualistischen Leichtsinns durch einen neuen, an beliebigen Gemeinschaften orientierten Tugend- und Moralkult auf der Tagesordnung? Heißt das: „Ende der Leichtigkeit“? Stellt man diese Frage, so ergibt sich eine Reihe von Perspektiven, unter denen sie präzisiert und geklärt werden kann. So geht es erstens um die historische Perspektive: War das Leben zwischen 1949 und 1989 wirklich so leicht? Herrschten keine sozialen Konflikte, gab es keine schmerzhaften gesellschaftlichen Auseinandersetzungen, war sozialer Wohlstand wirklich alles, worum es in dieser Zeit ging? Und: Kam dieser soziale Wohlstand tatsächlich allen zugute? Die Frage beinhaltet zweitens eine beinahe schon zum Gemeinplatz gewordene soziologische Vermutung: daß das Leben unserer Gesellschaften durch und durch von Individualisierungsschüben durchzogen ist und daß diese Individualisierung von Lebensläufen und Lebensstilen ein Nachlassen des Interesses an gemeinschaftlichen Werten provoziert, um schließlich in eine egoistische Ellenbogengesellschaft zu münden. Beidem mag so sein oder nicht – wir sollten jedoch nicht vergessen, daß es sich bei derlei Vermutungen nicht um unumstößliche Wahrheiten, sondern nur um mehr oder minder plausible soziologische Hypothesen handelt. Immerhin hat die Shell-Jugendstudie des Jahres 2002 erwiesen, daß eine Jugend, die unter dem ideologischen Primat des Neoliberalismus aufgewachsen ist, deutlich weniger bereit ist, an öffentlichen Angelegenheiten zu partizipieren. Indem diese Jugend zugleich stärker den „Sekundärtugenden“ anhängt und größeren Wert auf persönliches Glück legt, beweist sie zudem, daß unter Bedingungen einer politisch immer wieder behaupteten Alternativlosigkeit zum Status quo gesellschaftliche Kreativität nur noch unter Aufbietung größten Idealismus möglich ist. Daß dieser Idealismus immer mehr zu einem Privileg der besser Gebildeten wird, bestätigt lediglich, was bereits Studien zur Bildungsbeteiligung im Bereich der Schule mit deprimierender Deutlichkeit bewiesen haben: Bildung, Moral und Engagement sind inzwischen zu einem sozial vererbbaren Kapital der oberen Dienstklassen geworden. Mindestens in Deutschland ist eine neue Klassengesellschaft entstanden, die auch deren moralisches Selbstverständnis prägt. Im Tenor der Kulturkritik wird dieser Befund umgedeutet: Hier schießt dann der Ärger über demolierte Telefonhäuschen mit subjektiver Verunsicherung ob vermeintlich erhöhter Kriminalitäts- und kritischen Überlegungen zu wachsenden Scheidungsraten zusammen. Eine weitere Frage, die sich aus der Behauptung vom „Ende der Leichtigkeit“ ergibt, ist eine normative Frage, zu deren Beantwortung wissenschaftliche Theorien und Erkenntnisse nicht mehr ausreichen. Diese Frage, die sich an unser – je eigenes – Selbstverständnis richtet, zielt letzten Endes darauf, was für ein Leben wir angesichts weltweiter Armut und furchtbaren Leidens führen können und wollen, angesichts einer über alle Medien unausweichlich verbreiteten wirklichen und fiktiven Grausamkeit, angesichts gesellschaftlicher Notlagen und Stimmungen, die auf der einen Seite immer mehr Armut, auf der anderen Seite rechtsextremistische Ideologien und Theorien begünstigen. Die Stimmung, die aus dieser Situation der schmerzhaften Bewußtheit allseitigen und weltweiten Leidens erwächst, hat Hans Magnus Enzensberger treffend skizziert.
„Gleichwohl mutet die Tagesschau jeder Verkäuferin aus dem Supermarkt zu, zwischen Inguschen und Tschetschenen, Georgiern und Abchasen zu unterscheiden. Berg-Karabach steht seit Jahren auf der Tagesordnung, und wir sind gezwungen, uns an Hand von verstümmelten Leichen ein Bild von dieser Gegend zu machen. Wir sollen uns die Namen von Gangstern merken, die wir kaum richtig aussprechen können, und uns um islamische Sekten, afrikanische Milizen und kambodschanische Fraktionen kümmern, deren Beweggründe uns unverständlich sind und bleiben. Wer dazu nicht fähig ist, gilt als hartherziger Ignorant und als egoistischer Wohlstandsbürger, dem es gleichgültig ist, wenn andere leiden.“25
Der Dichter empfiehlt in dieser Lage ein Abrüsten der moralischen Ansprüche und eine Bescheidung auf das Eigene – und sei es nur, um wenigstens den Frieden im eigenen Land zu wahren und nicht auch hier jenen Zuständen Vorschub zu leisten. Führten doch moralische Forderungen, die in keinem Verhältnis zu den Handlungsmöglichkeiten stünden, am Ende nur dazu, daß die Geforderten gänzlich streiken und jede Verantwortung leugnen. Diese Haltung bringt Enzensberger zu einer scharfen Kritik an jeder universalistischen Ethik und der Forderung, sich von allen Allmachtphantasien zu verabschieden und sich um die eigenen Angelegenheiten zu kümmern: „Wer von der Endlichkeit und Relativität unserer Handlungsmöglichkeiten spricht, sieht sich sofort als Relativist an den Pranger gestellt. Doch insgeheim weiß jeder, daß er sich zuallererst um seine Kinder, seine Nachbarn, seine unmittelbare Umgebung kümmern muß. Selbst das Christentum hat immer vom Nächsten und nicht vom Fernsten gesprochen.“26