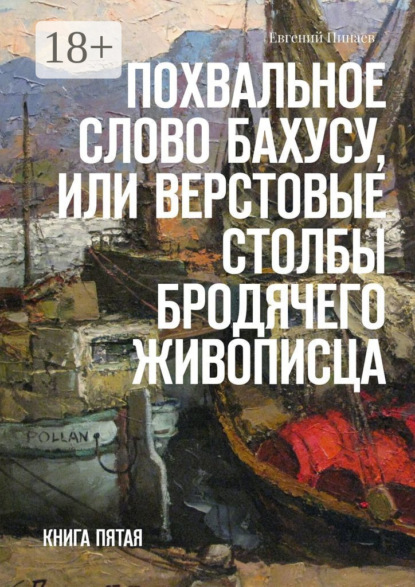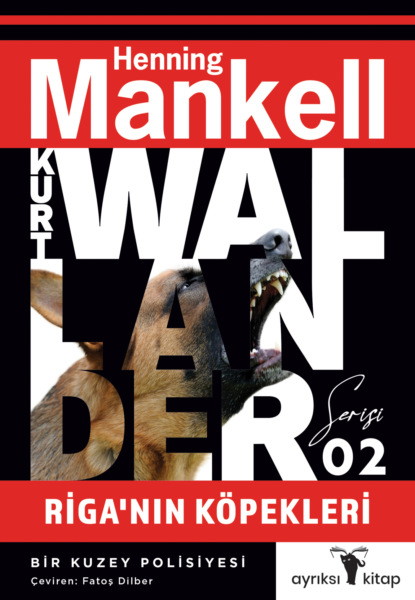- -
- 100%
- +
An diesem Vorschlag zeigt sich, daß aus der möglichen Diagnose, die guten Zeiten seien vorbei, in der Sache durchaus gegensätzliche Konsequenzen gezogen werden können: einerseits die kluge Beschränkung auf die eigenen Angelegenheiten, andererseits der bewußte Wille, die Belange aller Menschen zum vordringlichen Gegenstand des eigenen Denkens und – womöglich – eigenen Handelns zu machen. Einem tiefenpsychologisch informierten Denken wird dieser Vorschlag unmittelbar einleuchten. Moralische Forderungen, so meinen wir seit Nietzsche und Freud zu wissen, beeinträchtigen nicht nur die vitalen Bedürfnisse von Menschen und dienen nicht nur der projektiven Abwehr eigener Aggressionen, sondern leisten zudem einem grundsätzlich falschen Selbstverständnis, einer systematischen Selbsttäuschung und damit einem unwahrhaftigen Leben Vorschub. Wer in erster Linie moralischen Forderungen folgt, tue dies in aller Regel, um vom eigenen Leben und dessen Problemen abzulenken. Wer sich aber – wie die Debatte um die „hilflosen Helfer“27 gezeigt hat – über sich selbst täuscht, ist schließlich nicht in der Lage, anderen effektiv und angemessen beizustehen. Somit scheint an Enzensbergers Vorschlag kein Weg vorbeizuführen: Das Ende der Leichtigkeit, das bewußte und klare Wahrnehmen des Elends nicht nur dieser Gesellschaft, sondern der ganzen Welt führt zu einer neuen Bescheidenheit, aber auch zu einem eingeschränkten Engagement.
So bietet sich ein verwirrendes Bild: Während hier Philosophen und Politiker angesichts von Kriminalität, Drogensucht, Hedonismus, Liberalismus und Individualismus für einen neuen Wertehorizont, für Tugenden und strikte Regeln optieren, wird dort für ein Ent- und Abspannen der eigenen Ansprüche plädiert. So unvereinbar diese beiden Alternativen auf den ersten Blick erscheinen, so sehr gelten sie doch demselben Gegner: nämlich dem, was in ihrer Sicht als universalistische, abstrakte Ethik gilt. Eine moralische Haltung, die einerseits darauf verzichtet, Menschen bestimmte und konkrete Verhaltensvorschriften zu machen, sie Mores zu lehren, die aber andererseits strikt darauf beharrt, daß Fragen nach Recht und Gerechtigkeit nicht wesentlich durch Hinweise auf Nähe oder Ferne, Freundschaft oder Verwandtschaft der jeweils betroffenen Menschen oder auf der eigenen Gemeinschaft Zuträgliches oder Förderliches zu lösen sind, wird in der Regel „universalistisch“ genannt und – je nach Standpunkt des Kritikers – als überfordernd oder unverbindlich bezeichnet.
Für psychosoziale Berufe, für Pädagogen, Therapeuten und Berater stellt sich damit die Frage, welche Maßstäbe und Ziele sie sowohl an die eigene Arbeit als auch an das Tun all derer anlegen wollen, die ihnen im Erziehungsprozeß überantwortet sind oder die sich ihnen als Leidende oder Ratsuchende anvertraut haben. Damit ist zugleich die Frage nach der beruflichen Verantwortung von Pädagogen, Therapeuten und Beratern als die Frage gestellt, wofür Kinder, Heranwachsende oder Klienten im idealen Fall später Verantwortung übernehmen, d. h. welche Art der Moral sie erwerben sollen.28 Daran zeigt sich, daß mindestens Psychotherapie und professionelle Erziehung insoweit stets am Ende der Leichtigkeit operieren, als beide niemals umhin können, Verantwortung ein- und auszuüben – unabhängig davon, ob sie das beabsichtigen oder nicht. Strittig ist allenfalls, welche Reichweite diese Verantwortung jeweils haben soll. Daß es darauf im Einzelfall keine abstrakte Antwort geben kann, leuchtet ebensosehr ein wie die Vermutung, daß die Reichweite der Verantwortung im Prinzip zu ermessen sein sollte.
Für das Erziehungssystem wird daher vorgeschlagen, sich zur Heilung gesellschaftlicher Übel und Gebresten wieder auf die kleinsten leicht zugänglichen gesellschaftlichen Einheiten zu beziehen, auf Familie und Schule. Wenn überhaupt, so scheint es, konkrete Verantwortung für diese Gesellschaft eingeübt werden kann, dann dort, wo Kinder und Jugendliche zu verantwortungsvollen Bürgerinnen und Bürgern gebildet werden. Nirgendwo wird das Ende der Leichtigkeit so massiv eingeklagt wie im Erziehungsbereich, nirgendwo anders scheinen die libertären Umgangs- und Lebensformen, die ein Ergebnis der Kulturrevolution der späten sechziger Jahre waren, so verhängnisvoll gewirkt zu haben, scheint der Katzenjammer so groß zu sein.29 Die Beunruhigung über jugendliche Neonazis, Drogenabhängige und Vandalismus in Schulen vermengt sich so mit dem Gefühl von Orientierungslosigkeit, an der die Sozialwissenschaften nicht unschuldig seien. Das Einklagen einer allgemeinen erzieherischen Verunsicherung aufgrund des Reflexionsschubs, den das Eindringen erziehungswissenschaftlicher Einsichten in die Lebenswelt von Eltern, Kindern und Schülern verursacht habe, fordert zu der Beschwörung heraus, daß künftig wieder erzogen werden müsse. Darüber hinaus bedienen sich die neuen Erziehungsbefürworter der gerne verwendeten rhetorischen Figur, sich selbst in eine imaginäre Mitte zu plazieren und mögliche, einander ergänzende Extreme zu kritisieren: in diesem Fall den permissiven und autoritären Erziehungsstil. Über deren soziale Positionierung und schichtenbezogene Verteilung lassen sich die neuen Erziehungsbefürworter – unverständlich angesichts einer Fülle von präzisen Forschungsergebnissen, die für im weitesten Sinn auffällige Jugendliche alle auf ein familiär und schulisch durch Leistungsanforderungen30 überstrapaziertes Unterschichtmilieu hingewiesen haben – nur sehr vage aus.31 Die wohlfeile Polemik vor allem gegen die permissive Erziehung gestattet es, den Begriff der „Autorität“ aufzuwerten, ohne autoritär zu wirken, während das in der Sache absolut gerechtfertigte Plädoyer für eine demokratische Erziehung oft keinem anderen Zweck dient, als die konservative Parole „Mut zur Erziehung“ zu assimilieren und eine neue „Autorität“ zu fordern.
Bei dieser Debatte geht es erstens um die pauschale Behauptung einer allgemeinen Verunsicherung von Eltern und Erziehern, Kindern und Jugendlichen, zweitens um die unausgewiesene Rede von „Autorität“ sowie drittens um die unscharfe Rede von „Werten“ und „Werteerziehung“. Daß in bezug auf Erziehungsfragen Verunsicherung herrscht, ist unbestritten. Ob diese Verunsicherung zugenommen hat, könnten wir nur anhand eines Zeitreihenvergleichs beurteilen, für den uns die Vergleichsdaten aus den zwanziger, dreißiger, vierziger, fünfziger und sechziger Jahren fehlen. Wie viele Eltern sich faktisch aus ihrer Rolle als Erzieher zurückgezogen haben, wissen wir nicht. Sogar wenn wir entsprechende Einstellungsuntersuchungen hätten, wüßten wir immer noch nicht, ob sich diese Eltern im Alltag auch tatsächlich so verhalten. Möglich wäre ja immerhin, daß Eltern sich zwar verunsichert fühlen und in reflexiven Situationen meinen, nicht mehr zu erziehen, sich aber tatsächlich sehr wohl erzieherisch verhalten. Da über diesen Fragenkomplex kaum empirische Forschungen vorliegen – nicht zuletzt deshalb, weil klinische Untersuchungen im Alltag von Familien extrem aufwendig sind –, muß hier ein eindeutiges Urteil bis auf weiteres ausstehen. Die wenigen Forschungen, die hierzu vorliegen,32 motivieren dazu, den Strukturen der sozialisatorischen Interaktion mehr zuzutrauen, als es die Befürworter eines jederzeit bewußten Erziehens tun. Obwohl alle möglichen definitorischen Anstrengungen zur Bestimmung des Erziehungsbegriffs vorgenommen werden und immer wieder klargestellt wird, daß eine zeitgemäße Erziehung im wesentlichen im Aushandeln von Bedürfnissen und im Verzicht auf Gehorsam besteht – trotz der klaren Ablehnung autoritärer Erziehungsstile wollen nicht wenige der neuen Werteerzieher unbegründet am Begriff der „Autorität“ festhalten. Dabei ist bezeichnend, daß eine wissenschaftliche Klärung des Begriffs „Autorität“ in aller Regel entfällt. Schlägt man beliebige Lexika auf, so wird man im allgemeinen für den Begriff „Autorität“ Umschreibungen wie etwa „Würde“ und „Ansehen“ finden. Demnach kann es in der Sache nur darum gehen, daß Eltern, die sich im familiären Alltag eines demokratischen Verhaltens befleißigen, aus nicht nur motivationalen Gründen wünschen, von ihren Kindern anerkannt zu werden. Die entscheidende Frage lautet dann, als was sie anerkannt werden wollen: als Personen, denen im Zweifelsfall fraglose Folgebereitschaft gezollt wird, oder als Partner, deren Argumente gehört werden? Geht es um letzteres, ist der Begriff „Autorität“ fehl am Platz, geht es um ersteres, läuft die Polemik gegen den permissiven Erziehungsstil ins Leere. Die Verwendung des Begriffs „Autorität“ verhindert in diesem Zusammenhang lediglich, daß das Paradigma des demokratischen Erziehungsstils zur vollen Entfaltung kommt.
Was heißt endlich Werteerziehung? Die Soziologie unterscheidet schulmäßig zwischen Normen und Werten33 und will damit ausdrücken, daß Normen jene Verhaltensmaßgaben sind, die um der Verwirklichung eines von mehreren Personen für wichtig gehaltenen Gutes willen etabliert worden sind. Gilt etwa persönlicher Respekt als das wünschbare und schützenswerte Gut, so beschreibt „Höflichkeit“ die Normen, die im zwischenmenschlichen, alltäglichen Umgang zu beachten sind. Die schulmäßige Unterscheidung führt zu der Frage, welche „Werte“ in einer menschlichen Sozialität nicht nur faktisch vorfindlich, sondern auch normativ akzeptabel sind. Die Werte „Reichtum“, „sexuelle Attraktivität“, „Liebe zur Heimatgemeinde“, „Vorrang der eigenen Rasse“, „Toleranz“, „Pünktlichkeit“ etc. sind offensichtlich weder gleichermaßen legitim noch gleichermaßen weitreichend. „Werte“ der persönlichen Lebensführung sind einerseits von „Werten“ des öffentlichen Zusammenlebens zu unterscheiden, während andererseits faktische, legale und legitime „Werte“ auseinanderzuhalten sind. Wie weit eine dezentrierte, demokratische Gesellschaft überhaupt noch beliebige „Werte“ verkörpern und durchsetzen kann, ist in politischer Soziologie und Philosophie strittig. Ob der Wertepluralismus und die mit ihm einhergehende Verunsicherung nur ein Desaster oder nicht doch eine große Chance darstellt, ist ebenfalls umstritten. Auf jeden Fall: In Gesellschaften dieses Typs dürften nur noch sehr allgemeine, individuelle Lebensweisen, nicht mehr zensierende „Werte“ allgemein akzeptabel sein: vor allem die Würde des Menschen (einschließlich der entsprechenden rechts- und sozialstaatlichen Sicherungen). Diesen soziologischen Befund unterschlägt die „Wertedebatte“. Letzten Endes schrumpfen in demokratischen Gesellschaften die allgemein als legitim erachteten und deswegen positiv sanktionierten Werte zu minimalen Verfahrensgrundsätzen zusammen. Mehr ist weder möglich noch nötig. Was bleibt, sind Vorschläge zur geregelten Auseinandersetzung über Wertkonflikte. Bedarf also die Motivation von Eltern und Lehrern, die bereit sind, sich in diesem Sinn auf sozialisatorische Interaktionen einzulassen, der Semantik von Ordnung, Verantwortung und Grenzen? Tatsächlich ist davon auszugehen, daß diejenigen, die ohnehin demokratisch und partnerschaftlich erziehen, entsprechende Appelle zustimmend oder nachdenklich zur Kenntnis nehmen werden, während derlei Erklärungen an den Eltern derjenigen Kinder, die als delinquent, verhaltensgestört, gewalttätig oder gar als rassistisch angesehen und behandelt werden, resonanzlos vorüberrauschen dürften. In diesen Fällen, das ist Lehrerinnen und Lehrern ebenso vertraut wie Sozialarbeitern, hilft nur die mühsame Praxis am Arbeitsplatz oder ein politisches Handeln, das die Verstetigung des Unterschichtmilieus mit seinen Überforderungen in der Schule durch radikale Reform überflüssig macht. Dieses Thema – das rückständig gegliederte Schulwesen34 in Deutschland und die Ausbreitung von Armut – interessiert die neuen Wertepolitiker jedoch nicht im mindesten. Wie sollte es auch? Eine gehaltvolle bildungspolitische Diskussion würde den trivialen Konsens im luftigen Bereich der Werte sofort zum Einsturz bringen. So einleuchtend die Rede von der Leichtigkeit des Lebens vor 1989 auch war – am Ende handelt es sich wohl doch nur um eine suggestive Floskel, der in der Sache nur wenig entspricht und die nur deshalb verbreitet wird, um ohne weitere Begründung konservative Ideologien zu propagieren. Der beste Sinn, den wir dem Problem der Leichtigkeit und ihrem vermeintlichen Gegenpart, der Verantwortung, geben können, resultiert in der Frage nach dem richtigen Leben.
Als Resümee kann gelten, daß in komplexen, ausdifferenzierten und pluralistischen Gesellschaften mit konkreten Werten allein nicht auszukommen ist und es mindestens so sehr prinzipieller, eher abstrakter Haltungen und Einstellungen bedarf, etwa der Fähigkeit zur Reflexion, zur Distanz, zum hypothetischen Denken – Eigenschaften, die ich vorläufig als „Tugenden“ bezeichnen möchte. Womöglich läßt sich dem, was als „Leichtigkeit“ kritisiert wird, ja doch noch ein guter Sinn verleihen, womöglich läßt sich die Leichtigkeit sogar rehabilitieren. Denn „Leichtigkeit“ – paradox genug – ist keineswegs einfach zu vollziehen, sondern bedarf der Übung und Disziplin. Im oben beschriebenen Sinn „leicht“ zu leben, bedarf ebensosehr einer Anstrengung wie eines Weges, die Bürde des menschlichen Lebens besser, d. h. distanzierter zu tragen. Die Leichtigkeit scheint den jeweiligen Ancien Régimes unauflöslich anzuhaften – Regimes, unter denen das gute Leben, Leben und Überleben davon abhingen, daß man in Distanz zu seinen Rollen und Lebensentwürfen stand. Die folgenden Zeilen wurden 1910 geschrieben und kommen in einem Drama, in einer Farce vor, die im Ancien Régime, im Österreich der Kaiserin Maria Theresia spielt. Die Hauptfiguren dieses Stücks sind durch gesellschaftliche Zwänge und ökonomische Rücksichtnahmen an der Entfaltung ihres Lebens behindert und versuchen, dies mit Fassung zu tragen. In Richard Strauss’ und Hugo von Hofmannsthals Rosenkavalier bekundet die Marschallin, eine Frau in den Dreißigern, die weiß, daß sie noch am selben Tag von ihrem siebzehnjährigen Geliebten verlassen werden wird, diesem auf seine Treueschwüre:
„Nicht quälen will ich dich mein Schatz.
Ich sag, was wahr ist, sags zu mir so gut wie zu dir.
Leicht will ichs machen dir und mir.
Leicht muß man sein:
mit leichtem Herz und leichten Händen,
halten und nehmen, halten und lassen …
Die nicht so sind, die straft das Leben und Gott
erbarmt sich ihrer nicht.“35
Die Leichtigkeit des Seins, mit leichtem Herzen halten und nehmen, das scheint für pädagogisches Handeln nicht selbstverständlich zu sein. Auch Selbstaufforderungen, Dinge mit Gelassenheit zu vollziehen, verweisen nur darauf, daß Menschen meist dem, was sie tun, zutiefst, ja zu sehr verhaftet sind. Diese Bindung, die jede Leichtigkeit zu einer enormen Anstrengung macht, resultiert daraus, daß Bildung und Erziehung allem aufklärerischem Wollen zum Trotz weniger eine Frage intellektueller Einsicht denn affektiver Bildung sind.
Diesen Gedanken versuche ich in den folgenden zwölf Kapiteln darzulegen. Dabei geht es zunächst um einen der antiken Philosophie entnommenen, erneuerten Begriff der menschlichen Natur, der in normativer Hinsicht auf eine Alternative zu Pflicht- und Nützlichkeitsmoralen, nämlich auf eine Tugendethik zielt. Das zweite Kapitel sucht den hier vorgestellten Begriff der Tugend durch eine Reflexion auf sein Gegenteil, das Laster, zu schärfen. Auch eine erneuerte Theorie der menschlichen Natur kann freilich, zumal wenn es ihr um die tragende Rolle der Gefühle beim Entstehen von Moralität geht, die Ergebnisse einer Naturwissenschaft vom Menschen, wie sie seit Darwin vorliegt, nicht vernachlässigen. Das dritte und das vierte Kapitel erläutern die moralische Funktion von Gefühlen und plädieren für eine evolutionsbiologische Perspektive. Im fünften, sechsten und siebten Kapitel, die Platon, Aristoteles und Luhmann konfrontieren, geht es zunächst um den Nachweis, daß die Vernachlässigung der Gefühle in der Bildungstheorie Ergebnis einer bewußten, zweieinhalbtausend Jahre alten Verdrängung ist und daß eine Theorie der Bildung und Erziehung nur auf den Lebenslauf im ganzen bezogen entwickelt werden kann. Ohne einen Begriff vom „Glück“ ist das freilich unmöglich, wie Aristoteles gezeigt hat. Im siebten Kapitel weise ich dann nach, daß die systemtheoretische Umformulierung des Bildungsproblems mißlingen muß und warum die von Luhmann süffisant als „alteuropäisch“ bezeichneten humanistischen Überlegungen nach wie vor aktuell sind. Das achte und neunte Kapitel entfalten schließlich das Verhältnis von Tugend, Bildung und Charakter im einzelnen. Ein gutes, tugendhaftes Leben verharrt jedoch nicht im Privaten. Im zehnten, elften und zwölften Kapitel will ich zunächst zeigen, warum ein lange Zeit in der Pädagogik vernachlässigter Begriff, der der „Freundschaft“, unerläßlich ist, um das Bildungsgeschehen nicht nur zu begreifen, sondern auch zu befördern. Im Begriff der „Freundschaft“ liegt zugleich das Modell einer Lebensform vor, auf deren Basis eine normativ gehaltvolle politische Organisation, die Demokratie, pädagogisch bedeutsam wird.
I.Menschliche Natur und Tugendethik
Mit dem Hinweis auf affektive Bildung steht die Frage nach dem Verhältnis von Herz und Verstand, von Kognitionen und Affekten in individuellen und kollektiven Bildungs- und Lernprozessen im Zentrum, mehr noch: die Frage nach Bildsamkeit und Bildbarkeit und damit das Problem der moralischen Gefühle. Denn wie soll eine lebbare Moral greifen, wenn Menschen zu ihr nicht von Natur disponiert sind? Die abendländische Tradition verstand Erziehungsprozesse von Beginn an in einem engen und zugleich weiterführenden Verhältnis zur Natur. In ihren Anfängen war dieser Tradition ein anderes Verhältnis von Natur und Kultur gewärtig als der europäischen Moderne seit der Aufklärung. Sie kennt „Natur“ nur noch als einen Bereich kausal wirkender Notwendigkeiten, während sich der Bereich der „Kultur“ – ganz untragisch – mehr oder minder als Feld freien menschlichen Handelns offenbarte. Ein Rückgang auf die Antike freilich zeigt, daß diese Dichotomie weder sinnvoll noch notwendig ist1 Spätestens bei Aristoteles läßt sich lernen, daß man sinnvoll zwischen erster und zweiter Natur unterscheiden kann. Auffällig ist, daß dieser Begriff bzw. die Problematik einer zweiten Natur stets im Zusammenhang mit Bildung und Tugend erörtert wird: „Die Tugenden entstehen in uns“, so Aristoteles, „also weder von Natur noch gegen die Natur. Wir sind vielmehr von Natur dazu gebildet, sie aufzunehmen, aber vollendet werden sie durch die Gewöhnung.“2 Dabei war Aristoteles keineswegs der erste, dem das quasi-natürliche Wesen menschlicher Verhaltensbereitschaften auffiel: „Die Natur und die Erziehung“, so ein Zeitgenosse des Sokrates, der Atomist Demokrit, „kommen einander gleich. Denn auch die Erziehung formt den Menschen um, und indem sie umformt, schafft sie Natur.“3
Diese Überlegung verdichtet sich bei Platon und Aristoteles in dem Gedanken, daß insbesondere menschliche Gewohnheiten zu Natur werden, mehr noch: daß am Ende – so der hellenistisch-jüdische Philosoph Philo – andauernde Gewohnheit stärker sei als Natur. Spätestens in der lateinischen Klassik, bei Cicero, wird dann der Begriff einer anderen, einer zweiten Natur explizit artikuliert: „consuetudine quasi alteram quandam naturam effici“ – „daß durch Gewohnheit gewissermaßen eine andere Natur hervorgebracht wird.“4
Da tote Gegenstände keine Gewohnheiten ausbilden, kann sich das, was hier als „andere Natur“ bezeichnet wird, sinnvollerweise nur auf lebende Organismen, zu denen auch die Angehörigen der menschlichen Gattung zählen, beziehen. Freilich fällt auf, daß Cicero noch zögert; in der zitierten Passage aus seiner Schrift über die höchsten Güter spricht er von einer „gewissermaßen anderen Natur“ und trifft damit eine Unterscheidung. Beinahe zweitausend Jahre später nimmt der Begründer der modernen Pädagogik, Jean-Jacques Rousseau, derlei Gedanken auf, wenn er in seinem Diskurs über die Ungleichheit der Menschen aus dem Jahr 1755 schreibt:
„Ich sehe in jedem Tier nur eine kunstreiche Maschine, der die Natur Sinne gegeben hat, um sich selbst wieder aufzuziehen und bis zu einem gewissen Grad gegen alles zu schützen, was sie zerstören oder in Unordnung bringen könnte. Genau das gleiche stelle ich an der menschlichen Maschine fest, nur mit dem Unterschied, daß bei den Bewegungen der Tiere die Natur alles tut, während der Mensch bei den seinen mithilft, insofern sein Wille frei ist.“ Im französischen Originaltext steht für das hier mit „mithilft“ übersetzte Verb „concourt“, das vielleicht genauer mit „mitwirkt“ zu übersetzen wäre. „Jenes“, so fährt Rousseau fort, „wählt oder verwirft mit Instinkt, dieser durch einen Akt der Freiheit, woraus sich ergibt, daß das Tier nicht den ihm vorgeschriebenen Gesetzen entgehen kann, selbst wenn es zu seinem Vorteil wäre, und daß der Mensch sich oft zu seinem Schaden davon entfernt.“5
Das ist die Fähigkeit der Menschen, sich willentlich und frei zu ihrer (ersten) Natur zu verhalten und dabei eine zweite, eine charakterliche Natur zu schaffen. Diese zweite, anerzogene und gebildete Natur entfaltet sich in Zuständen „eines Charakters, dessen Träger im Hinblick auf einen bestimmten Bereich von Verhaltensfragen zu richtigen Antworten gelangt“6 Diese Charakterzustände lassen sich als „Tugenden“ bezeichnen. Um sie besser zu verstehen, ist zu klären, wie menschliche Charaktere, d. h. die je nachdem tugend- oder laster haften, dauerhaften Prägungen und Neigungen eines Menschen entstehen bzw. welches ihre Bestandteile sind. Wenn der Charakter Ausdruck, ja sogar Inbegriff der zweiten Natur ist, diese aber wesentlich durch Gewohnheitsbildung entsteht, und wenn bestimmte Charakterzüge deshalb als „tugendhaft“ ausgezeichnet sind, weil sie es Menschen ermöglichen, bestimmten normativen Ansprüchen zu genügen, dann setzt dies zugleich eine bestimmte Empfänglichkeit dafür voraus, was in gegebenen Situationen zu tun ist. Tugenden basieren mithin auf intelligenten Empfindsamkeiten für eigene und andere Befindlichkeiten, auf Sensitivitäten, genauer gesagt: eine einzige Sensitivität, „die ihrerseits nichts anderes ist als die Tugend überhaupt, also eine Fähigkeit, die von Situationen an das Verhalten gestellten Forderungen als solche zu erkennen.“7
Es geht also um intelligente Gefühle bzw. „eine einzige komplexe Form der Sensitivität“, die zugleich eine moralische Sichtweise begründet. Demnach beruhen Tugenden mindestens so sehr auf affektiven Haltungen, wie sie in kognitive Fähigkeiten münden. Freilich können es kaum alle affektiven Haltungen sein, die zu tugendhaften Charakteren disponieren. Die zweite, in einer bestimmten normativen Form gebildete menschliche Natur resultiert damit aus einer spezifischen Art der Affektbildung, wenn man so will aus einer „éducation sentimentale“8 Ein Verständnis der Tugend, der Tugenden erheischt demnach eine Entschlüsselung des moralischen Charakters von Gefühlen im Lauf des menschlichen Lebens. Dies war das Programm Rousseaus, der in seinem Emile eine Bildung zur Liebe als Basis moralischen Verständnisses forderte.
„Seine ersten Zuneigungen“, so Rousseau über den jungen Menschen, „sind die Zügel, mit denen man all seine Bewegungen lenkt; er war frei, und ich sehe ihn unterworfen. Solange er nichts liebte, hing er nur von sich selbst und von seinen Bedürfnissen ab. Auf diese Art werden die ersten Bande gebildet, die ihn mit Wesen seiner Art vereinigen. Wenn er seine erwachende Empfindsamkeit auf sie richtet, so glaube man nicht, daß sie gleich anfangs alle Menschen umfaßt und daß das Wort Menschengeschlecht ihm etwas bedeutet. Nein, diese Empfindsamkeit wird sich zunächst auf seinesgleichen beschränken, und seinesgleichen werden keine Unbekannten für ihn sein, sondern diejenigen, mit denen er Verbindungen hat, diejenigen, welche ihm die Gewohnheit lieb und notwendig gemacht hat, diejenigen, welche augenscheinlich ebenso denken und empfinden wie er, diejenigen, die er den gleichen Leiden, die er gelitten hat, ausgesetzt sieht und die für die gleichen Freuden, die er genossen hat, empfänglich sind – mit einem Worte, diejenigen, bei denen die natürliche Gleichheit augenfälliger ist und ihm eine größere Neigung zu lieben gibt.“9
Die auf der Basis identifikatorischer Prozesse stattfindende affektive Bindung Gleichartiger führt zu einer partikularen Solidarität, die die notwendige Bedingung zur Ausbildung einer universalistischen Moral hier und einer entfalteten Individualität dort ist, die sich im Prozeß ihrer Herausbildung wechselseitig bedingen. Rousseau fährt fort: „Er wird erst nachdem er sein Naturell auf tausenderlei Art entwickelt hat, erst nach vielen Betrachtungen über seine eigenen Gefühle und über diejenigen, die er an anderen beobachten wird, dahin gelangen, daß er seine einzelnen Vorstellungen unter dem abstrakten Begriff der Menschheit verallgemeinert und seinen besonderen Neigungen diejenigen hinzufügt, durch die er sich mit seiner Art zu identifizieren vermag.“10