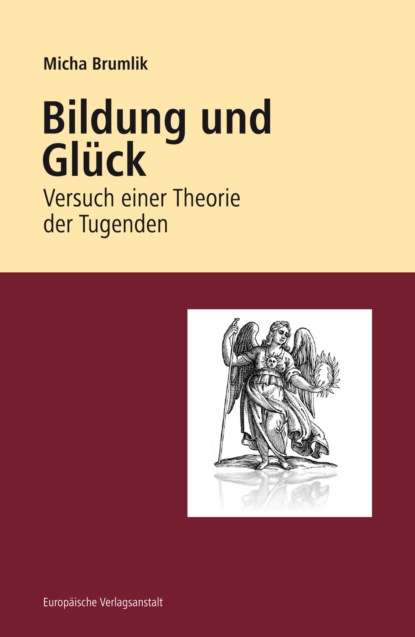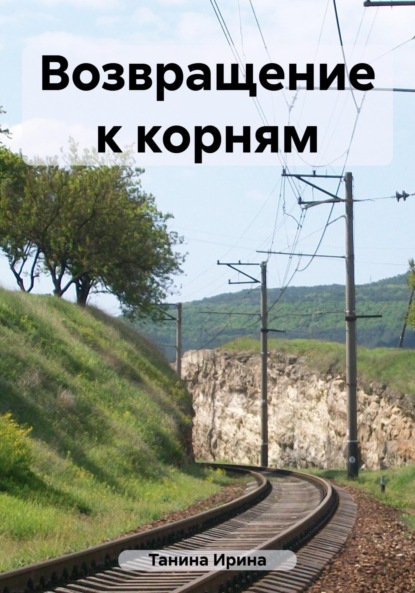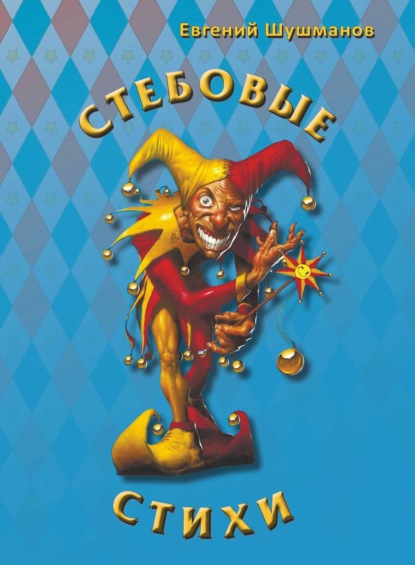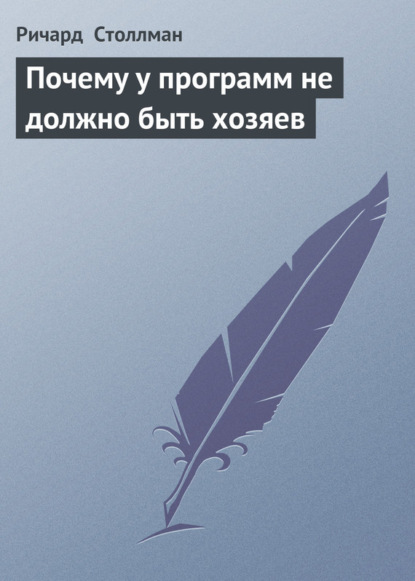- -
- 100%
- +
Dabei rechnet Rousseaus pädagogische Anthropologie stets mit einem angeborenen Egozentrismus, einer Eigenliebe, der in seiner „natürlichen“ Form als „Selbstliebe“ – „amour de soi“ bezeichnet wird und in seiner denaturierten Form in „Eigenliebe“ – „amour propre“ umschlägt. Grundsätzlich äußert sich auch in geistigen und moralischen Interessen, die in den Haltungen der Tugend ihren Ausdruck finden, eine Art der „Selbstliebe“. Geistige und moralische Interessen beziehen sich „allein auf uns selbst, auf das Wohl unserer Seele, auf unser absolutes Wohl. Es ist ein Interesse, das wesentlich mit unserer Natur zusammenhängt und deshalb auf unser wirkliches Glück gerichtet ist.“11
Damit hat Rousseau, der sich in seiner politischen Theorie als Erbe wesentlicher römischer Traditionen verstanden hat,12 den von der antiken Philosophie postulierten Zusammenhang von Tugend und Selbstliebe wieder aufgenommen – eine Thematik, die die moderne Moralphilosophie zerrissen hat und die derzeit erneut auf der Agenda steht. Freilich scheint die Aufnahme von Kategorien des aufgeklärten Eigeninteresses in eine Theorie der Moral der Moderne fremd – allenfalls in Begründungsdiskursen formal universalistischer Moralen wie in John Rawls’ Theorie der Gerechtigkeit soll ein prudentialer Diskurs eine eher methodologische Funktion übernehmen13 Hinter dieser Nichtberücksichtigung des Eigeninteresses in einer modernen Theorie der Moral steht ein massives moralisches und methodisches Problem, das erst in letzter Zeit aufgefallen ist und seither systematisch bearbeitet wird14 Ellen Key forderte in einer Radikalisierung von Rousseaus Sentimentalismus, daß „eine neue Menschheit hervorgeliebt werden“ solle, und nahm damit das antike Thema einer perfektionierenden Bildung wieder auf, nachdem Christentum und Aufklärung entweder auf Erziehung als Normierung oder auf Bildung zur Mündigkeit setzten.
Der Perfektionismus ist eine ethische Theorie, die als höchstes Gut allen menschlichen Lebens die Selbstvervollkommnung ansieht. Theorien der Perfektionierung und vor allem der Selbstperfektionierung, die vermeintlich unablösbar der Gedankenwelt der Antike angehören, sind in den letzten Jahren nicht nur im Rahmen etwa der humanistischen Psychologie wiederbelebt worden, sondern auch und gerade in der Philosophie, und zwar besonders in ihrem angelsächsischen, dem sprachanalytischen Vorgehen verpflichteten Strang. Daß es dazu einer Wiederbesinnung auf das US-amerikanische, das pragmatistische Erbteil bedurfte, kommt nicht von ungefähr. Ralph Waldo Emerson, der zum wesentlichen Anreger für die Arbeiten von Stanley Cavell15 wurde, war nicht nur eine Quelle für Friedrich Nietzsche, sondern kann selbst als Erneuerer des Tugenddiskurses16 gelten. In Rawls’ Theorie der Gerechtigkeit findet sich in den späteren, seltener gelesenen, aber systematisch unerläßlichen Kapiteln eine entfaltete Theorie des guten Lebens, die in unterschiedlicher Form z. B. in die neuere politische Philosophie, etwa multikultureller Gesellschaften, eingegangen ist17 Ohne eine Theorie des Guten als des Vernünftigen ginge Rawls das Problem, das er mit seiner Theorie der Gerechtigkeit lösen wollte, verloren. Schließlich hat Alan Gewirth eine umfassende, systematische Arbeit zur Frage menschlicher Selbstentfaltung vorgelegt, die bei aller Strenge der Terminologie doch jenen existentiellen Kern freilegt, um den es aller Ethik geht. Spätestens mit dieser Untersuchung,18 aber auch nach neueren deutschen Beiträgen zu einer „Philosophie der Lebensgeschichte“,19 dürfte denn auch deutlich werden, daß die Versuche der Theorie autopoietischer Systeme, Biographien ohne ein Moment teleologischer Narrativität verstehen zu wollen, aus systematischen Gründen zum Scheitern verurteilt sind.
Die neuere philosophische Diskussion unterscheidet terminologisch zwischen Ethik und Moral, zwischen teleologischen und deontologischen, zwischen Güter. und Pflichtethiken. Moralische Theorien sind Theorien, die das, was allen Menschen unbedingt geboten ist, ermitteln wollen. Das sind in aller Regel unparteiisch eingeführte Gerechtigkeitsgrundsätze, d.h. Prinzipien für eine angemessene Verteilung von Gütern und Übeln. Der „moral point of view“20 zeichnet sich – wie die Allegorie der Gerechtigkeit – dadurch aus, daß er bestimmten Interessen gegenüber systematisch blind ist. Auch Güterethiken interessieren sich für das, was allen Menschen gemein ist. Im Unterschied zu Pflichtethiken und im Unterschied zur Moral geht es ihnen aber nicht um die Frage, was unbedingt gerecht und daher geboten ist, sondern um die Frage, zu welchem Zweck Menschen überhaupt leben. Erst Güterethiken können (vielleicht) eine Frage beantworten, vor der die Moral in ihrem eigenen Bezugssystem verstummen muß: Warum soll ich überhaupt im Hinblick auf Gerechtigkeit handeln, warum überhaupt irgendwelchen Pflichten folgen? John Rawls, dessen begriffliche Mittel in diesem Kontext zureichen, unterscheidet zwei Formen des Perfektionismus. Ein Perfektionsprinzip sei in seiner strengen Lesart „der einzige Grundsatz einer teleologischen Theorie, die die Gesellschaft anweist, Institutionen, Pflichten und Verpflichtungen so festzulegen, daß die menschlichen Errungenschaften auf dem Gebiet der Kunst, Wissenschaft und Kultur maximiert werden.“21 Der von Rawls als Alternative erwogene gemäßigte Perfektionismus nimmt ein Perfektions- prinzip hingegen nur als ein Prinzip unter mehreren, das im Vergleich zu diesen sorgfältig abzuwägen sei.
Die sicherlich radikalste und bekannteste Variante des Perfektionismus findet sich im Werk Friedrich Nietzsches und seiner Idee vom Übermenschen, von der „blonden Bestie“ gar, eine Theorie, die keineswegs nur mißverständlich zum Hintergrund des europäischen Faschismus und Rassismus gehört. Daß Richard Strauss’ Tondichtung „Zarathustra“ Stanley Kubricks Film „2001“ an entscheidender Stelle instrumentiert, ist keiner effekthaschenden Absicht zuzuschreiben, sondern dem philosophischen Grundgedanken dieses Films, der mit dem Aufstieg des Menschen aus der Lebensform von Voraffen beginnt, um nach einer langen Weltgeschichte in einem kosmischen Baby zu enden: In der von Kubrick inszenierten überwältigenden Bilderwelt wird die Geschichte der Menschheit als Übergangsgeschehen dargestellt, gerade so, wie Nietzsche Kants Gedanken des Menschen als eines Selbstzweckes dementierte und damit auch in der Moralphilosophie einer radikalen Moderne zum Durchbruch verhalf: „Der Mensch ist ein Seil, geknüpft zwischen Thier und Übermensch, – ein Seil über einem Abgrunde. […] Was groß ist am Menschen, das ist, daß er eine Brücke und kein Zweck ist: was geliebt werden kann am Menschen, das ist, daß er ein Übergang und ein Untergang ist […]. Es ist an der Zeit, daß der Mensch sich sein Ziel stecke. Es ist an der Zeit, daß der Mensch den Keim seiner höchsten Hoffnung pflanze.“22
Systematisch widerruft Nietzsche in dieser Passage einen zentralen Lehrsatz der Moral der Aufklärung, nämlich Kants in der Metaphysik der Sitten ausgeführtes Prinzip, nach dem „der Mensch sowohl sich selbst als auch anderen Zweck“ ist und er daher „weder sich selbst noch andere als Mittel zu brauchen befugt ist, […] sondern den Menschen überhaupt sich zum Zwecke zu machen ist an sich selbst des Menschen Pflicht.“23
Und so läßt sich fragen: Wenn der Mensch kein Zweck ist, was ist dann überhaupt ein Zweck? Wenn der Mensch eine Brücke ist, dann ist er ein Mittel; offen bleibt lediglich die Frage, wozu? Und wenn es einen Zweck gibt, zu dem der Mensch ein Mittel ist, worin besteht dieser Zweck dann und wer setzt ihn sich in einer Welt nach dem Tode Gottes, die keine metaphysischen Vorgaben mehr kennt? Nach Nietzsche kann es nicht anders sein, als daß der Mensch sich selbst zum Mittel seiner Selbstüberwindung macht und sich ein Ziel steckt, das höher als er selbst ist. Welches wäre der Maßstab, anhand dessen sich bemißt, was höher und was niedriger ist? Für Nietzsche ist dieser Zweck der Übermensch, der ebenso Inbegriff wie reale Möglichkeit wahrer Individualität und überbordender Kreativität ist. Beider Entfaltung aber setzt die Befreiung von den undurchschau- ten Fesseln der Moral voraus. Diese Lehre hat vor allem in der von Nietzsches Schwester überlieferten Form eine rassistische und sozi- aldarwinistische Lesart erhalten, die nachvollziehbare Spuren bis in den tödlichen Rassenwahn der Nationalsozialisten gelegt hat24 Man beraubt sich jedoch aller Erkenntnischancen, wenn man bei der Lektüre Nietzsches vor allem diese eine Folgegeschichte in den Blick nimmt – wie man sich auch aller Erkenntnischancen beraubt, wenn man als hermeneutischen Schlüssel für das Werk von Karl Marx den Stalinismus nimmt. Die moderne Pädagogik, die mit dem Jahrhundert des Kindes ihren Anfang nahm, erweist sich nicht nur in der deutschen Reformpädagogik als zutiefst nietzscheanisch.
Im Werk von Ellen Key finden wir eine Lektüre und Entfaltung von Nietzsches Ideen, die die Fruchtbarkeit dieses Denkens sehr viel deutlicher werden lassen. Ellen Key, daran ist ein redlicher Zweifel kaum möglich, war eine Darwinistin, die den „Kampf ums Dasein“ sublimieren wollte und die bedauert, daß es bisher nicht gelungen sei, „dem Kampfe ums Dasein edlere Formen zu verleihen“25 Key war fest von der Unabgeschlossenheit, vom fortwährenden Werden des menschlichen Wesens überzeugt26 und zog aus dem Faktum der Evolution den Schluß, daß dort, wo es bereits eine Höherentwicklung gegeben hat, auch eine weitere Höherentwicklung möglich, wenn nicht gar wünschenswert sei27 Es ist diese, von Darwin und Galton unterschiedlich verstandene Evolutionstheorie, die in Verbindung mit einer Tugendethik, d. h. einer Ethik, die als ihr höchstes Kriterium die Heranbildung edler Charaktere sieht,28 die Pädagogik zur Wissenschaft macht: „Erst wenn man die Erziehung des Kindes auf die Gewißheit gründet, daß Fehler nicht versöhnt oder ausgelöscht werden können, sondern immer ihre Folge haben müssen, aber gleichzeitig auf die Gewißheit, daß sie in einer fortgesetzten Evolution umgewandelt werden können, durch langsame Anpassung an die umgebenden Verhältnisse, erst dann wird die Erziehung anfangen, Wissenschaft, Kunst zu werden.“29
Damit zielt Ellen Key auf eine durch wissenschaftliche Erziehungskunst gesteuerte Evolution der Gattung, die aber nicht – wie man meinen könnte – Entwicklung als Selbstzweck, als Religion30 ansieht, sondern als Unterpfand des Glücks: „Für das Kind wie für den Erwachsenen gilt Goethes Wort, daß Glück die Entwicklung unserer Fähigkeiten ist.“31 „Unsere Fähigkeiten“ jedoch äußern sich im kindlichen Egozentrismus und Egoismus und das heißt auch in seinen Gefühlen, die für Key ohnehin der deutlichste Indikator für Individualität sind32 Das Gesetz der Individuierung gilt so als Gesetz der kleinen Abweichung vom Typus, als Erfüllung der gattungsbezo- genen Anpassungsleistung durch die Freigabe und Förderung individueller Macht33 Key verbindet schließlich – in einer systematisch überhaupt nicht, aber praktisch überzeugenden Weise – die antike Tugendethik der Heranbildung edler, glücksfähiger und glücklicher Charaktere mit einem ganz und gar modernen Gedanken: der Überzeugung vom Wert des Neuen als eines Selbstzwecks. „Die noch weiterlebenden Instinkte des Affen“, so führt sie in einer anthropologischen Nebenbemerkung aus, „verdoppeln beim Menschen die Wirkung des Erblichkeitsgesetzes, und der Konservativismus ist daher bis auf weiteres in der Menschenwelt stärker als das Streben, neue Arten hervorzubringen. Aber dieses letztere ist das Wertvollste.“34
Es dürfte deutlich geworden sein, wie weit sich Key in den Spuren Nietzsches von jeder herkömmlichen normativen Pädagogik entfernt und sich zwei Leitvorstellungen verschrieben hat, die von Christentum und Kantianismus gleichermaßen entfernt sind, ohne doch bedacht zu haben, ob und inwieweit diese Leitvorstellungen miteinander verträglich sind: hier das individuelle Glück, dort das Entstehen neuer Arten von Menschen. Ein Rückblick auf die klassischen, die antiken Theorien des Glücks, von Platon über Aristoteles bis hin zu den Epikuräern und Stoikern, würde sofort ergeben, daß sie alle von einer mehr oder minder konstanten Natur des Menschen und seiner Stellung im Kosmos ausgegangen sind und daher „Glück“ als eine Erfüllung menschlicher Wesensmöglichkeiten, nicht aber deren Neuerschaffung oder Neuerfindung verstehen. Auch die Ethiken des christlichen Abendlandes vertreten diese Auffassung, und noch Immanuel Kant hängt ihr in Teilen an. Sogar die nachidealistische Philosophie, namentlich bei dem christlichen Philosophen Kierkegaard und dem Aristoteliker Marx, zehrt von der Annahme einer gegebenen menschlichen Natur, hier in der Annahme ihrer konstitutiven Mangelhaftigkeit und Sündhaftigkeit, dort im Vertrauen auf ihre durch Praxis erreichbare Perfektibilität. Es war in der Tat erst Friedrich Nietzsche, der dieses – seit der Antike auch das Nachdenken über die Erziehung dominierende – Deutungsmuster außer Kraft gesetzt hat: An die Stelle eines Erfüllens vorgegebener und beschreibbarer Möglichkeiten des Menschen tritt jetzt der Gedanke seiner Neuerschaffung und mehr oder minder beliebigen Plastizität, eine Problematik, an der sich die philosophische Anthropologie von Scheler über Gehlen bis zu Plessner, von Mead über Foucault bis zu Judith Butler noch heute abarbeitet. Tatsächlich liegt die Exposition des Problems bereits in Immanuel Kants Anthropologie in pragmatischer Hinsicht mit all seinen Dilemmata vor. Die Modernität dieser Exposition besteht zum einen in der schroffen und strikten Zurückweisung einer jeden transzendenten Sinnbestimmung des menschlichen Lebens und zum anderen im ebenso konsequenten Blick auf die nur naturwissenschaftlich leistbare Erklärung dieses Lebewesens: „Eine Lehre von der Kenntnis des Menschen, systematisch abgefaßt (Anthropologie), kann es entweder in physiologischer oder in pragmatischer Hinsicht sein. – Die physiologische Menschenkenntnis geht auf die Erforschung dessen, was die Natur aus dem Menschen macht, die pragmatische auf das, was er als frei handelndes Wesen aus sich selber macht, oder machen kann und soll.“35
Nietzsche beerbt Kant in systematischer Hinsicht darin, daß er – wie anfangs angedeutet – Kants Lehre vom Menschen als des Menschen Zweck in normativer Hinsicht aufgibt, in explanativer Hinsicht jedoch radikalisiert und damit alle bisherige Anthropologie auf den Kopf stellt. Indem Nietzsche eine Philosophie am „Leitfaden des Leibes“ fordert und damit die bisherige Verankerung des Selbst aus dem eng umgrenzten Bezirk des Bewußtseins löst, visiert er eine Perspektive an, in der das Geistige nur noch als die Zeichensprache des Leibes gilt. Das Streben nach Glück, das sich in dieser Perspektive auslegt, erweist sich dann als das dem Bewußtsein oftmals unzugängliche Streben des Leibes nach Höherbildung, einer Höherbildung, die nicht mehr moralischen, sondern nur noch ästhetischen Kriterien folgt. Auch auf diesem Weg folgt Key ihrem Lehrer Nietzsche: „Die neue Sittlichkeit […] nimmt Humanismus wie Evolutionismus in sich auf. Sie ist von dem monistischen Glauben an Seele und Körper als zwei Formen desselben Seins bestimmt; von der Überzeugung des Evolutionismus, daß das psycho-physische Wesen des Menschen weder gefallen noch vollkommen, doch der Vervollkommnung fähig ist: daß es bildbar ist, gerade weil es konstitutiv noch nicht fertig ist.“36
Key hatte – anders als Nietzsche – einen scharfen Blick für die intersubjektivitätsbezogenen Komponenten der menschlichen Leiblichkeit, sprich für Sexualität und Erotik. Sie hatte erkannt, daß Nietzsche von der Liebe nichts wußte, „weil er vom Weibe nichts weiß“,37 und war bemüht, seine ihrer Auffassung nach zureichende Theorie der Elternschaft und ihrer Bedeutung durch eine Theorie der Erotik zu ergänzen, die durch verantwortungsvolle Elternschaft jenseits aller konventionellen Moral und eugenische Umsicht zu einer Höherentwicklung der Menschheit führen wird. An dieser Schnittstelle konvergieren dann die beiden scheinbar widersprüchlichen Imperative individuellen Lebensglücks und gattungsbezogener Höherentwicklung und schießen zu einem neuen Glauben, einer diesseitigen Liebesreligion zusammen: „Die Bekenner dieses Glaubens wollen die geschlechtlichen Gefühle und Handlungen des einzelnen durch die Liebe bestimmen, vor allem weil sie glauben, daß das Glück des einzelnen die wesentlichste Bedingung auch für die Lebenssteigerung der Menschheit ist. Sie wollen die Erde mit Glückshungernden erfüllen, weil sie wissen, daß nur so das Erdenleben seinen innersten Willen erreicht, nämlich – in einem ganz neuen Sinne – Ewigkeitsmenschen zu bilden. Das Wort, das durch Eros Fleisch und Blut wurde und in uns lebt, ist das tiefste von allen: ‚Freude ist Vollkommenheit.‘ Wenn wir in diesem Wort Spinozas die höchste Offenbarung vom Sinn des Lebens empfangen, öffnet sich der Blick auch für den Zusammenhang des Daseins. Wir sehen ein, daß das vollkommenere Geschlecht im vollsten Sinn des Wortes hervorgeliebt wird.“38
Der Wille des Erdenlebens – Key präzisiert nicht, ob darunter nur das menschliche Leben zu verstehen sei – bestehe darin, „Ewig- keitsmenschen“ zu bilden, womit Nietzsches radikaler Modernismus mit seinem Glauben an die konstitutive, willkürliche Offenheit des Menschen aufgegeben und einer naturwissenschaftlich erweiterten Form des antiken Perfektionismus das Wort geredet wird. Allen Erschütterungen der Moderne zum Trotz gewinnt der Kosmos hier im ganzen nun wieder genau den Sinn, den er in der griechischen und biblischen Religion auch schon hatte. Obwohl es Key gelingt, die vermeintliche Widersprüchlichkeit von individuellem Glücksanspruch und gattungsbezogener Höherbildung zu überwinden, bleibt die Kluft zwischen zwei axiologischen Prinzipien, dem individuellen Glück und dem Selbstwert des Neuen, bestehen. Diese Spannung sollte ihren Niederschlag dort finden, wo nietzscheanische und dar- winistische Gedanken eine radikal emanzipatorische Politik instrumentierten – ein Einsatz, der heute kaum noch nachzuvollziehen ist.
Die systematische Wiederaufnahme der Kategorie des Eigen- interesses aber führt gegenwärtig auf der Linie von Aristoteles zu Rousseau direkt zur Neuformulierung einer Ethik der Tugenden39 Der Verdacht, daß diese Renaissance sowohl in der Sache als auch in der Wahl ihrer Begriffe zu Regressionen führt, scheint dabei nicht unbegründet40 „Tugend“ – dieser Begriff weckt einerseits unangenehme Erinnerungen an eine muffige Sexualmoral und provoziert andererseits aufgeklärte Distanz zu einem schönheitstrunkenen Übermenschentum. „Tugenden“ – das scheinen Charaktereigenschaften zu sein, die als Gewissen in erzwungene Jungfräulichkeit oder als „virtú“41 in selbstsüchtiges Haschen nach Ruhm münden. Diese Assoziationen treffen zu und verfehlen doch die Sache, um die es geht.
Um den Mißkredit, in den die Tugenden und ihre Theorie geraten sind, richtig zu verstehen, ist es unerläßlich, jene Zeit in den Blick zu nehmen, als sie erstmals veraltet schienen. Dieses Veralten hat seinen Ausdruck nicht zufällig in einer Kunstform gefunden, die wie keine andere der Artikulation der Leidenschaft dient – der Oper. Ihre Geschichte beginnt mit Jacopo Peris inzwischen verlorengegangener „Dafne“, die vor mehr als vierhundert Jahren 1597/98 in Florenz uraufgeführt wurde und dem Zweck diente, eine zeitgemäße Wiedergeburt der antiken Tragödie in der Sprache der Musik zu inszenieren. Mit dem musikalischen Werk des Mantovaner Hofmusikers Claudio Monteverdi erreichte die Gattung gleich zu Beginn ihren ersten Höhepunkt und zeichnete die Linien für alle künftige Entwicklung vor. Seither kreist die Oper um zwei Themenbereiche, um Liebe und Politik42 In der im Jahr 1607 uraufgeführten Oper „Orfeo“ nimmt sich Monteverdi des Mythos von der den Tod überwinden wollenden, aber darin scheiternden Liebe an, während die 1643 uraufgeführte „Krönung der Poppäa“ Liebe und Leidenschaft als Instrumente zur Erhaltung und Sicherung von Macht zeigt. Der Prolog zu dieser Oper besteht aus einem Dialog zwischen fortuna, virtu und amore, zwischen Glück, Tugend und Liebe.
„Deh, nasconditi o virtu, gia caduta in poverta“ – „Ach verbirg dich o Tugend“, hält die Allegorie des Glücks der Tugend entgegen, „die du längst in Armut gefallen bist, Gottheit, an die keiner glaubt, Gottheit ohne Tempel, Gottheit ohne Gläubige und Altäre, davongejagt, unzeitgemäß, verabscheut, unerwünscht“ – „…dissipata, dis- susata, aborrita, mal gradita.“ Die Tugend beschimpft in ihrer Antwort das Glück, jenes niedriggeborene, vor allem den Dummen holde Wesen, um sich selbst als ein reines unbestechliches Wesen zu preisen, das Gott vergleichbar sei. Beider Konkurrenz wird schließlich durch den Machtspruch des Gotts der Liebe, Amors, geschlichtet, der beide zu besiegen ankündigt und darauf wettet, daß die Welt allein durch seinen Wink verändert werde. Der Tugend, so wie sie in Monteverdis Oper auftritt, eignet von Anfang an ein belehrendes, pädagogisches Element: „Io sogn la tramontana, che sola insegno agl’intelletti humani l’arte del navigar verso l’Olimpo“ – „Ich allein bin der Nordwind, der den menschlichen Geist die Kunst lehrt, zum Olymp zu schiffen.“
Die „Tugend“ – handelt es sich bei ihr um eine Größe, die schon vor 350 Jahren in der norditalienischen Renaissance in ihrem unheilbaren Pädagogisieren als veraltet gelten mußte? Von welcher Art der Tugend ist in Monteverdis Oper die Rede? Die Tugend, die hier im Wettstreit mit Glück und Liebe unterliegt, repräsentiert eine bestimmte, stoische Ausprägung des Tugendbegriffs. Die Stoa ist eine der fünf auf Sokrates, Platon und Aristoteles folgenden philosophischen Positionen der späteren Antike: Skepsis, Atomismus, Epikuräismus, Kynismus und eben Stoizismus stellen sich der zentralen Frage griechischen Philosophierens,43 der Frage nach dem richtigen Leben als der Frage nach der Möglichkeit des Glücks.44 Diese Frage, die sich ebenso wie die Frage nach der Metaphysik nicht in der biblischen, der jüdischen und christlichen Tradition findet, spürt den Lebensmöglichkeiten des Individuums nach und geht – wiederum im Unterschied zur biblischen Tradition – im Grundsatz davon aus, daß es den Menschen wesentlich selbst gegeben ist, ihr Leben zu gestalten. Wo die biblische Tradition sich wesentlich der Frage des Unglücks und damit der Frage der Theodizee zuwendet, stellt die antike Tradition die Frage nach einer Anthropodizee des Glücks in ihr Zentrum. Sie beginnt dabei mit metaphysischen Annahmen, mit Annahmen über das Wesen des Kosmos und eines seiner Bestandteile, eben der menschlichen Natur in ihrem kontingenten und riskanten Wechselspiel mit anderen Menschen und der nichtmenschlichen Natur. Kynismus, Epikuräismus, Skepsis und Stoa unterscheiden sich dabei nicht in ihrer Zielsetzung, die in allen Fällen die menschliche Glückseligkeit in den Mittelpunkt stellt, und auch nicht darin, daß sie die Tugend oder die Tugenden als die wichtigste Voraussetzung für ein gelungenes, ein glückliches Leben ansehen. Die entscheidenden Unterschiede dieser philosophischen Schulen bemessen sich an der Einstellung nicht zu den Gesetzen der Natur, sondern zu den Gesetzen der Menschen – die etwa von den Kynikern im Grundsatz abgelehnt werden – und der Frage nach dem Verhältnis von Glück, Lust und Freiheit. Sind Lust und Freiheit miteinander zu verbinden? Sind Glück und Freiheit in letzter Instanz miteinander vereinbar? Lassen sich die pathischen Anteile der Seele, also die menschlichen Leidenschaften, sinnvoll in das Ganze eines Lebens integrieren, oder ist ihnen nur durch Distanz oder Beherrschung beizukommen? In pädagogischer Hinsicht scheint die Antwort von allem Anfang an eindeutig zu sein. Die bei Platon getroffenen Entscheidungen wirken bis heute fort. Der Begriff der „Tugend“ steht bei ihm vor allem für ein Programm wert- und ideenbezogener Einschränkungen, für die säuberliche Trennung von Affekt und Autonomie.
Daher ist es kein Zufall, daß das Thema der Tugend in der Erziehungswissenschaft gelegentlich dort auftaucht, wo sie sich der Entwicklung des menschlichen Lebenslaufs im ganzen zuwendet, vornehmlich in der Theorie der Erwachsenenbildung. Tatsächlich hat sie stets dem Verhältnis von Bildung und Bildungssoziologie, von Erwachsenensozialisation und erwachsener Existenz nachgespürt und dabei – im Fall erwachsener Menschen, die im Idealfall ihr Leben eigenverantwortlich führen – dem Bildungs- vor dem Sozialisationsgedanken Priorität eingeräumt. Das mag der speziellen Sache geschuldet sein. Stärker als andere pädagogische Subdisziplinen nämlich erfordert die Erwachsenenbildung die Einbeziehung sowohl wissenschaftlichen als auch alltäglich gegründeten Reflexionswissens. Dabei scheint der philosophischen Ethik eine besondere Rolle zuzukommen. Philosophische Theorien der Ethik haben es an sich, daß sie einerseits methodisch ungeschützt, und darin dem Alltagswissen nahestehend, Fragen stellen können, die die Wissenschaft nicht mehr stellen darf, und daß sie sich andererseits, darin der Wissenschaft nahestehend, von allem Vorverständnis radikal distanzierend auf das einlassen müssen, was den Alltagsverstand, auch und gerade den wissenschaftlich gebildeten, brüskieren muß. In einem klassischen Beitrag zum Verhältnis von Sozialisationstheorie, Sozialwissenschaften und Didaktik der Erwachsenenbildung findet sich ein auffälliger Verweis45 auf ein weiter nicht vermitteltes oder erläutertes Zitat aus Platons Dialog Menon, dem letzten der frühen Dialoge. Hier fragt Menon: „Kannst du mir wohl sagen, Sokrates, ob die Tugend gelehrt werden kann? Oder ob nicht gelehrt, sondern geübt? Oder ob sie weder angeübt, noch angelernt werden kann, sondern von Natur den Menschen einwohnt oder auf irgendeine Art.“46