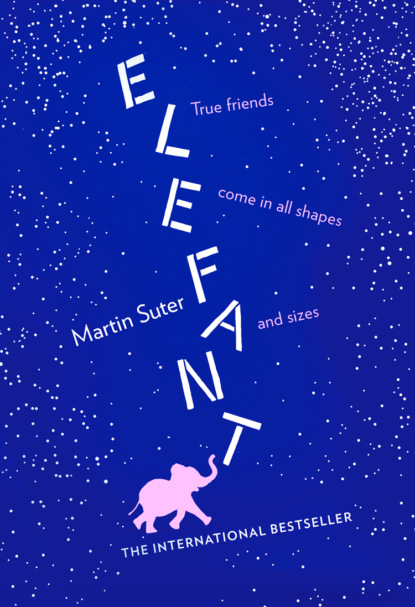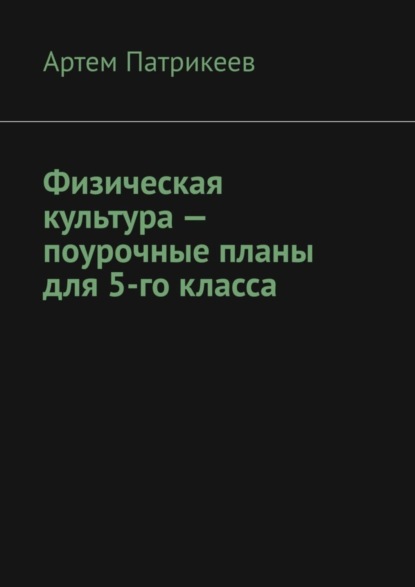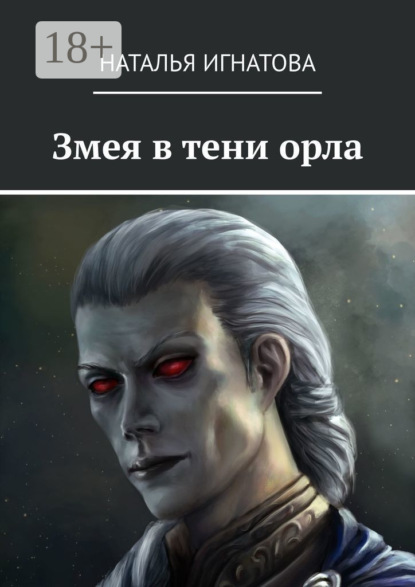- -
- 100%
- +
So die Eingangssequenz eines Platonischen Dialoges, der sich unter Pädagogen deshalb besonderer Beliebtheit erfreut, weil in ihm mit der Anamnesislehre die Frage kognitiver Lernkonzepte angesprochen wird. Man würde den Menon jedoch mißverstehen, läse man ihn als erkenntniskritischen Traktat; tatsächlich geht es Platon um ein eminent praktisches Problem – um die Lehrbarkeit der Tugend. Wie in den frühen Dialogen üblich, endet auch dieser Dialog aporetisch, die Leserinnen und Leser bleiben um viele Fragen reicher, aber um einige Antworten ärmer zurück: „Zufolge dieser Untersuchung also, o Menon“, so läßt Platon seinen Sokrates sprechen, „scheint die Tugend, durch eine göttliche Schickung denen einzuwohnen, denen sie einwohnt. Das bestimmtere darüber werden wir aber erst dann wissen, wenn wir, ehe wir fragen, auf welche Art und Weise die Menschen zur Tugend gelangen, zuvor an und für sich versuchen, was die Tugend ist.“47
Bildung, die sich in diesem Sinne auf eine realistische Konzeption der Existenz von Erwachsenen und Jugendlichen – bei all ihrer radikalen geschlechts-, einkommens-, bildungs- und lebenslagenbezogenen Ungleichheit – einläßt, wird eine sozialwissenschaftlich reformulierte Theorie der Tugend schon allein deshalb entfalten müssen, weil sie anders ihre Adressaten und deren vitalsten Interessen, einschließlich ihres Glücksstrebens, verkennen würde. Erwachsene und Jugendliche lassen sich nämlich – im Unterschied zu Kindern – bilden, weil sie ihr Leben verbessern und bereichern möchten, weil sie unter dem Druck selbst nicht gesetzter Qualifikationsanforderungen ihrem von ihnen zu verantwortenden Leben eine Wendung geben wollen, das vor dem Ganzen ihrer Existenz bestehen können soll. Daß es der Erwachsenenbildung vor allem darum geht, die Zumutungen des gesellschaftlichen Umfeldes für den erwachsenen Menschen zu analysieren, ist der oft übersehene existentialistische Kern der neueren Theorie der Erwachsenenbildung. Sie zielt auf eine Theorie des Lebenslaufs, die jene Haltungen analysiert, die es Menschen ermöglichen, den Kontingenzen des Lebens in der Moderne zu entsprechen, also auf jene Kompetenzen und Performanzen, die zu einer angemessenen „Realitäts-“ und „Identitätsarbeit“ führen können. Sie sind der formale, keineswegs nur kognitive Rahmen, innerhalb dessen ein gelungenes Leben angestrebt werden kann: „Denn bei keiner der menschlichen Leistungen gibt es eine solche Beständigkeit wie bei den tugendgemäßen Tätigkeiten. Diese scheinen sogar beharrender zu sein als die Wissenschaften, und unter ihnen wiederum sind am beharrends- ten die an Rang höchsten, weil die Glückseligen am meisten und am dauerndsten in ihnen leben. Dies wird auch wohl die Ursache dafür sein, daß sie nicht in Vergessenheit geraten.“48
Doch Aristoteles hatte unrecht. Die tugendgemäßen Tätigkeiten waren schon bei Monteverdi dabei, ihrem Begriff nach in Vergessenheit zu geraten, die Sache selbst schlummerte unaufgeklärt in der Sprache der Qualifikations-, Kompetenz- und Performanztheorie vor sich hin. Die in einer Theorie der Tugend angelegte Frage nach der Glückseligkeit49 scheint zudem eine Frage zu sein, die von einer modernen, sozialwissenschaftlich ausgerichteten, explanativen Theorie kaum, von normativen Theorien bestenfalls vorsichtig und mit eher schlechtem Gewissen angegangen werden. Nicht nur ließ sich nach den Verwüstungen und Katastrophen des zwanzigsten Jahrhunderts nicht mehr guten Gewissens von Glückseligkeit sprechen – wie sollte ein unverstelltes Glück im Wissen des Grauens möglich sein? „Aber selbst der endliche Anbruch der Freiheit“, so schließt Herbert Marcuses Triebstruktur und Gesellschaft, „kann diejenigen nicht mehr erlösen, die unter Schmerzen gestorben sind. Die Erinnerung an sie und die aufgehäufte Schuld der Menschheit gegenüber ihren Opfern verdunkeln die Aussichten einer Kultur ohne Unterdrückung.“50
Übrig blieb – mit guten Gründen – eine Ethik, die sich bestenfalls daran erinnern wollte, was die Frage nach dem guten Leben einmal bedeutete, und die statt dessen über die Beschädigungen menschlichen Lebens reflektierte.51 Ob sich die Frage nach dem Glück bzw. nach dem guten Leben überhaupt noch guten Gewissens stellen läßt, ob nicht jeder Versuch, angesichts dieser Geschichte subjektives Glück auch nur empfinden zu wollen, zwar verständlich, aber entweder sinnlos oder ungerecht ist, soll hier dahingestellt bleiben. Daß die meisten Menschen dem offenbar unauslöschbaren Streben nach Glück folgen, dürfte nicht zu bestreiten sein, ob „Glück“ als universelles menschliches Handlungsmotiv zu unterstellen ist, hingegen sehr wohl.52 Aristoteles – darin wird ihm Rousseau folgen – legt einen engen Zusammenhang zwischen Glückseligkeit und Tugend nahe, und zwar so, daß bestimmte Arten der Tugend, nämlich die beharrenden, von glückseligen Menschen auffällig oft gelebt würden. Damit ist der Begriff der „Tugend“ seit Beginn des abendländischen Denkens an die Reflexion über gelingende und mißlingende Lebensläufe geknüpft. Das Wechselspiel von Glück – d. h. von Zufall oder Geschick, von Tugend und Liebe, kurz: die wechselnden Konstellationen von bemühter Lebensführung und leidenschaftlichen Affekten, denen stets Kontingenz innewohnt – ist dabei jene Matrix, jener Hintergrund, vor dem ihrer selbst bewußte Individuen ihr Leben führen und führen müssen. Im Begriff der Tugend wird der Anspruch erhoben, das Verhältnis von angestrebten Tätigkeiten, seelischen Zuständen und widerfahrenen Kontingenzen alles in allem doch so steuern zu können, daß das gewollte und widerfahrene Leben schließlich im ganzen bejaht werden kann. Tugenden werden als jene Dispositionen, Fähigkeiten und Fertigkeiten angesehen, die es einem Individuum ermöglichen, sein Leben den eigenen Wünschen gemäß zu meistern und darüber hinaus – und hier beginnen die Schwierigkeiten – ein Leben zu führen, das auch nach objektiven Maßstäben als „gut“ gilt.
Damit ist das zentrale Problem einer Tugendethik benannt und das für eine moderne Moral bisher Zulässige überschritten. In der Moderne schienen allein Fragen der Gerechtigkeit objektivierbar,53 alle Versuche, Züge des guten Lebens als „objektiv“ auszuzeichnen, ziehen mit guten Gründen den Verdacht auf sich, einer staatlich oder gesellschaftlich gelenkten Despotie über die Bedürfnisse, einer Vergewaltigung sogar zulässiger Wünsche das Wort zu reden. Können die Tugenden unter den Bedingungen der Moderne, d. h. unter Bedingungen einer – wenn auch intersubjektiv konstituierten, so doch – autonom gewordenen Subjektivität, überhaupt noch einen Beitrag zur Philosophie der Moral oder wenigstens zu einer allgemeinen Ethik leisten?54
Für die Pädagogik resultierte aus dieser Schwierigkeit ein neues Programm der Bildung von Subjektivität.55 Dieses mehr als zweihundert Jahre alte Programm erfordert heute eine Klärung des Begriffs der Subjektivität im Lichte sozialwissenschaftlicher Theorien. Ob „Subjektivität“ sich als ein Ensemble von Rollen präsentiert oder als ein in sich geschlossenes psychisches System; ob sie sich selbst transparent und zudem hochindividualisiert ist; ob sie ein Geschlecht hat oder als Dreiheit von sex, gender und Begehren auftritt; ob sie das Gefängnis des Leibes darstellt und sich am Ende als Produkt historisch gewordener machtgeprägter Diskurse versteht56 – stets geht es um den begründeten Verdacht, daß die vermeintlichen Freiheitsgewinne der modernen Subjektivität in Wahrheit auf undurchschauten gesellschaftlichen Zwangsmechanismen beruhen. Diese Kritik beerbt letztlich die stoische Distanz zum irdischen Leben.
In der modernen Pädagogik jedoch, in der Linie von Jean-Jacques Rousseau zu Ellen Key interessieren die Subjekte vor allem als Menschen, die in voraussetzungsvollen Sozialisations- und Erziehungsprozessen ihre moralischen Gefühle bilden und mithin Objekt und Subjekt einer „éducation sentimentale“ sind. „Ich fühlte, ehe ich dachte“, heißt es in den Bekenntnissen, „das ist das gemeinsame Los der Menschheit.“57 Rousseau stand dafür, jene Gefühle bis hin zu dem Punkt bildend zu kultivieren, an dem sie den einzelnen Menschen in die Lage versetzen, in seiner politischen Gemeinschaft zu einem tugendhaften Bürger zu werden.
Tugenden sind, so wurde der Begriff eingeführt – unabhängig davon, ob man das klassische Gespann von Gerechtigkeit, Mut, Klugheit, Besonnenheit sowie Glaube, Liebe und Hoffnung oder einen anderen Kanon in Betracht zieht –, das Ensemble jener individuellen Verhaltensdispositionen, deren Zusammenspiel ein befriedigendes menschliches Leben verheißt. Wohlgemerkt: ein Ensemble! Eine Tugend tritt niemals allein auf; Tugenden haben es an sich, in welcher Kombination auch immer nur in Verbindung mit anderen aufzutreten. Dort, wo eine Tugend verabsolutiert wird, wie etwa das Streben nach Gerechtigkeit im Falle Michael Kohlhaas’, schlägt sie in Sünde um. Heilige und Helden sind keine tugendhaften Menschen. Tugenden sind aber auch nicht – wie vielfach mißverstanden – einfach der individuelle Niederschlag vorausgesetzter Werte. Tugenden sind vielmehr jene Eigenschaften von Personen, die es ihnen überhauptgestatten, sich zu vorfindlichen Werten ihrem wohlverstandenen Eigeninteresse entsprechend verhalten zu können. Damit scheiden sie – nebenbei gesagt – als Kandidaten für pädagogisierende Moralfeldzüge von vornherein aus.
Entsteht jedoch mit dem Rekurs auf Tugenden nicht ein Problem für das Programm einer auf Demokratie und Partizipation zielenden, emanzipatorischen Pädagogik? Wird damit nicht das beste Vermächtnis einer ob ihres Intellektualismus ohnehin oft genug kritisierten Theorie preisgegeben? Wenn Moral die Lehre von den universal gültigen Kriterien richtigen Handelns ist, die Theorie der Tugenden jedoch eine Lehre von wesentlichen, in sich wertvollen Charaktereigenschaften, wie soll es dann möglich sein, zu einem Begriff der Moral, der Rechte und der Gerechtigkeit zu kommen? Rousseau gelang es nicht, diese Schwierigkeit, die später in der Marxschen Sozialphilosophie als Spannung von „bourgeois“ und „citoyen“ wieder auftauchen sollte, aufzulösen: „Wenn“, so heißt es im Emile, „anstatt einen Menschen für sich selbst zu erziehen, man ihn für die anderen erziehen will? Dann ist jeder Einklang unmöglich. Gezwungen, gegen die Natur oder die gesellschaftlichen Institutionen zu kämpfen, muß man sich für den Menschen oder den Staatsbürger entscheiden, denn beide in einer Person kann man nicht schaffen.“58
Rousseaus Alternative ist logisch gesehen nicht zwingend und behauptet gleichwohl ein reales Dilemma: Das Dilemma einer Bildung, die die einzelnen in die Lage versetzen will, ihr Glück zu finden, und sie zudem dazu befähigen möchte, für universale Gerechtigkeit und Solidarität einzutreten, stellt ein echtes, nicht nur begriffliches Problem dar, dem nur durch begriffliche Grundlagenarbeit und empirische Forschung beizukommen ist. Vor allem aber ist zu klären, inwieweit die so beanspruchte Theorie der Tugenden mehr sein kann als lediglich eine mit philosophischen Begriffen verbrämte Motivationspsychologie. Kann eine – sogar eine erneuerte – Ethik der Tugenden überhaupt systematische Ansprüche entfalten?
Theorien der Moral gelten im allgemeinen als Theorien der Kriterien richtigen, meist gerechten Handelns. Eine Theorie der Handlung jedoch, die sich nur auf die Begründung der Handlung und ihre absehbaren Wirkungen bezieht und nicht mindestens am Rande auch eine Theorie der Akteure und ihrer wesentlichen Eigenschaften enthält, bleibt systematisch halbiert. Eine richtige Handlung, die aus inakzeptablen Motiven vollzogen wurde, mag zwar immer noch insgesamt als besser gelten als ihre Unterlassung: Gleichwohl würde etwa eine Lebensrettung, die seitens des Retters ausschließlich und nur aus Gründen des Profits und der Ruhmsucht vollzogen wurde und die beim Fehlen dieser Bedingungen unterblieben wäre, kaum unsere Anerkennung als moralische Handlung finden. An dieser Problematik bricht das in der systematischen Moralphilosophie der Neuzeit verdrängte Thema der „Tugenden“ wieder auf und bestimmt seit neuestem den Fortgang der moralphilosophischen Debatte.
Dies zu bemerken, bedurfte es nicht erst der deutschen Übersetzung von Aufsätzen einer analytischen Philosophin, der in Oxford lehrenden Philippa Foot.59 Spätestens seit den Debatten um den Kommunitarismus60 und dem Erscheinen von Alasdair MacIntyres After Virtue im Jahre 1981 sowie den Arbeiten von Charles Taylor61 über starke Wertungen und die Quellen des modernen Selbst deutete sich an, daß die Frage nach den normativ ausgezeichneten Charaktereigenschaften von Personen nicht im engeren Bereich politischer Philosophie verbleiben würde. Es waren vor allem Entwicklungen des akademischen Feminismus im Rahmen der entwicklungspsychologischen Auseinandersetzung um die Denkbarkeit einer weiblichen Moral, die das hierzulande des Konservativismus verdächtige Thema auf die Tagesordnung setzte.62 Mit den Arbeiten etwa von Annette Baier oder Amelie Oksenberg-Rorty bzw. den deutschsprachigen Beiträgen so unterschiedlicher, oft einander entgegengesetzter Autorinnen wie Herlinde Pauer-Studer, Gertrud Nunner-Winkler und Onora O’Neill63, haben auch in Deutschland nicht nur ein neues Thema und ein neuer Tonfall, sondern auch ein erneuertes Paradigma in der Moralphilosophie Einzug gehalten. Betrachtet man außerdem die steigende Zahl von Veröffentlichungen zu Theorien des guten und geglückten Lebens sowie einer Ästhetik der Existenz,64 so zeigt sich, daß die von seriösen Moraltheoretikern aller Schulen bespöttelten Anstöße des späten Foucault zu einer Ethik der Selbstsorge65 nun ihre systematische Begründung erhalten. Die von Roger Crisp bzw. von E. F. Paul unter dem Titel How Should One Live oder Self-Interest herausgegebenen Anthologien sowie das schon 1992 erschienene Hauptwerk der neuen Richtung, Michael Slotes From Morality to Virtue, beweisen zudem, daß eine erneuerte Theorie der Tugenden in Argumentation und Begrifflichkeit ebenso „hart“ und technisch operieren kann, wie dies Utilitarismus und Kantianismus tun.
Im Zentrum der erneuerten, weil sich reflexiv auf die moderne Moralphilosophie beziehende Theorie der Tugenden steht ein Problem, das die reine, die kantianische Theorie der Moral ins Fach der empirischen Psychologie abschieben zu können glaubte: die Frage nach der Motivation zu einem von der Einsicht ins Richtige geleiteten Handeln. Aufgabe einer Theorie der Moral sei es, so die gängige Lesart, die mehr oder minder unbedingte Begründung von Kriterien richtigen Handelns, den „moral point of view“66, zu beweisen oder zu entfalten.
Die Beantwortung der Frage, ob und warum Menschen sich an diesen Kriterien orientieren, sei dagegen Aufgabe der Wissenschaft. Kant selbst war der Auffassung, daß die Triebfedern eines an moralischen Prinzipien, d. h. vor allem an moralischen Geboten ausgerichteten Handelns den Akteuren niemals zu Bewußtsein kommen können. Da Kant jedoch den Umstand durchaus anerkennt, daß die moralischen Akteure, um die es ihm geht, empirische, sinnliche Menschen sind, sieht er sich im Gegenzug gezwungen, eine vermittelnde Instanz, nämlich den Begriff eines reinen guten, freien und autonomen Willens zu konstruieren, der als hypothetische Größe postuliert werden muß, aber empirisch nicht nachweisbar ist. Anlaß dieser Operation ist die Konstruktion moralischen Handelns als pflichtgemäßen Handelns, als des Entsprechens einer weil formalen, deshalb unbedingt geltenden Norm:67 „Es ist von der größten Wichtigkeit in allen moralischen Beurteilungen, auf das subjektive Prinzip aller Maximen mit der äußersten Genauigkeit Acht zu haben, damit alle Moralität der Handlungen in der Notwendigkeit derselben aus Pflicht und aus Achtung fürs Gesetz, nicht aus Liebe und Zuneigung zu dem, was die Handlungen hervorbringen sollen, gesetzt werde. […] Es ist sehr schön, aus Liebe zu Menschen und teilnehmendem Wohlwollen ihnen Gutes zu tun, oder aus Liebe zur Ordnung gerecht zu werden, aber das ist doch nicht die echte moralische Maxime unsers Verhaltens, die unserm Standpunkte, unter vernünftigen Wesen, als Menschen, angemessen ist.“68
Kants Unbehagen an dieser Lösung ist nicht zu übersehen und wird von ihm redlicherweise wieder und wieder artikuliert: „Wie kann Vernunft eine Triebfeder abgeben, da sie sonst jederzeit nur eine Richtschnur ist und die Neigung treibt, der Verstand nur die Mittel vorschreibt? Zusammenstimmung mit sich selbst. Selbstbilligung und Zutrauen. Die Triebfeder, die mit der Pflicht verbunden werden kann, aber niemals an deren Stelle gesetzt werden muß, ist Neigung oder Zwang.“69
Die ursprüngliche Lösung des Problems sollte darin bestehen, die Menschen dazu anzuhalten, sich in sinnvoller Weise als freie Wesen zu denken, um so zumindest einen Anreiz zu schaffen, sich so moralisch wie möglich, genauer müßte man sagen: sich wenigstens moralanalog zu verhalten. Kants klassische Lösung dieses Problems, nämlich eine zugleich empirische wie nicht leidenschaftliche Motivation für die Beachtung moralischer Gebote zu finden, bestand im Postulieren des Gefühls der „Achtung“ – ein Gefühl, das einerseits Wirkung des richtigen Verständnisses des moralischen Gesetzes sei und andererseits Ursache zu dessen Befolgung: „Achtung fürs moralische Gesetz ist also die einzige und zugleich unbezweifelte moralische Triebfeder, so wie dieses Gefühl auch kein Objekt anders, als lediglich aus diesem Grunde gerichtet ist. Zuerst bestimmt das moralische Gesetz objektiv und unmittelbar den Willen im Urteile der Vernunft; Freiheit, deren Kausalität bloß durchs Gesetz bestimmbar ist, besteht aber eben darin, daß sie alle Neigungen, mithin die Schätzung der Person selbst auf die Bedingung der Befolgung ihres reinen Gesetzes einschränkt.“70
Diese Lösung gestattet es einerseits, eine in sich konsistente Theorie moralischer Regeln aufzustellen, verbietet es jedoch andererseits, die Frage nach ihrer Lehrbarkeit, Lernbarkeit und vor allem Anwendbarkeit zu stellen. Entsprechend klingen Kants Auskünfte zur Möglichkeit einer sittlichen Erziehung durchaus realistisch: „Ob aber der Mensch nun von Natur moralisch gut oder böse ist? Keines von beiden, denn er ist von Natur gar kein moralisches Wesen; er wird dies nur, wenn seine Vernunft sich bis zu den Begriffen der Pflicht und des Gesetzes erhebt. Man kann indessen sagen, daß er ursprünglich Anreize zu allen Lastern in sich habe, denn er hat Neigungen und Instinkte, die ihn anregen, ob ihn gleich die Vernunft zum Gegenteile treibt. Er kann daher nur moralisch gut werden durch Tugend, also aus Selbstzwang, ob er gleich ohne Anreize unschuldig sein kann.“71
Unter diesen Bedingungen setzt auch Kant auf eine Bildung der Gefühle, wenn er fordert, Kindern richtige Gründe aufzustellen und sie begreifbar und annehmbar zu machen. Die Bildung der angemessenen Triebfedern zu moralischem Verhalten besteht in einer gezielten, argumentativen Verfeinerung basaler Affekte: Kinder „müssen lernen, die Verabscheuung des Ekels und der Ungereimtheit an die Stelle der des Hasses zu setzen; innern Abscheu, statt des äußern vor Menschen und der göttlichen Strafen, Selbstschätzung und innere Würde, statt der Meinung der Menschen, – innern Wert der Handlung und des Tun, statt der Worte, und Gemütsbewegung, – Verstand, statt des Gefühls, – und Fröhlichkeit und Frömmigkeit bei guter Laune, statt der grämischen, schüchternen und finstern Andacht eintreten zu lassen.“72
Die auf Kant folgende Moralphilosophie traute dieser Sublimationspädagogik bzw. der in ihr enthaltenen Zivilisationstheorie nicht und war bemüht, die Triebfedern der Moral in genau jenen „Gefühlen“ zu finden, die nach Kants Begriff der Moral mit ihr nichts zu tun haben konnten. An dieser Stelle setzen dann eine Reihe quasi naturalistischer Versuche ein, die entweder – wie der Kantianer Schopenhauer – eine natürliche Anlage zum Mitleid, oder – wie die unterschiedlichen Utilitarismen – einen Hang zur Luststeigerung postulieren, von psychischen Instanzen, die plausibilisieren sollen, warum Menschen nicht nur moralisch handeln sollen, sondern auch können.
Auf den ersten Blick erscheint uneinsichtig, warum ausgerechnet eine Theorie der Tugenden das mit Kants deontologischer Zweiweltenlehre gestellte Problem besser lösen können soll als teleologische Lehren wie Utilitarismus oder Mitleidsethik. In einem nämlich sind sich deontologische und teleologische Lehren einig: daß es bei einer Theorie der Moral um eine Theorie des Handelns aus allgemeingültigen, normativen Prinzipien geht, während doch eine Theorie der Tugenden sich vor allem für persönliche Haltungen und partikulare Lebensentwürfe zu interessieren scheint. Handlungen und ihre Kriterien hier, Haltungen und ihre Ziele dort – scheidet die Theorie der Tugend mit dieser Grundentscheidung nicht von Anfang an als eine Kandidatin zur Begründung einer Moral aus? Im Gegenteil: Eine Theorie der Tugenden kann zur Begründung einer Moral und Schließung jener Lücke, die Kant hinterlassen hat, deshalb etwas beitragen, weil sie vor einem von beinahe allen modernen Moraltheorien ängstlich gemiedenen Problem nicht zurückweichen muß, nämlich der Frage, warum Menschen überhaupt moralisch sein sollen. Diese Frage wird sowohl im Utilitarismus als auch in den meisten kantianischen Moralen – mit Ausnahme von John Rawls’ Theorie der Gerechtigkeit – entweder agnostisch beantwortet oder unter Sinnlosigkeitsverdacht gestellt.73 So weist etwa der radikale Utilitarismus diese Frage als sinnlos zurück bzw. glaubt, über Moral nur mit solchen Menschen debattieren zu können, die schon moralisch sein wollen, während die transzendentalpragmatische Diskursethik ein gleichsam naturalistisches Konzept sprachlich vermittelter Sittlichkeit aufbietet, das die philosophische Frage entschärft bzw. mögliche Immoralisten konsequent pathologisiert.74 Dieser Preis für die Lösung einer philosophischen Grundsatzfrage scheint mindestens dann zu hoch, wenn noch nicht alle philosophischen Lösungen ausgeschöpft sind. Zu diesen nicht ausgeschöpften Lösungsversuchen gehört eine Theorie der Tugend, die mit der scheinbar partikularen, existentiellen Frage beginnt, was für ein Mensch ich im Kreise meiner Mitmenschen sein, als wer ich aufgrund welcher Eigenschaften anerkannt und geachtet sein will. Diesen Ausgangspunkt hat Kant ausdrücklich abgelehnt. In einer kritischen Untersuchung zu den unauslotbaren empirischen Motivationen (scheinbar) moralischen Handelns kommt er zu dem Schluß, daß „man doch in keinem Beispiel mit Gewißheit dartun kann, daß der Wille hier ohne andere Triebfeder, bloß durchs Gesetz, bestimmt werde, ob es gleich so scheint; denn es ist immer möglich, daß insgeheim Furcht vor Beschämung, vielleicht auch dunkle Besorgnis anderer Gefahren, Einfluß auf den Willen haben möge.“75
Beschämung, Furcht oder die Erfahrung, mißachtet worden zu sein,76 ist zwar ein Ergebnis moralisch verpönter Verhaltensweisen, darf aber gleichwohl nicht zum Motiv des eigenen, moralischen Handelns werden. Sich an derartigen Gefühlen zu orientieren hieße, sein Handeln an anderen denn vernunftgemäßen Prinzipien auszurichten.
Im Unterschied dazu nimmt die Theorie der Tugend als Preis für die Möglichkeit, die Frage, warum Menschen moralisch sein sollen, beantworten zu können, Abstriche an einem absoluten Autonomieprinzip sowie einer Lehre vom reinen Willen hin. Diese Abstriche dürften um so eher zu akzeptieren sein, als auch die kantianischen Theorien der Moral – namentlich die Transzendental- bzw. Universalpragmatik von Apel und Habermas,77 die sich in dieser Hinsicht einig sind – mit ihrer Wendung zur Intersubjektivität einander anerkennende und sich auch affektiv begegnende Individuen in den Mittelpunkt stellen. Eine auf Intersubjektivität beruhende Theorie der Moral muß darauf verzichten, lediglich das Verhältnis des einsamen Subjekts zu einem ihm wie auch immer zugänglichen Moralprinzip ins Zentrum zu stellen, und wird die im Lauf der Sozialisation gebildete Moralität als Ergebnis von Anerkennungsakten verstehen, die allemal affektiv getönt sind.78
Entgegen dem ersten Eindruck, daß es einer Theorie der Tugend ausschließlich um Haltungen geht, ist weiterhin festzustellen, daß auch sie – gemeinsam mit Kantianismus, Utilitarismus und alltäglicher Moral – davon ausgeht, daß es bei der Moral tatsächlich ums Handeln geht. Haltungen sind Handlungsbereitschaften, Dispositionen, die sich aus moralischen Einsichten, moralischen Gefühlen und motivationaler Stärke zusammensetzen; Dispositionen, bei denen – sofern sie vorliegen – davon ausgegangen werden kann, daß Individuen im Falle entsprechender Herausforderungen auch so handeln werden. Tugenden setzen zwar einen guten Willen voraus, sind mit ihm aber nicht identisch. Tugendhafte Personen haben über einen guten Willen hinaus auch die Kraft, ihn unter gegebenen Umständen sinnvoll zur Geltung zu bringen; von ihnen weiß man, daß sie so handeln werden, wie sie es verkünden und wie es von ihnen erwartet wird. Sie stellen gleichsam personengewordene Garantien für richtiges Handeln dar.