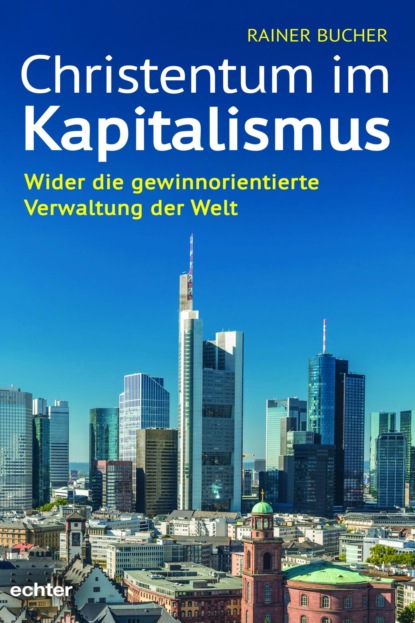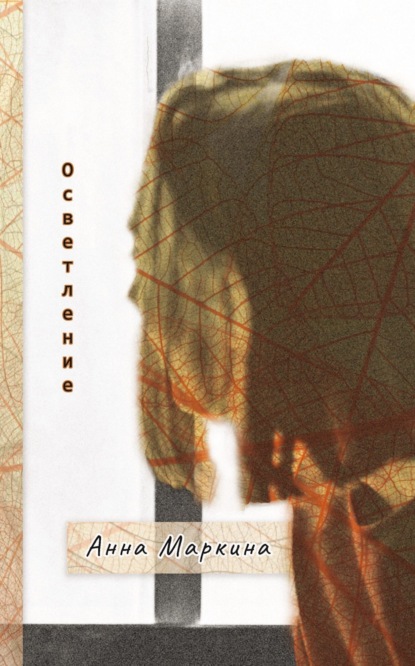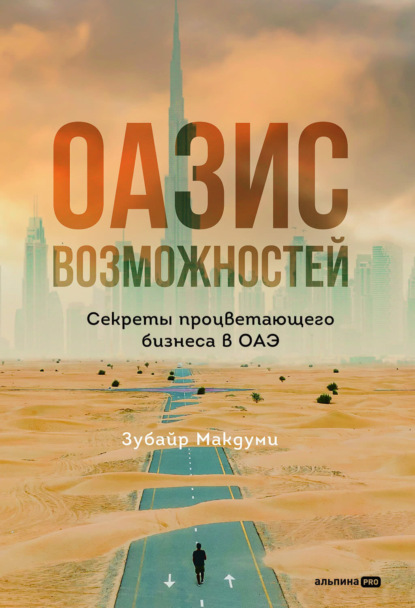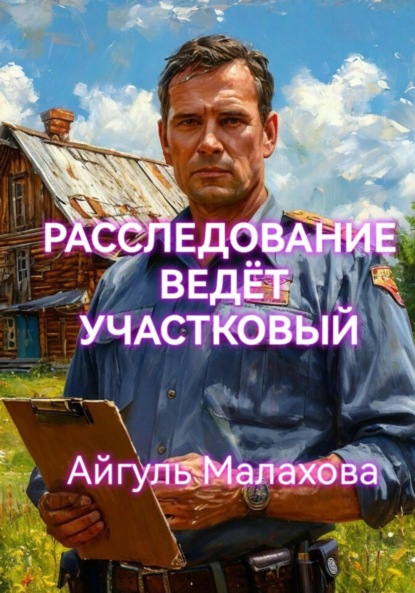- -
- 100%
- +

Rainer Bucher
Christentum im Kapitalismus
Wider die gewinnorientierte Verwaltung der Welt
Rainer Bucher
Christentum
im Kapitalismus
Wider die gewinnorientierte
Verwaltung der Welt
echter
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über ‹http://dnb.d-nb.de› abrufbar.
1. Auflage 2019
© 2019 Echter Verlag GmbH, Würzburg
www.echter.de
Umschlag: Vogelsang Design, Jens Vogelsang, Aachen
Umschlagbild: fotolia.com, © Dirk Vonten
Satz: Crossmediabureau
E-Book-Herstellung und Auslieferung: Brockhaus Commission, Kornwestheim, www.brocom.de
ISBN
978-3-429-05375-8
978-3-429-05028-3 (PDF)
978-3-429-06438-9 (ePub)
Vorsicht also, und sprich nicht leichtsinnig vom Feinde. Man klassifiziert sich durch seinen Feind. Man stuft sich ein durch das, was man als Feindschaft anerkennt. (…) Der Feind ist unsere eigene Frage als Gestalt.
Carl Schmitt
Theorie des Partisanen. Zwischenbemerkung zum Begriff des
Politischen, Verlag Duncker & Humblot, Berlin 1963, 87
Das Besondere an der in der Neuzeit verbreiteten Auffassung des Neuen besteht ja gerade in der Erwartung, es werde schließlich etwas endgültig Neues in Erscheinung treten, daß es nach ihm nichts noch Neueres mehr geben könne.
Boris Groys
Über das Neue. Versuch einer Kulturökonomie,
Carl Hanser Verlag München, 3. Aufl. 2004, 10
Es findet eine Inversion des Proletariats als Klasse statt. In deren Folge ist das Individuum nicht Teil des Proletariats, sondern das Proletariat Teil des Produktionsprozesses der eigenen Identität.
Luise Meier
MRX-Maschine, Matthes & Seitz Berlin Verlagsgesellschaft 2018, 25
In der wirklich verkehrten Welt ist das Wahre ein Moment des Falschen.
Guy Debord
Die Gesellschaft des Spektakels, Edition Tiamat, Berlin 1996 [1967], 16
Inhalt
Vorwort
Kapitalismus
I. Abgrenzungen
II. Die aktuelle Logik der Welt
Reaktionen
III. Formatierungen der religiösen Landschaft
IV. Katholische Kirche und Theologie
Perspektiven
V. Postmoderner Marxismus
VI. Prophetisches Christsein
Jenseits von Affirmation und Retro-Utopien
VII. Strategien und Taktiken
VIII. Balancen des Christlichen
IX. Alternative Praktiken, alternative Orte
X. Ein neuer politischer Katholizismus
XI. Reformatierungen der Theologie
Nachwort. Persönlich
Anmerkungen
Literaturverzeichnis
Vorwort
Die christlichen Kirchen Europas erleiden seit längerem einen unumkehrbaren Prozess des Machtverlustes. Dieser Abstiegsprozess wird im Christentum als Säkularisierung kommuniziert. Auch die Religionssoziologie folgt mehrheitlich diesem Paradigma.
Wie aber zeigt sich dieser epochale Vorgang, wenn man ihn nicht als Geschichte eines Verlustes, sondern einer Machtübernahme beschreibt und von jener Größe her analysiert, welche die Religionen beerbt? Diese Frage und die Konsequenzen, die sich für das Christentum daraus ergeben, bilden das Thema dieses Buches.
Es schließt an meine Publikation An neuen Orten, Studien zu den aktuellen Konstitutionsproblemen der deutschen und österreichischen katholischen Kirche, Würzburg 2014 an. Dort wurde im Vorwort die Hoffnung ausgesprochen, in einer zukünftigen Arbeit das im Titel genannte Neue nicht mehr von den Differenzerfahrungen zum Alten her zu sehen, sondern von dem her zu betrachten, was nun herrscht. Dies soll hier geschehen.
Als dieses Neue wird der „kulturell hegemoniale Kapitalismus“ bestimmt. Aus der Perspektive dieses neuen Souveräns zeigen sich interne Klassifikationen und Differenzierungen des alten Machthabers, wie jene nach Kirchen und Konfessionen, als ausgesprochen nachrangig. Zugleich bleibt dieses Buch das Werk eines deutschen katholischen Theologen. Die hier vorgelegten Ausführungen sind denn auch vorwiegend auf Europa bezogen, greifen aber immer wieder kontrastiv darüber hinaus. Auch haben sie vor allem die katholische Kirche im Blick.
Ich danke den Teilnehmerinnen und Teilnehmern meiner Seminare an der Katholisch-Theologischen Fakultät der Universität Graz zur „Kirche im Kapitalismus“ für vielfältige Anregungen. Wertvolle Hinweise lieferten zudem Gespräche mit Ottmar Fuchs, Birgit Hoyer und Martin Ott.
Meine Mitarbeiterin, Frau Ingrid Hable MA, und Heribert Handwerk vom Echter Verlag haben das Buch gewissenhaft lektoriert. Für diese gute, vertrauensvolle Zusammenarbeit, nun schon über viele Jahre und einige Bücher bewährt, habe ich einmal mehr herzlich zu danken.
In spezieller Weise aber danke ich Eva Bucher, die mir in einer entscheidenden Phase der Entwicklung meiner Überlegungen eine äußerst hilfreiche und ermutigende Gesprächspartnerin war. Ich widme dieses Buch ihrer am 28. Dezember 2017 geborenen Tochter Anan, unserer Enkelin, die einmal wird überprüfen können, ob das hier Geschriebene irgendeine Relevanz besitzt.
Kapitalismus
I.
Abgrenzungen
1.
Der menschheitsgeschichtlich einzigartige Prozess der Entthronung der Religion als umfassender und alternativloser Normierungs- und Orientierungsgröße für den Einzelnen wie die Gesellschaft nahm seinen Anfang im frühneuzeitlichen Westeuropa. Er ist vielfach in seinem historischen Verlauf wie seiner systematischen Struktur analysiert worden, zumeist unter der Kategorie der „Säkularisierung“, zuletzt von Charles Taylor in seinem monumentalen Werk Ein säkulares Zeitalter.1
Es war denn auch der säkulare Staat, der lange Zeit jene Stelle einnahm, welche die Religion aufgeben musste: die Stelle des souveränen Herrschers, der sich vor niemandem rechtfertigen muss, vor dem sich aber alle zu rechtfertigen haben. Der Staat und seine wechselnden Legitimations- und Realisationskonzepte Absolutismus, Liberalismus und Kommunismus bis hin zum Faschismus waren daher das große Problem der Kirchen der Neuzeit. Denn der Staat beanspruchte seit seinem Entstehen Souveränität, reklamierte, eine eigene, unhinterfragbare Gewalt zu sein und der höchste Ort politischer Entscheidungen und Rechtssetzung.
Die Institutionen der Religion mussten sich seither in Beziehung setzen zu dieser staatlichen Souveränität, ein Prozess, der sie massiv umformatierte und ihnen enorme theoretische wie institutionelle Transformationsanstrengungen abverlangte und bisweilen immer noch abverlangt. Die staatlichen Souveränitätsansprüche hatten sich schließlich ausdrücklich gegen die Institutionen der Religion, ihre normativen Ansprüche und ihre reale Macht entwickelt. Jean Bodin hatte seine Souveränitätskonzeption angesichts der konfessionellen Bürgerkriege in Frankreich entworfen, auf der Basis der traumatischen Erfahrung also, dass die Spaltung der Christenheit enorme Gewaltpotentiale freisetzte, eine Erfahrung, die sich später im Dreißigjährigen Krieg noch einmal dramatisch bewahrheiten und verdichten sollte.
Die katholische Kirche konstituierte sich dabei nach und nach analog zum neuzeitlichen Staatsabsolutismus selbst als absolutistischer Staat. Das Theorem hierfür lieferte Robert Bellarmin mit der Souveränitätskategorie der „societas perfecta“. Das hatte den Vorteil der Gleichrangigkeit gegenüber den entstehenden neuzeitlichen Staaten, aber auch den Nachteil, immer im gewissen Sinne etwas Externes zu sein, solange man nicht selber in einem „katholischen Staat“ an der Macht war. Deshalb favorisierte man diese katholischen Staaten und sehnte sie herbei. Als Nachteil erwies sich schließlich auch, dass man sich mit der Übernahme des staatlichen Absolutismus in die eigene Kirchenstruktur massive Entwicklungshemmnisse einhandelte. Man hatte sich geradezu dogmatisch an diese spezifische Regierungsform gebunden und hatte daher deren Legitimationsdefizite und faktischen Nachteile in späteren, gänzlich neuen und anderen Konstellation zu ertragen beziehungsweise mehr oder weniger geschickt zu kompensieren. Das gilt bis heute.
Verschärfend kam hinzu, dass man im 19. Jahrhundert den epochalen Fehler begangen hatte, in Reaktion auf die historischen Relativierungen der Geschichtswissenschaften die eigene, in der frühen Neuzeit entworfene und recht eigentlich auch erst im 19. Jahrhundert wirklich durchgesetzte absolutistische Regierungsform ahistorisch zu essentialisieren, wovon man dann natürlich nur noch sehr mühsam und unter enormem legitimatorischen Aufwand wieder herunterkam. Das II. Vatikanische Konzil, das diesen Versuch darstellt, war denn auch das mit Abstand textproduktivste Konzil der Kirchengeschichte. Nachwehen des antimodernistischen „Dispositivs der Dauer“2, das Geschichtlichkeit – und andere analoge Relativierungen – nur als depotenzierenden Relativismus verstehen konnte, erschüttern die katholische Kirche bis heute.
Die andere große Konfessionskirche der Neuzeit, der Protestantismus, konstituierte sich nicht staatsanalog wie die katholische Kirche, sondern staatsaffin, begriff und entwickelte sich zur Kirche der neuen Staaten. Das hatte den Vorteil, dass man immer à jour war, also kein aggiornamento brauchte, aber auch den Nachteil, dass man in alle Turbulenzen der neuzeitlichen Staats- und Gesellschaftsgeschichte, inklusive deren totalitären Abgründe, verstrickt wurde und sich deshalb immer mal wieder entschuldigen muss. Der Protestantismus schleppt seit seinem Ursprung in den Reformationen des 16. Jahrhunderts die epochale Belastung mit sich, von externer politischer Protektion abhängig zu sein und seine Universalität landeskirchlich verloren zu haben. Die katholische Kirche nutzte dies denn auch sofort kontroverstheologisch aus, um ausgerechnet die nota ecclesiae „katholisch“ ganz gegen ihren ursprünglichen Sinn zu konfessionalisieren.
Das Problem des Souveränitätsanspruchs des neuzeitlichen Staates löste die eine Konfessionskirche, indem sie sich zum Staat erklärte und bis heute ja denn auch als Völkerrechtsubjekt agiert, die andere, indem sie sich, gerade in Deutschland, dem real existierenden Staat als dessen moralischer Über- oder Unterbau anbot. So problematisch diese beiden Lösungsmodelle auch waren: Sie haben lange funktioniert. Doch damit dürfte es vorbei sein. Offenkundig hat ein neuer Herrscher die Macht übernommen, die Spitzen von katholischer Kirche und deutschem Staat spüren es.
2.
Am 15. Mai 2014 eröffnete der damalige deutsche Bundespräsident und ehemalige protestantische Pastor Joachim Gauck in Wuppertal einen Zukunftskongress der EKD (Evangelische Kirche in Deutschland). In seiner Rede forderte er von seiner Kirche, es sich nicht zu leicht zu machen in dieser Gesellschaft, vielmehr eine moralische und spirituelle Avantgarde zu sein, eine frische, eigensinnige, von „ihrer Aufgabe zutiefst überzeugte Gemeinschaft“, die „vernehmbar und verstehbar von Gott“3 spreche.
Gut zweieinhalb Jahre vorher hatte Papst Benedikt XVI. vor dem versammelten deutschen Katholizismus in Freiburg angemerkt, dass Macht die Kirche oft korrumpiere und die Vertreibung der Kirche von der Macht in den Säkularisierungsprozessen der Neuzeit auch ihr Gutes gehabt habe. Die Kirche zeige immer wieder die Tendenz, sich in dieser Welt einzurichten und sich den Maßstäben der Welt zu sehr anzugleichen.4
Die Ironie der Konstellationen ist nicht zu übersehen: Da fordert ein deutscher Papst, immerhin das letzte absolute Staatsoberhaupt Europas, ausgerechnet vom deutschen Minderheitenkatholizismus Machtverzicht, und ein evangelischer Pastor als Bundespräsident vom Protestantismus mehr Distanz zum Staat. Der Papst als Oberhaupt eines eigenen Staates und der Pastor als Oberhaupt des deutschen Staates sind noch Figurationen der alten konfessionellen Religion-Staat-Konstellation. Aber offenbar merken beide, dass es damit zu Ende geht.
Sie nennen gute theologische Gründe dafür und auch, warum das Auslaufen dieser Konstellation gar nicht so sehr zu bedauern ist. Nur eine „entweltlichte Kirche“, so Benedikt XVI., könne wirklich offen sein „für die Anliegen der Welt“ und in dieser Welt „die Herrschaft der Liebe Gottes“5 bezeugen. Es ginge in den Kirchen darum, so dann Gauck, uns mit „Maßstäben zu konfrontieren, die oft quer stehen zu dem, was wir uns selber so schön ausgedacht“6 hätten. Das aber sehen beide in der aktuellen Konstellation, die sie selbst doch noch so trefflich verkörpern, gefährdet.
Warum aber trauen sie den eigenen neuzeitlichen Konzepten ihrer Kirchen nicht mehr so recht: der stolzen katholischen staatsanalogen Institutionalität und dem eindrucksvollen Versuch des Protestantismus, zum eigentlichen, besseren Betriebssystem des modernen Staates zu werden? Bei Gauck scheint es die Ahnung zu sein, sich nicht mehr auf dem Festland unhinterfragbarer Sicherheiten, sondern auf dem offenen Meer einer liquid modernity7 zu befinden. Wir „spüren vielleicht noch mehr, als wir wissen“, so Gauck, „dass sich große Veränderungen vollziehen – und dass wir an diesen Veränderungen mitarbeiten müssen, wenn wir nicht nur blinde Passagiere auf einem ferngesteuerten Schiff sein wollen“8. Die Kirche, so dann der Papst in einem bemerkenswerten Stück Exposure-Theologie, müsse sich „immer neu den Sorgen der Welt öffnen, zu der sie ja selber gehört, sich ihnen ausliefern, um den heiligen Tausch, der mit der Menschwerdung begonnen hat, weiterzuführen“9.
Da stellt sich dann freilich die Frage: Wer ist am Ruder dieses ferngesteuerten Schiffs der Gegenwartskultur? Von welchen großen Veränderungen, die eher zu spüren als zu wissen sind, redet man hier? Wem muss man sich „ausliefern“ oder ist man schon ausgeliefert? Wer ist der neue Souverän, der den modernen Staat ablöst und die Kirchen, wie damals zu Beginn der Neuzeit, zu neuen Positionierungen zwingt und in neue Formatierungen treibt? Weil er sie, wie damals die Staaten, sowieso umbaut und die Frage nicht ist, ob die Kirchen und Religionsgemeinschaften das wollen, sondern wie sie sich darin und wie sie sich dazu verhalten?
3.
Souverän ist, wer sich nicht rechtfertigen muss, vor dem sich aber alle zu rechtfertigen haben.10 Absolute Souveränität kommt daher nur Gott zu. Denn auch der absolutistischste Herrscher hat seine eigene Rezeption nicht gänzlich in der Hand. Zu seinen Lebzeiten kann er nur den äußeren Gehorsam kontrollieren, nicht aber die innere Gefolgschaft, und stets muss er daher seinen Sturz fürchten. Nach seinem Tod aber kommt seine Herrschaft bei den nachfolgenden Generationen unter von ihm nicht mehr kontrollierbare Rechtfertigungshorizonte. In spätmodernen Zeiten mit ihren vielfältigen gesellschaftlichen Machtvektoren und Machtdispositiven gibt es absolute Souveränität sowieso nicht, wohl aber relative Souveränität. Irgendjemand steht, wie prekär und also vorläufig auch immer, an der Spitze der Rechtfertigungspyramide. Wer ist es aktuell?
Souveräne Herrscher haben kein Interesse daran, besonders originell zu sein oder schwierig zu identifizieren. Sie müssen es auch nicht, sie wollen und müssen sich zeigen. Souveräne Herrschaft ist aufgespannt in der Polarität von alltäglicher Normalität einerseits, die sie bis an die Unsichtbarkeitsgrenze verschleiert, und ostentativer Sichtbarkeit andererseits, die sich demonstrativ inszeniert. Kommt souveräne Herrschaft unter Konkurrenzdruck, verschiebt sich das Gleichgewicht in der Regel in Richtung Sichtbarkeit. Die Kirchen, die katholische der Neuzeit ganz besonders, entwickelten – oder adaptierten – ausgefeilte Ikonographien, Orte, Strukturen der Sichtbarkeit ihrer Souveränität, das Papsttum in Rom etwa den Petersdom mit seiner Kuppelinschrift Mt 16,18 („Tu es Petrus …“) oder die Tiara, jene dreifache Papst-Krone als Symbol für den „Vater der Fürsten“, das „Haupt der Welt“ und den „Statthalter Jesu Christi“, oder, am anderen Ende der kirchlichen Pyramide, den innen dunklen, außen aber sehr sichtbar im Kirchenraum platzierten Beichtstuhl, der über das Seelenheil der Beichtenden entschied. Die modernen Staaten bedienten sich dann im entsprechenden Fundus der Religionen freizügig, die totalitären Staaten taten dies exzessiv – alle aber im Ganzen bis heute ausgesprochen erfolgreich.
Auf weltpolitischer Ebene ist unschwer zu beobachten, wer die Nationalstaaten unter Druck setzt: die Macht der globalen Märkte und ihrer transnationalen Akteure. Es tobt ein veritabler Kampf. Die Staaten schließen sich denn auch in unterschiedlichsten Formationen zusammen, um in diesem Kampf überhaupt eine Chance zu haben. Dass der nationalistische Rechtspopulismus glaubt, dem globalisierten Finanz-Kapitalismus in einer Retro-Utopie11 entkommen zu können, ist nur einer seiner vielen Irrtümer. Der moderne Staat hatte die institutionalisierten Religionen ihrer Souveränität beraubt, der postmoderne Kapitalismus ist gegenwärtig dabei, nun seinerseits die Staaten ihrer Souveränität zu berauben. Das setzt die diversen älteren religionspolitischen Arrangements zwischen Staat und Kirchen nicht außer Kraft, aber untergräbt sie nach und nach und kontextualisiert sie neu.
Der Kampf um die politische Macht zwischen den globalen Märkten und ihren globalen Akteuren einerseits und den Staaten und ihren Zusammenschlüssen andererseits mag – bei deutlichem Vorteil der Märkte – noch nicht definitiv entschieden sein. Es ist aber auch nicht so sehr dieser Kampf um die politische Vorherrschaft zwischen transnationalen Marktakteuren und den immer weniger souveränen Staaten, der die Stellung der Religionen untergräbt, es ist vielmehr der Kampf um die prägenden Prinzipien von Lebensführung und kultureller Formatierung der Gesellschaften. Dieser Kampf aber dürfte schon entschieden sein. Der Kampf um die Kultur, um die orientierenden Prinzipien der Lebensführung, um das, wonach sich alle richten und wogegen jene, die sich nicht danach richten wollen, opponieren müssen, diesen Kampf hat der globale Kapitalismus bereits gewonnen. Denn alle wollen, was er will, und sie wollen es unbedingt. Und wer etwas anderes will, muss sich gehörig rechtfertigen und wird unter diesem Rechtfertigungsdruck und angesichts der ziemlich aussichtslosen Position, in der er sich befindet, bisweilen gewalttätig.
Bestimmt man den „Kultur“-Begriff nicht als emphatischen Begriff sich abgrenzender Selbstdefinition, sondern nüchterner als kritischen (Selbst-)Beobachtungsbegriff, mithin „als Kommunikation der Beobachtung der Form von Handlungen, Rollen und Systemen“12, und definiert man „Hegemonie“ als die weitreichende faktische Überlegenheit einer Größe gegenüber konkurrierenden, grundsätzlich gleichen gleichrangigen Größen im Feld, so dass diese anderen Akteure nur eingeschränkte Möglichkeiten besitzen, ihre eigenen Vorstellungen und Interessen durchzusetzen,13 dann kann dem Kapitalismus umfassende kulturelle Hegemonialität zugeschrieben werden.14 Kulturell imperial ist der Kapitalismus nach dieser Definition übrigens nicht. Er wäre es, wenn alternative Lebensentwürfe ihre Alternativ- und Gleichrangigkeitsansprüche mit den kapitalistischen Lebensführungsprinzipien nicht mehr länger aufrechterhalten könnten und ihre Chancenlosigkeit eingestehen müssten. Nicht zuletzt die meisten Religionen, aber etwa auch neomarxistische Konzepte sehen sich aber auf Augenhöhe mit der dominanten kulturellen Größe Kapitalismus. Ob sie es sind, mag hier erst einmal offenbleiben.
Der Kapitalismus ist seit längerem mehr als nur eine spezifische Weise, die Ökonomie zu organisieren, weit mehr. Er soll hier, in Anschluss an eine Formulierung von Jean-Luc Nancy, als die „gewinnorientierte(.) Verwaltung der Welt“15 bestimmt werden. Klassische kapitalistische Prinzipien, wie etwa Ich-bezogene Wettbewerbsorientierung, umfassende Kommodifizierung und extrinsische Motivationsanreize, sind dabei aus dem schon länger kapitalistisch operierenden ökonomischen Sektor in die allgemeine Lebensführung und ihre gesellschaftlichen Manifestationen, also in die Kultur, gewandert. Man wird davon ausgehen müssen, dass der Kapitalismus zu einem hegemonialen kulturellen Muster menschlicher Existenz geworden ist.
Er dominiert und determiniert mit seinen Mächten zunehmend nicht nur die Nationalstaaten, die sich ihm gegenüber verhalten müssen, er dominiert und determiniert zunehmend auch die Muster menschlicher Lebensführung und deren kulturelle Institutionalisierungen und innerpsychische Codierungen. Der Kapitalismus verwaltet tatsächlich die Welt: die innere wie die äußere. Erkennbar ist das nicht zuletzt gerade daran, dass er die religiösen Institutionen als heilsorientierte Verwalter der Welt dabei ist abzulösen, was wiederum daran erkennbar ist, dass zunehmend und beileibe nicht nur in Westeuropa gilt: Nicht der Kapitalismus muss sich vor den Religionen, sondern die Religionen müssen sich vor der kapitalistischen Kultur rechtfertigen. Diese Rechtfertigung, wie im religiösen Fundamentalismus, gewaltsam zu verweigern ist nur eine paradoxe Variante dieser Konstellation.
So sehr die vom Kapitalismus produzierte Dynamik, Buntheit, Vielfalt den üblichen grauen Vorstellungen von Verwaltung zu widersprechen scheinen, so sehr ist diese bunte Außenseite doch genau dies: die Außenseite eines Innen, das auf keinen Fall sein zentrales Ziel, die Gewinnorientierung, verfehlen darf. Das zentrale Konzept des Kapitalismus ist die individuelle Gewinnorientierung, also die Frage: Was nutzt es mir? Diese Frage durchdringt alles und alle, vor ihr müssen sich alle und alles rechtfertigen. Es ist die Frage des neuen Souveräns. Verwaltung aber ist die Organisation des Bestehenden, über das hinaus es nichts anderes geben soll und darf, Verwaltung ist dadurch ausgezeichnet, nicht über sich hinaus denken zu dürfen und zu können. Kapitalismus ist die gewinnorientierte Verwaltung des Bestehenden, die verschleiert, wie statusfixiert sie ist, die im bunten Leerlauf des letztlich immer Gleichen doch auch nur eben selbstreferentielle Verwaltung ist. Wahrscheinlich ist der spätmoderne Kapitalismus jene Form der Phantasielosigkeit, die es geschafft hat, diese perfekt zu verschleiern. Dass die im Kapitalismus in Gang gesetzten kulturellen und technologischen Entwicklungen hinter dem Rücken der Akteure freilich seit einiger Zeit eine Eigendynamik produzieren, die vor ihnen als unvorhergesehenes, unvorhersehbares Ereignis wieder auftaucht, das ist dann eine ganz andere Frage. Manchmal kommen Verwaltungen eben auch nicht mehr zurecht.
4.
Seit es den Kapitalismus gibt und ganz besonders seit er nach langem Vorlauf in den italienischen Stadtstaaten des Spätmittelalters in der europäischen Neuzeit immer dominanter wurde, hatte die katholische Kirche etwas gegen ihn. Nur in den Zeiten des Kalten Krieges nach dem II. Weltkrieg, im Bündnis mit dem kapitalistischen „Westen“ gegen den real existierenden atheistischen Kommunismus, war das zumindest auf der politischen Oberfläche anders.16 Seit aber der real existierende Kommunismus verschwunden ist und spätestens seit ein offen kapitalismuskritischer Lateinamerikaner Papst geworden ist, ist es auch damit wieder vorbei. Die traditionelle anti-kapitalistische Frontstellung der katholischen Kirche hat im Wesentlichen drei Gründe: einen kulturellen, einen ethischen und einen sozialen. Sie beziehen sich allesamt auf zentrale Strukturelemente des Kapitalismus.
Kulturell bemerkte gerade die katholische Kirche natürlich sehr schnell, dass, wie das Kommunistische Manifest in einer schönen Metapher festhält, im Kapitalismus „alles Ständische und Stehende verdampft“ und „alles Heilige“ irgendwann „entweiht“17 wird. Als Trägerinnen von ihnen selbst als ewig und unwandelbar angesehener, von ihnen auch gesellschaftlich legitimierter und sanktionierter Traditionen, Bindungen und Ordnungen wurden die Kirchen durch den Kapitalismus bedroht. Dass der Kapitalismus nach und nach die alten vormodernen, religiös legitimierten ständischen Ordnungen erodierte, dass er die Jahrhunderte alten normativen und sozialen Schalen der Religion, der Nation, der Geburtsfamilie und zuletzt selbst jene des Geschlechts in einem zuerst langsamen, dann nach und nach sich beschleunigenden Liquidierungsprozess verflüssigte, dass ihm wörtlich „nichts heilig“ ist, außer er sich selbst, das hat gerade die katholische Kirche früh notiert und heftig kritisiert. Im Kapitalismus wuchs ein mächtiger und schließlich siegreicher Konkurrent heran, immer erfolgreicher bei der Prägung von Individuen und Sozialwesen, ebenbürtig an Kraft und Stärke und mindestens ebenso virtuos. Man erkennt diese Gegneridentifizierung nicht zuletzt daran, dass sich die Kirchen nicht scheuten, ihren eigenen Zentralbegriff in denunziatorischer Absicht auf die Zentralkategorie des Kapitalismus anzuwenden und das Geld als den „Gott Mammon“ zu geißeln: eine echte, wenn auch eher ungewollte Anerkennung von Gleichrangigkeit.