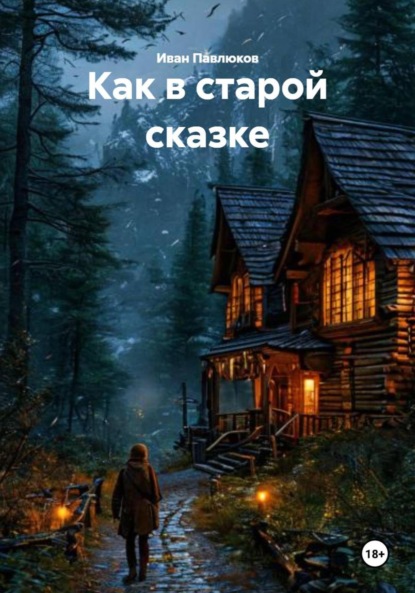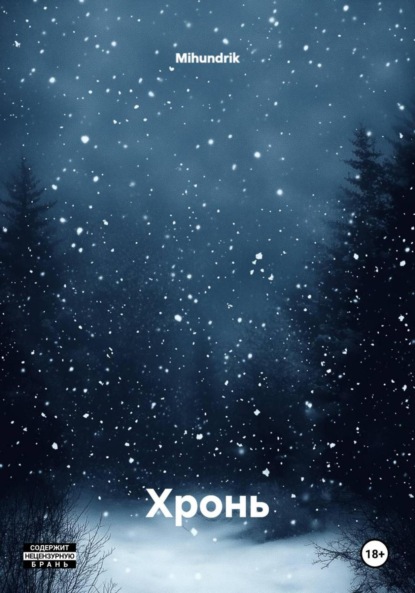- -
- 100%
- +
In all diesen Prozessen spiegelt sich vor allem eines: Die Kirche ist zwar weiterhin ein handlungsfähiges Subjekt, aber eben auch Unterworfene ihrer Zeit, sie ist nicht nur starkes Subjekt, sondern auch sujet, sie kann sich nicht mehr abschirmen von den Orten, an denen sie ist, und dem, was sie für sie bedeuten. Diese Orte sind nicht länger nur Kontexte ihrer selbst, sondern schreiben sich in sie, die Kirche, ein, durchziehen und durchdringen sie, gestalten sie, prägen sie, ob sie will oder nicht.
Pastoraltheologisch ergeben sich aus der neuen Situation der Kirche mindestens vier zentrale Herausforderungen: erstens, wie die Kirche das Netz ihrer pastoralen Handlungsorte von einem religiösen Herrschaftsverband in eine markt- und angebotsorientierte Dienstleistungs-organisation umformatieren kann; wie sie zweitens auf dem religiösen Markt bestehen kann, ohne ihm zu verfallen; drittens, wie sie ihren eigenen Anhängern eine erneute Aufstiegsperspektive vermittelt, obwohl sie diese als Religionsgemeinschaft in Europa nie und nimmer mehr bekommen wird; und viertens und natürlich am wichtigsten, wie sie sich in all dem an der Botschaft Jesu von Gott orientieren kann.
Die Kirche hatte ihre Aufgabe unter den Bedingungen der spätantiken religionspluralen Gesellschaft ebenso zu erfüllen wie im feudalen Mittelalter, als sie ein Teil der gesellschaftlichen Macht war, sogar der entscheidende. Sie hat sie natürlich auch heute zu erfüllen, wo sie wieder (teil-)entmachtet wurde und tatsächlich auf den (religiösen) Markt gekommen ist. Das braucht sie überhaupt nicht zu bedauern. Es steht sowieso nicht in ihrer Verfügungsgewalt, in welchem Kontext sie den Gott Jesu zu verkünden hat. Sie muss sich einfach darauf einstellen. Der Markt hat außerdem viele Vorteile für die Religion, vor allem beraubt er sie der selbstverständlichen Herrschaft über die Einzelnen, und das tut ihr nur gut. Auch macht er möglich, zu kontrollieren, ob Behauptung und Inhalt, Personen und Botschaft halbwegs übereinstimmen – und auch das ist nur gut. Der Markt hat aber auch viele Nachteile: Zum Beispiel neigt er zu Unverbindlichkeit und Konsumhopping. Das ist in den wichtigen Dingen des Lebens aber selten ratsam. Und er hat eine merkwürdige Tendenz zum Niveauverlust. Vor allem aber verführt er dazu, sich um des Markterfolgs willen zu radikalisieren. Auf den globalen Märkten des Glaubens gewinnen die Anhänger von angeblich ganz besonders »rechtgläubigen«, in Wirklichkeit aber nur latent oder offen gewalttätigen Religionsvarianten an Boden. Denn die Kombination aus dem schon länger anhaltenden Säkularisierungsprozess, also der Etablierung religionsunabhängiger gesellschaftlicher Sektoren, und aktueller Globalisierung verführt Religionen dazu, »sich von der Kultur abzulösen, sich als autonom zu begreifen und sich in einem Raum neu zu konstituieren, der nicht mehr territorial und damit nicht mehr der Politik unterworfen ist«16.
Das Leben des Christen und jenes der Kirche sind keine triumphalen Siegesgeschichten, sondern ziemlich gewagte Entdeckungsgeschichten dessen, woran man zu glauben hofft. Was sie wert sind, wird sich erst herausstellen. Das Zentrum des Christentums ist der Glaube, dass sich Gott in Jesus von Nazareth in seiner Liebe für uns erniedrigt hat, dass er Mensch geworden und bis in den Tod hinabgestiegen ist, nur zu einem Zweck: um allen Menschen eine Chance auf Erlösung zu geben.17 Unsere Antwort darauf aber soll sein, den gleichen Weg zu gehen, den Weg der Nächstenliebe und der Demut, der Hoffnung und der Liebe, denn das ist der Weg zu uns und zu Gott.
Die Kirche und alle und alles in ihr haben allein einen Zweck: diese Geschichte, diese Wahrheit, diese Erfahrung zu verkünden. Sie tut es in der Geschichte der Menschheit und also unter den Bedingungen menschlicher Existenz, in der Sündhaftigkeit, die nie weicht, und in der Unvollkommenheit unserer sozialen Verhältnisse und institutionellen Strukturen.
III. Das Scheitern der Gemeindeutopie
» Um die Gesamtheit der Gläubigen zu erreichen, soll in jeder Pfarre die Zellenarbeit durchgeführt werden. Sie besteht darin, daß in planmäßiger Auswahl der Laienapostel die ganze Pfarre durchorganisiert wird. Durch diese Laienapostel ergibt sich die lebendige Verbindung zu allen Familien und Gliedern der Pfarre. Die einzelnen Laienapostel, die den Kern einer Zelle bilden, sind durch ständige Schulung und Anregung in eifriger Tätigkeit zu erhalten.«
Karl Rudolf1
1. »Gemeindetheologie«: Worum es geht
»Überschaubare Gemeinschaften mündiger Christen sollten die anonymen Pfarrstrukturen aufbrechen und an ihre Stelle treten.«2 Das war der Grundgedanke der nachkonziliaren Gemeindetheologie. »Gemeindetheologie« meint hier jenen pastoral-theologischen Transformationsdiskurs, der Mitte der 1960er Jahre praxiswirksam wurde und die Umformatierung der kirchlichen Basisstruktur hin zu jenen »überschaubaren Gemeinschaften mündiger Christen« initiierte.
»Gemeinde« war konzipiert als Nachfolgestruktur der als anonym, bindungs- und entscheidungsschwach wahrgenommenen volkskirchlichen Pfarrstruktur.3 Man kann diesen Diskurs tatsächlich Gemeindetheologie nennen, denn eines seiner charakteristischen Merkmale war die dezidiert theologische Selbstbegründung. Das unterschied ihn deutlich von dem bis dahin für Organisation und Legitimation kirchlicher Basisstrukturen primär zuständigen kirchenrechtlichen Diskurs.
Ein weiteres Merkmal dieses Diskurses und ebenfalls Konsequenz seiner Herkunft aus der Theologie war, alle kirchlichen Handlungsstrategien zumindest konzeptionell auf diesen Umbauprozess zu zentrieren. Es galt eben tatsächlich das »Prinzip Gemeinde«4, es galt die Maxime »Kirche als Gemeinde«5. Dieser Umformatierungsprozess hatte zugleich extensiven wie intensivierenden Charakter. Ferdinand Klostermann nennt als Ziel des Gemeindebildungsprozesses, »dass in (einer) Pfarrei möglichst viele Menschen eine möglichst genuine Gemeinde Jesu, des Christus, erleben können«, »dass die Pfarrei ein konkreter Ort wird, an dem möglichst vielen Pfarrangehörigen, aber auch anderen im Pfarrgebiet wohnenden Menschen die Glaubenserfahrungen Jesu weitervermittelt werden können«. Dazu sollen »möglichst viele in christliche Gruppen und Gemeinden«6 eingebunden werden. Intensivierung und extensive Erfassung gleichzeitig also waren angezielt. Das Ergebnis sollte die »menschliche, brüderliche, offene und plurale Pfarrei«7 sein.
Zentrale Bezugsgröße der Kirchenmitgliedschaft war also nicht mehr die römisch-katholische Kirche mit dem Papst an der Spitze, sondern der überschaubare Nahraum einer kommunikativ verdichteten, letztlich nach dem Modell einer schicksalhaft verbundenen Großfamilie gedachten »Gemeinde«. Soziologisch angesiedelt jenseits der Mikroebene der Primärbeziehungen, aber diesseits der Makroebene einer »anonymen« Gesellschaft, wurde die »Gemeinde« zur Hoffnungsträgerin einer sich erneuernden Kirche. Es winkte das Versprechen einer Kontrastgesellschaft gegen die zweckrationale Außenwelt, aber auch gegen die vorkonziliare römisch-katholische Welt. Aus diesen Gegensätzen bezog der gemeindetheologische Diskurs viel von seinem attraktiven Kontrastpathos.8
Diskursive Marker dieses Wechsels waren neben dem Kontrast von »Gemeinde« und »Pfarrei« Formeln wie: »Die Gemeinde ist Subjekt der Pastoral« versus die »Gläubigen als bloße Objekte der Seelsorge« oder »der reife, mündige, denkende, … freie, dabei fromme, gläubige Christ« versus den »hörende(n), blind-gehorchende(n) unkritische(n), problemlose(n), sogenannte(n) ›einfache(n)‹, schlichte(n) Christ(en)«.9
2. Genese der Gemeindetheologie
Katholischerseits kommt man erst recht spät zum Konzept der überschaubaren, kommunikativ verdichteten Gemeinde. Überschaubarkeit wird zwar für die katholische Pastoralmacht zu Beginn der Neuzeit eine immer wichtigere Zielgröße, das Konzil von Trient (1546–1563) ordnete »die Pfarrseelsorge neu, indem es ›Hirt und Herde‹ (Pfarrer und Pfarrei) in ein überschaubares Zueinander bringt.«10 Die Gemeindegröße war bis dahin offensichtlich nie thematisiert worden. »Eine bewusst gewollte Überschaubarkeit … ist für die städtische Bischofskirche der Spätantike keine Kategorie«. Bis Trient galt: »Wer intensiver, überschaubarer und personenzentriert christliche Gemeinschaft leben will, zieht sich ins Kloster zurück.«11
Es hat gedauert, bis die quasi-familiär verbundene Gemeinde zur Basis katholischen Organisationsdenkens wurde. Erst Anfang der 70er Jahre des 20. Jahrhunderts setzte sich diese Variante der Gemeindetheologie endgültig durch, dann aber recht schnell. Durch die Bildung verdichteter, überschaubarer Gemeinschaften unterhalb der Pfarrebene wollte man jetzt dem einsetzenden kirchlichen Erosionsprozess gegensteuern. Der gemeindetheologische Diskurs reagiert deutlich auf die Säkularisierungserfahrung des sich auflösenden katholischen Milieus. Für Klostermann spielt die These, »dass im allgemeinen der Kirchenbesuch mit der wachsenden Pfarreigröße abnimmt«, eine zentrale Rolle in der Begründung seines gemeindetheologischen Projekts. Er entwickelt aus diesem Befund »die pastorale Notwendigkeit von Pfarrteilungen bzw. gemeindlichen Substrukturen unserer städtischen Großpfarreien« und fordert die »Erhaltung der Kleinpfarreien … als echte Gemeinden«, auch »auf dem Lande«12.
Der gemeindetheologische Diskurs knüpft an die Tradition des genuin anti-liberalen, demokratie-kritischen »organischen Denkens«13 der Zwischenkriegszeit an, wie es innerkirchlich Romano Guardini exemplarisch formuliert hat und wie es zusammengefasst werden kann in der Maxime: »Nicht mehr das subjektiv-individualistische Denken herrsche vor, sondern eine organisch geprägte Form, in der die Kirche als Gemeinschaft der Vielen entdeckt wird, geeint in Gott«14.
Die Gemeindetheologie startet als ungemein wirkmächtiger Diskurs. Wahrscheinlich war Pastoraltheologie seit Maria Theresias Zeiten nie so einflussreich. Konzeptionell war dieser Diskurs zumindest im deutschsprachigen Raum bis in die Mitte der 1990er Jahre praktisch alternativlos, mag auch die Realität schon länger anders ausgesehen haben.15
3. Das Scheitern
Ohne Zweifel besitzt die Gemeindetheologie echte Verdienste. Sie war ein Fortschritt in ihrer positiven Sicht der gläubigen Subjekte, in ihrer beginnenden Überwindung eines patriarchalen bis paternalistischen pastoralen Umgangsstils und in ihrer Option für eine basisnahe Sozialform von Kirche. Ein zentrales Problem war die Priorität der Vergemeinschaftungsorientierung und die Nachrangigkeit der Aufgabenorientierung, dies etwa im Unterschied zu den »Basisgemeinden« Lateinamerikas.16 Nichts zeigt dies übrigens besser als das zentrale Leitwort dieses Ansatzes, die »lebendige Gemeinde«. Sie benennt weder Ziel noch Zweck der Verlebendigungsbemühungen und selbst jene, die sie leisten sollen, werden nicht erwähnt. Nicht die Sozialform steht im Dienst der Gläubigen, sondern diese im Dienst der Sozialform. Es ging also in typischer deutscher Tradition vor allem um Gemeinschaftsbildung und -erfahrung.17
Die Gemeindetheologie war der letzte Ausläufer des tridentinischen Projekts. Wie dieses suchte sie den Erosionsprozessen kirchlicher Sozialräume durch Verdichtung, Formierung und Überschaubarkeit gegenzusteuern, wenn auch diesmal unter typisch modernen Kategorien wie »Mündigkeit«, »Subjekt« und »Modernität«. Dies geschah auf familiaristischer Basis, schien doch damals die Familie die letzte stabile Sozialform der Moderne. Aber wie sich auch an der »Pfarrfamilie« erweisen sollte: dem war nicht so.
Der Versuch, die katholische Kirche von einer amtszentrierten Heilsinstitution zur quasi-familiären gemeindlichen Lebensgemeinschaft umzuformatieren, ist denn auch nicht am Widerstand der alten Kirchenformation gescheitert, sondern an seinem Charakter als halbierte, ja selbstwidersprüchliche Modernisierung, einem Widerspruch, wie er etwa schon in Klostermanns Doppelziel von Intensivierung und Expansion zum Ausdruck kommt. Die gemeindetheologische Modernisierung wollte freigeben (»mündiger Christ«) und gleichzeitig wieder in der »Pfarrfamilie« einfangen. Sie wollte Priester und Laien in ein neues gleichstufiges Verhältnis bringen bei undiskutierbarem Leitungsmonopol des priesterlichen »Vorstehers«. Sie wollte eine Freiwilligengemeinschaft sein, die aber auf ein spezifisches Territorium bezogen sein sollte, sie wollte für alle da sein, war es aber doch für immer weniger. Und man verengte die ehemals extrem aufgespannten Partizipationsgrade an Kirche zwischen Minimalpartizipation am unteren kirchenrechtlichen (und doch »heilsgewissen«) Rand und Totalhingabe auf das berühmte »aktive Gemeindemitglied« ausgerechnet zu jenem Zeitpunkt, als die Einzelnen die Lizenz zu sanktionsfreier religiöser Praxis bekamen.
Diese Selbstwidersprüchlichkeiten einer halbierten Modernisierung blieben nicht folgenlos. Aus ihrer inneren Widersprüchlichkeit entwickelten sich äußere Paradoxien: Die Gemeinde sollte das Leben in Christus vermitteln und musste doch offenbar selbst ständig »verlebendigt« werden, sie war auch in ihrem eigenen Selbstverständnis kein Selbstzweck, zog aber alle Bemühungen und Initiativen auf sich, sie war plötzlich die »Summe und Pointe aller Pastoral«18, und doch expandierten die nicht-gemeindlichen Handlungssektoren der Kirche, also Diakonie, Kategorialpastoral oder Bildungsarbeit, weit stärker.
Der Kern der Selbstwidersprüchlichkeit des gemeindetheologischen Konzepts gründet in seinem ambivalenten Verhältnis zur Freiheit. Diese Ambivalenz aber rührt aus dem Status der Gemeindetheologie als kriseninduziertes Rettungsprogramm. Ähnlich wie das Papsttum im späten 19. Jahrhundert – und daher auch ähnlich emotional aufgeladen – zog die Gemeindetheologie enorme Rettungsphantasien einer durch die moderne liberale Gesellschaft und ihre ganz anderen Lebensstile unter Druck geratenen Kirche auf sich – wenn auch diesmal bei den eher modernitätsfreundlichen Teilen der Kirche. Doch in einem kommt sie mit der forcierten Papstkirche der Pianischen Epoche überein: Durch Aufbau, Ausbau und theologische Unterfütterung einer spezifischen Sozialform von Kirche sollten die freiheitsbedingten Erosionsprozesse kirchlicher Konstitution gestoppt werden.
Die Gemeindetheologie formuliert somit ein spezifisches innerkirchliches sozialtechnologisches Projekt. Sie verspricht Vergemeinschaftung jenseits der Repression einer »unverlassbaren« Schicksalsgemeinschaft und doch diesseits der unheimlichen und ungebändigten Freiheit des Einzelnen. Deshalb thematisiert die Gemeindetheologie auch primär Sozialformen, nicht aber pastorale Inhalte. Diese werden immer noch als Selbstverständlichkeit behandelt, mag diese Selbstverständlichkeit, etwa in der Sakramentenpastoral, auch noch so unübersehbar hinfällig geworden sein. Ähnlich wie beim Papsttum will man über eine institutionelle Struktur sichern, was in der liberalen Gesellschaft gefährdet erscheint: die Tradierung des Christlichen.
Dass dieses Projekt scheitern musste, erklärt sich aus seiner inneren Selbstwidersprüchlichkeit, dass es gerade in seiner intendierten Rettungswirkung scheiterte, ist offenkundig: Die Bindewirkung des gemeindlichen Milieus hat, nimmt man die Kirchgängerzahlen als Grundlage, seit 1950 um ca. 70 % abgenommen.19 Nicht dieser Vorgang an sich – er ist nicht so sehr der Gemeinde als vielmehr dem generellen Kontextwechsel kirchlicher Konstitution zuzuschreiben – als vielmehr die Tatsache, dass auch der gemeindetheologische Umbau praktisch keine Spuren in dieser linearen Reduktion kirchlicher Partizipation hinterlassen hat, ist bemerkenswert.
Zudem laufen praktisch alle ressourcenbedingten aktuellen pastoralplanerischen Initiativen darauf hinaus, das klassische »Normalbild« einer um den Pfarrpriester gescharten, überschaubaren, lokal umschriebenen, kommunikativ verdichteten Glaubensgemeinschaft aufzulösen. »Pfarreien werden zusammengelegt und so die pastoralen Räume vergrößert. Das bedeutet, dass ein Priester für weitaus mehr Gläubige zuständig ist als zuvor.«20 Dieser Prozess, gegenwärtig vielfach beklagt, vollzieht, wenn auch aus ganz anderen und nicht unbedingt guten Gründen, kirchenzentral nach, was die meisten Katholiken und Katholikinnen schon vorher von sich aus getan haben: den Abschied von der Utopie der »Gemeinde« als Gegenwelt unverstellt-personaler Kommunikation und realer Inklusion in einer Welt instrumenteller Kommunikation und Exklusion. Michael Ebertz hat Recht, wenn er feststellt, es sei »schon merkwürdig, dass … dieser so offensichtlich negative Ausgang eines gewissermaßen historischen Experiments immer noch ignoriert werden kann«21. »Die meisten getauften und gefirmten Katholiken … verspüren schlicht kein Interesse an den hohen religiösen Ansprüchen der Gemeindebewegung und an der damit verbundenen Neuverteilung der religiösen Arbeit, die nun den Laien zugemutet wird. Sie haben schlicht andere Sorgen und Relevanzen.«22
4. Die Gemeinde und die Zulassungsbedingungen zum Priestertum
Nun ist die jüngere pastoraltheologische Diskussion um die »Gemeinde« nicht nur sehr kontrovers, sondern auch argumentativ ausgesprochen extensiv verlaufen.23 Den großen Hoffnungen, mit denen die Gemeindetheologie startete, entsprechen die Emotionen, welche ihre aktuelle pastoraltheologische Problematisierung immer noch freisetzt. Dies ist verständlich, zumal gleichzeitig, wenn auch mehr oder weniger unabhängig davon, die damals angestrebte Gemeindeverfassung der katholischen Kirche in den aktuellen Umbauprozessen ihrer Basisstruktur24 tatsächlich zunehmend aufgelöst wird.
Diese zudem oft lebensgeschichtlich tief eingeschriebene Brisanz des Gemeindethemas hat zu einigen problematischen Verknüpfungen mit anderen Themen geführt. Diese Verknüpfungen sind möglich, behindern aber analytisch eher den Blick. Konkret betreffen sie die Frage der Zulassungsbedingungen zum Priesteramt, das Verhältnis von Individuum und Gemeinschaft in christlicher religiöser Praxis sowie die Frage nach der notwendigen Verortung kirchlicher Pastoral in der räumlichen Fläche.
Ohne Zweifel sind die gegenwärtigen Zulassungsbedingungen zum katholischen Amtspriestertum ausgesprochen diskussionswürdig, vor allem unter Gerechtigkeits-, Qualitäts- und amtstheologischen Gesichtspunkten. Die Gemeindeproblematik dürfte aber kein geeigneter Hebel sein, um hier relevanten Veränderungsdruck aufzubauen. Das Konzept »Gemeinde« als eine kommunikativ verdichtete, überschaubare Lebens- und Glaubensgemeinschaft unter priesterlicher Leitung ist innerkatholisch viel zu jung, um als Gegengewicht gegen jene alten Traditionen anzukommen, die das Priestertum dem unverheirateten Mann reservieren.
Es wäre sicher wünschenswert und grundsätzlich, etwa einem Konzil, auch möglich, die Zulassungsbedingungen zum katholischen Weihepriestertum einer pastoraltheologischen wie einer systematisch-theologischen Evaluierung zu unterziehen. Dies wird in absehbarer Zeit aber wohl nicht geschehen, zu tief sind Ordnungen der Geschlechterdifferenz und Ordnungen des Religiösen auch in unserer Kirche amalgamiert. Die schwerwiegendste Konsequenz der gegenwärtigen Zulassungsbedingungen wird auch nicht einmal so sehr der wegen des Priestermangels notwendige Umbau der pastoralen Basisorganisation sein als vielmehr die zuerst schleichende, dann sich aber rapide beschleunigende kulturelle Entfremdung, ja Exkulturation der katholischen Kirche von einer Gesellschaft, die normativ, zunehmend aber eben auch real auf eine ganz andere Geschlechterchoreografie umgestellt hat und in der die alten Begründungsmuster für Geschlechterasymmetrien massiv an Plausibilität verloren haben.25
Die Seelsorgeämter drehen denn auch an anderen Stellschrauben, um den potentiellen Veränderungsdruck auf die Zulassungsbedingungen zu verringern: Sie holen ausländische Priester und/oder vergrößern die priesterlichen Zuständigkeitsräume. Damit steht also ein relativ neues und rechtlich wenig gesichertes Konzept – die »Gemeinde« – gegen eine (kirchen-)politische Realität, die dieses Konzept bei einiger organisationsentwicklerischer Virtuosität ganz erfolgreich umspielen kann. Politisch ist das eine ganz und gar unbefriedigende Situation: Der einklagende pastoraltheologische Diskurs steht gegen institutionelle Macht und Raffinesse. Der Diskurs gewinnt da selten. Zumal die gemeindlichen Mauern nicht nur von außen durch die Seelsorgeämter, sondern auch von innen durch die Katholikinnen und Katholiken selbst gesprengt wurden.
Die für unsere Kirche existenzentscheidende Frage, wie ein amtstheologisch, pastoral und nicht zuletzt personal verantwortbarer Entwicklungspfad des katholischen Amtspriestertums nach der Auflösung der sanktionsgestützten »Konstantinischen Formation« der Kirche ausschauen könnte, dürfte mit der Verlängerung jenes letztlich paternalistischen Amtskonzepts, wie es die Gemeindetheologie vertritt,26 nicht wirklich beantwortet sein.27
5. Individualisierung versus Vergemeinschaftung
Auch die Verknüpfung der Gemeindeproblematik mit der Frage Vergemeinschaftung versus Individualisierung dürfte nicht weiterführend sein. Das zentrale ekklesiale Problem der Pianischen Epoche war strukturell die mangelnde Freiheit und inhaltlich die Unfähigkeit, eigene Gehalte außerhalb der Kirche als solche zu identifizieren. Das zentrale Problem der kirchlichen Gegenwart, zumindest in unseren Breiten, ist strukturell die Schwierigkeit von Gemeinschaft und material die Setzung der Differenz des Eigenen innerhalb des allgemein Religiösen.
War in der Pianischen Epoche die Gemeinschaft des Kirchlichen die Selbstverständlichkeit und die Freiheit das Unselbstverständliche, so ist heute die Freiheit vom Kirchlichen die Selbstverständlichkeit und die kirchliche Gemeinschaft das Unselbstverständliche. Die Alternative lautet also nicht: religiöser Individualismus versus gemeindliche Vergemeinschaftung. Denn die Freigabe zu religiöser Selbstbestimmung auch für Katholiken und Katholikinnen ist eine soziale Tatsache, im Übrigen eine erst einmal ausgesprochen erfreuliche. Es geht vielmehr darum, wie heute noch ekklesiale Sozialität möglich ist, und dies jenseits ihrer mehr oder weniger hilflosen Einforderung durch die Propagierung quasi-selbstverständlicher Sozialformen von Kirche.
Alfred Dubach hat zutreffend bemerkt, dass es überhaupt nichts nützt, die eigenen, prekär gewordenen Vergemeinschaftungsformen dadurch retten zu wollen, dass man passenderweise eine angebliche »Sehnsucht vieler Menschen nach Gemeinschaft« als »Zeichen der Zeit«28 identifiziert. Die »strukturelle Individualisierung moderner Gesellschaften«, so Dubach, werde von den kirchlichen Autoritäten »als beängstigend und bedrohlich erfahren«. Dies lasse die Kirchenleitungen in ihrer »Sorge um die eigene Institution« dann »nicht auf eine Kultivierung moderner Freiheitsambitionen setzen«, vielmehr solle über »dichte kohäsive Sozialbeziehungen … kollektive Identität mit den Überzeugungen der Kirche erreicht werden.«29 Auch das gemeindekirchliche Konzept folgt noch deutlich diesem Muster.
Vergemeinschaftungsformen scheinen heute sehr milieuspezifisch zu sein,30 und es gilt wohl eher der Satz, mit dem ein evangelischer Sammelband zum Problem beginnt: »Feste Zugehörigkeiten sind ungewöhnlich geworden. Sie werden vermisst, wenn sie fehlen; sie stören mehr oder weniger, wenn sie gegeben sind.«31 Die Grundfrage von Kirchenbildung unter spätmodernen Bedingungen ist eben nicht, wie viel Gemeinschaft gegen den Freiheitsdrang des Einzelnen noch gerettet werden kann, sondern: »Wie stiftet Freiheit ekklesiale Sozialität?«32
Die Alternative lautet daher nicht: religiöser Individualismus gegen gemeindliche Vergemeinschaftung, so als ob es diese an jenem vorbei heute noch gäbe. Es geht vielmehr um die unter diesen Bedingungen heute möglichen Vergemeinschaftungsformen von Kirche. Dass sich dabei wie »auf vielen Feldern des gesellschaftlichen Lebens … auch hinsichtlich der religiös-kirchlichen Praxis der Menschen Prozesse der Delokalisierung und der Relokalisierung zugleich beobachten«33 lassen, ist unbestritten, immer aber finden sie unter modernen Freiheitsbedingungen statt.