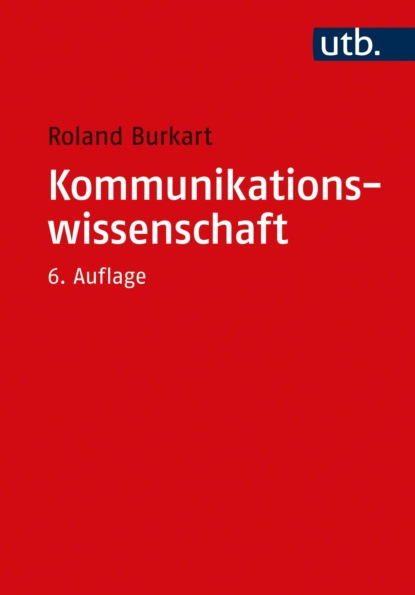- -
- 100%
- +
Hat man also die Gesamtheit jener Menschen im Auge, die man via Massenkommunikation erreicht, so scheint es in der Tat angemessener zu sein, anstatt von „Masse“ hier (mit Gerhard Maletzke 1963: 28 f.) von einem Publikum zu sprechen. Dabei denkt man zunächst wahrscheinlich an ein Präsenzpublikum: Es entsteht, wenn Menschen zu einer bestimmten Zeit an einem bestimmten Ort anwesend (präsent) sind und eine Aussage oder Darbietung auf sich einwirken lassen (wie z. B. ein Theaterstück, einen Vortrag, ein Konzert, eine Kundgebung etc.). Maletzke führte deshalb den Terminus disperses Publikum ein und fokussiert damit auf Individuen, aber auch kleine Gruppen, deren verbindendes Charakteristikum v. a. darin besteht, dass sie sich Aussagen der Massenmedien zuwenden.
Disperse Publika sind keine überdauernden, sondern flüchtige soziale Gebilde, sie entstehen immer nur „von Fall zu Fall dadurch, dass sich eine Anzahl von Menschen einer Aussage der Massenkommunikation zuwendet“ (Maletzke 1963: 28). Zwischen den Mitgliedern eines derartigen dispersen Publikums existieren in der Regel keine direkten zwischenmenschlichen Beziehungen, denn üblicherweise sind die Rezipient·innen (oder Rezipient·innen-Gruppen) räumlich voneinander getrennt, gegenseitig anonym und wissen lediglich, dass außer ihnen noch zahlreiche andere Menschen dieselbe Aussage aufnehmen (ebd.: 29).
Schließlich sind disperse Publika noch vielschichtig inhomogen, d. h., sie umfassen Personen, die aus verschiedenen sozialen Schichten stammen, deren Interessen, Einstellungen, deren Lebens- und Erlebensweise oft sehr weit voneinander abweichen, überdies sind sie unstrukturiert und unorganisiert: Ein disperses Publikum „weist keine Rollenspezialisierung auf und hat keine Sitte und Tradition, keine Verhaltensregeln und Riten und keine Institutionen“ (Maletzke ebd.: 30). Damit ist klargestellt: Der Wortbestandteil „Masse“ im Terminus Massenkommunikation ist im Sinn des dispersen Publikums zu verstehen.
Kommunikation kann allerdings nicht ohne ein Medium stattfinden – dies wurde bereits weiter oben (Kap. 2.4) herausgearbeitet. Daher gilt hier, dass ein Massenmedium nötig ist, damit Massenkommunikation stattfinden kann. Der Soziologe Alphons Silbermann hat Massenmedien seinerzeit treffend als „Techniken der Kollektivverbreitung“ (1969: 673) bezeichnet, die Aussagen via Schrift, Bild und/oder Ton, optisch bzw. akustisch (audiovisuell) an eine unbestimmte Vielzahl von Menschen vermitteln (ähnlich bereits: Maletzke 1963: 36). Zu diesen Massenmedien zählen: Flugblatt/Flyer, Plakat, Presse, Buch, Hörfunk, Fernsehen, Film, heute auch Websites sowie potenziell alle Speichertechniken analoger (Bild, Tonband/Musik-/ Videokassette, Schallplatte) oder digitaler (CD/DVD, Festplatten/Speicherkarten) Natur. Potenziell meint: Sie sind nur dann als Massenmedien zu begreifen, wenn sie – und das ist der entscheidende Punkt(!) – zur öffentlichen Verbreitung von Aussagen eingesetzt werden. Denn nach wie vor gilt das, was bereits oben (Kap. 2.4) – im Kontext des publizistischen Medienbegriffes (nach Ulrich Saxer) – festgestellt worden ist: Man greift zu kurz, wenn man allein die Technizität des Mediums als ausreichendes Definiens für das Definiendum Massenmedium begreift.
So ist ein als Privatdruck (d. h. für einen genau definierten Empfänger·innenkreis) produziertes Buch ebenso wenig ein Massenmedium, wie eine gedruckte Einladung, die im Verwandten- und Freundeskreis versendet wird. Auch die Hörfunk- und Fernsehtechnik kann man für vielerlei Zwecke einsetzen: etwa für den Küstenfunk, in der Militärüberwachung, zur Beobachtung des Straßenverkehrs, zur Überwachung von Kaufhausabteilungen oder auch zu Lehrzwecken – aber in all diesen Fällen fungieren diese Medien nicht als Massenmedien, weil die Aussagen (bzw. Inhalte) nicht öffentlich, an eine unbegrenzte Vielzahl von Menschen, sondern privat an einen relativ eindeutig definierbaren Empfänger·innenkreis vermittelt werden.
Anlass zu ähnlichen Unklarheiten im Begriff Massenkommunikation gibt freilich auch der Wortbestandteil Kommunikation. Hier ist v. a. danach zu fragen, ob (und wenn ja: inwieweit) der im Rahmen dieses Buches entwickelte Kommunikationsbegriff mit dem begrifflichen Inhalt von Massenkommunikation in Einklang gebracht werden kann.
Kommunikation im Begriff Massenkommunikation
So wie die ursprüngliche Form der interpersonalen Kommunikation eine unmittelbare, direkte (face-to-face) Begegnung zwischen den Kommunikationspartner·innen darstellt, so ist im typischen Modus der Massenkommunikation eine räumliche Distanz (z. B. bei Live-Übertragungen), in der Regel sogar eine raum-zeitliche Trennung zwischen Kommunikator(en) und Rezipienten vorhanden: das Plakat, der Flyer, das Buch, die Zeitung, die Hörfunk- oder Fernsehsendung, der Film oder auch ein Web-Auftritt werden in der Regel an einem anderen Ort und zu einer anderen Zeit rezipiert, als sie produziert worden sind. In seiner „klassischen“ Begriffsbestimmung typisiert Maletzke (1963: 21 f.) die Massenkommunikation daher als indirekte Kommunikation.
Außerdem hat man es in der Massenkommunikation üblicherweise mit einer Polarisierung der kommunikativen Rollen zu tun: Es fehlt der für die direkte zwischenmenschliche Begegnung so typische, gegenseitige Rollentausch zwischen den Kommunikationspartner·innen, eine unmittelbare Rückkoppelung zwischen Kommunikator·innen und Rezipient·innen ist demnach nicht gegeben. Seit Maletzke (ebd.) gilt Massenkommunikation daher auch als einseitige Kommunikation.
Fraglos ist dieses Merkmal der Einseitigkeit in vielen Fällen, in denen Massenkommunikation heute längst via Internet und damit computervermittelt stattfindet, „durchbrochen“, es trifft „nicht mehr uneingeschränkt zu“ wie Heinz Pürer (2014: 78) zu Recht konstatiert: Von Leser·innen (User·innen) gepostete Kommentare auf online publizierte journalistische Artikel sind zweifelsfrei (indirekte) Rückkoppelungen zwischen Kommunikator·innen und Rezipient·innen, die den traditionellen Leserbrief (Heupel 2007, Mlitz 2008) oder auch die Möglichkeit, sich in Phone-In-Sendungen zu Wort zu melden (Wulff 1998), ziemlich alt aussehen lassen. Onlinemedien können zudem ihr digitales Angebot jederzeit aktualisieren, allenfalls auf E-Mails, Posts, Tweets u. Ä. reagieren etc. (Pürer 2014: 280 ff.).3
Dennoch: Aller Dialog- und Interaktivitätseuphorie4 zum Trotz verbleiben die tatsächlichen Aktivitäten im „Mitmachnetz“ bislang auf „niedrigem Niveau“ (Busemann/Gscheidle 2011). Die herkömmliche einseitige Massenkommunikation hat zwar durch Social Media und Co. längst ihr Alleinstellungsmerkmal verloren, aber von einer Abwendung des Publikums kann keine Rede sein. Zwar sehen junge Menschen seit 2015 tendenziell weniger fern, aber die (einseitige) Bewegtbildnutzung nimmt zu (bedingt durch Streamingangebote) und auch mit linearem Fernsehen verbringen die 14- bis 29-Jähringen noch fast eine ganze Stunde täglich (Breunig/Handel/Kessler 2020: 419). Man kann also auch im dritten Jahrzehnt des dritten Jahrtausends noch davon ausgehen, dass die einseitige Massenkommunikation kein Schattendasein führt.
Schließlich ist noch der Personenkreis, an den die Aussagen gerichtet sind, weder eindeutig festgelegt noch (quantitativ) begrenzt. Im Gegensatz zu privater Kommunikation, die sich an einen relativ eindeutig definierbaren Empfänger·innenkreis richtet, handelt es sich bei Massenkommunikation grundsätzlich um öffentliche Kommunikation, denn die Kommunikator·innen wissen nicht, wie viele Menschen sie mit ihren Botschaften tatsächlich erreichen (Pfetsch/Bossert 2013: 248). Diese „prinzipielle Unabgeschlossenheit des Publikums“ (Habermas 1990: 98) ist typisch für die Massenkommunikation.
Man kann daher auch noch zu Beginn des dritten Jahrtausends, im Sinn der längst „klassischen“ Definition von Maletzke (1963: 32)
Massenkommunikation als einen Prozess begreifen, bei dem Aussagen öffentlich (d. h. ohne begrenzten oder personell definierten Empfänger·innenkreis), indirekt (d. h. bei räumlicher oder zeitlicher oder raum-zeitlicher Distanz zwischen den Kommunikationspartner·innen) und (in der Regel) einseitig (d. h. ohne Rollenwechsel zwischen Kommunikator·in und Rezipient·in), durch technische Verbreitungsmittel (nämlich: Massenmedien) an ein disperses Publikum vermittelt werden.
Soweit die Klassifikation des Massenkommunikationsprozesses nach den beobachtbaren, mehr oder weniger formalen Kennzeichen des Kommunikationsgeschehens. Wie verhält es sich aber, wenn man die oben, handlungstheoretisch (im Anschluss an Max Weber) hergeleiteten Interessen und Ziele der in den Kommunikationsprozess involvierten Personen mitdenkt, wenn man also auch Massenkommunikation als eine Form sozialen Handelns begreift?
Massenkommunikation und soziales Handeln
Schon sehr früh wurde hervorgehoben, dass es sich beim Massenkommunikationsprozess um einen Vorgang handelt, „in dem spezielle soziale Gruppen technische Einrichtungen anwenden, um einer großen, heterogenen und weitverstreuten Zahl von Menschen symbolische Gehalte zu vermitteln“ (Janowitz/Schulze 1960: 1). Es erscheint somit durchaus angemessen, diese sozialen Gruppen bzw. deren Mitglieder als „Kommunikator·innen“ und deren Aktivitäten als „kommunikatives Handeln“ zu begreifen – ganz im Sinn des Begriffsverständnisses, wie es im Kap. 2 dieses Buches entwickelt worden ist.
Man kann freilich diese Angemessenheit grundsätzlich infrage stellen, wie das schon vor vielen Jahren z. B. der Soziologe Janpeter Kob prononciert getan hat, für den im Phänomen der „Massenpublizistik“ nur „sehr verkrampft […] eine Art von Kommunikation“ (Kob 1978: 393) zu erkennen war. Kob sprach in diesem Zusammenhang sogar von einem „Kommunikationsmythos“ (1979: 4973), der sich nicht zuletzt infolge der Bezeichnung „Massenkommunikation“ eingebürgert habe: In Wahrheit werde hier nämlich „nicht zwischen irgendwelchen Personen kommuniziert, sondern es werden – mit den unterschiedlichsten Intentionen – publizistische Produkte genutzt“ (ebd.: 4976).5 Schließlich sei auch die Merkmalsbestimmung „einseitige Kommunikation“ (als deren Folge sich erst das „disperse Publikum“ ergebe, weil man eben nicht wisse, mit wem man kommuniziere) eine typische Contradictio in adjecto: „Einseitig kann keine Kommunikation sein, selbst die schlichteste Vorstellung von ihr muss Wechselseitigkeit implizieren“ (ebd.) und deshalb handle es sich bei Massenkommunikation eben nicht um Kommunikation.
Hier übersieht Kob allerdings, dass Maletzke mit „einseitiger“ Kommunikation lediglich auf die Polarisierung der kommunikativen Rollen hinweisen wollte, wie sie z. B. auch im Rahmen einer Kommunikation via Brief oder auch während eines Vortrags stattfindet. Die von Kob (zu Recht) vertretene Ansicht von der unbedingten Wechselseitigkeit jeder Kommunikation bezieht sich dagegen auf das im vorliegenden Buch mit implizite Reziprozität bezeichnete Merkmal von Kommunikation. Danach kann erfolgreiche Bedeutungsvermittlung (also: gelungene Kommunikation bzw. Verständigung) nur dann zustande kommen, wenn einer Mitteilungs-Handlung seitens des·der Kommunikator·in auch eine Verstehens-Handlung seitens der Rezipient·innen entspricht. Dieses kommunikative Handeln auf beiden Seiten muss aber nicht unbedingt mit einem Rollenwechsel (bei Maletzke: mit gegenseitiger Kommunikation) verbunden sein.
Als Zwischenbilanz der Begriffserklärung von Massenkommunikation lässt sich somit festhalten:
Die mit Hilfe technischer Verbreitungsmittel vorgenommene Vermittlung von Aussagen an disperse Publika ist zweifellos ein kommunikatives – d. h. auf Verständigung hin angelegtes – Geschehen, das jedoch nicht generell a priori (also bevor es stattfindet) und auch nicht in jedem Fall ex post (nachdem es stattgefunden hat) als „Kommunikation“ begriffen werden kann und soll. Dennoch: Die Chance, dass eine – auf Basis der impliziten Reziprozität kommunikativer Handlungen angestrebte – Verständigung zwischen einem·einer Kommunikator·in und wenigstens einem Teil des dispersen Publikums tatsächlich zustande kommt, ist in der Regel vorhanden.
Der Prozess der Massenkommunikation kann somit sehr wohl als ein grundsätzlich kommunikatives Geschehen verstanden werden, in dem Kommunikation auch tatsächlich gelingen kann, aber nicht notwendigerweise gelingen muss.
Was nun die spezielle Intention kommunikativen Handelns (also: das Interesse des jeweils Handelnden) sowie das variable Ziel (die Realisierung seines jeweiligen Interesses) betrifft, so scheint hier eine weitere Besonderheit massenmedial verbreiteten kommunikativen Handelns vorzuliegen: Man kann eine Übergewichtung des „situationsbezogenen“ Interesses6 unterstellen. Ich würde sogar die These vertreten, dass bei (vielen) öffentlichen Aussagen das inhaltsbezogene Interesse von einem bestimmten situationsbezogenen Interesse überlagert, wenn nicht sogar dominiert wird.
Interesse an Publizität
Publizität meint (im Anschluss an Groth 1960) „die grundsätzliche Zugänglichkeit der Aussage für jedermann“ (Merten 1999: 147). Publizität ist die unumstößliche Konsequenz der Veröffentlichung einer Aussage via Massenkommunikation. Im Prinzip kann dann jeder von der vermittelten Botschaft wissen, niemand ist vom Empfang des Inhalts ausgeschlossen (Groth 1998: 49 ff.).7
Das bedeutet im Klartext: Diejenigen, deren kommunikatives Handeln infolge seiner massenmedialen Verbreitung öffentlichen Charakter gewinnt, schöpfen bereits aus dem Umstand, dass sie mit ihren Äußerungen öffentliche Präsenz gewinnen, eine zentrale Motivation zur Produktion von Aussagen. Damit soll keineswegs die Existenz eines „inhaltsbezogenen“ Interesses öffentlicher kommunikativer Handlungen geleugnet werden. Der Hinweis auf die Übergewichtung dieses speziellen „situationsbezogenen“ Interesses deutet vielmehr auf eine grundsätzlich neue Qualität kommunikativen Handelns hin, die dieses erst durch seinen öffentlichen Charakter gewinnt.
Dazu sei abermals auf Kob verwiesen, der in diesem Zusammenhang von der „Attraktion der Publizität“ (1978: 394) spricht. Publizität stellt für ihn nicht nur einen elementaren Anlass für öffentlich-kommunikatives Handeln dar, er sieht darin auch eine zentrale Motivation der Zuwendung seitens derer, die diese veröffentlichten Aussagen rezipieren. Für beide Seiten (Kommunikator·innen wie Rezipient·innen) sei es nämlich vorrangig diese Attraktion der Publizität, die sie zum Handeln bringt. Kob unterscheidet verschiedene Interessen, die hier im Spiel sind:
•Das Interesse an eigener Publizität.
Öffentliche Präsenz ist heute längst für alle möglichen Organisationen und Institutionen sowie diverse Personengruppen – ob aus Politik, Wirtschaft oder Kultur (Kunst, Wissenschaft) – existenznotwendig geworden.8 Publizität via Massenkommunikation ist nach wie vor ein probates Mittel, um öffentliche Aufmerksamkeit zu erlangen.
•Das Interesse zu publizieren.
Damit meint Kob das Interesse (z. B. von professionellen Journalist·innen), Tatbestände, Ereignisse, Personen, Ideen etc. (also: materielle und geistige Produkte) öffentlich – und damit potentiell jedermann – zugänglich zu machen.
•Das Interesse des Publikums am publik Gemachten.
Wie bereits erwähnt, ist auch für die Rezipient·innen der „publizistische Charakter“ solcher öffentlichen (genauer: veröffentlichten) Produkte vielfach der eigentliche Anlass, sich den Medien zuzuwenden. Man nimmt „Erscheinungen wahr, von denen man weiß, dass gewichtige soziale Institutionen sie für allgemein relevant halten und dass gleichzeitig eine Unzahl anderer Menschen in der weiteren und näheren Umwelt ebenfalls auf sie aufmerksam sind. Der publizistische Charakter dieser Produkte hebt sie für den Rezipienten eben über den Bedeutungshorizont beliebiger sonstiger menschlicher Äußerungen hinaus, denen er alltäglich begegnet, denn damit signalisieren sie ihm gesellschaftlich sehr generelle Aufmerksamkeitsschwerpunkte“ (Kob ebd.: 395).
Es soll nicht unerwähnt bleiben, dass „Publizität als Vermittlung von Politik und Moral“ (Habermas 1990: 178) bereits im Jahre 1796 von niemand Geringerem als dem deutschen Aufklärungsphilosophen Immanuel Kant (1724–1804) eingeführt wurde. Nach Kants Auffassung sollte das Prinzip der Publizität den·die Gesetzgeber·in sowohl beim Prozess der Gesetzgebung, als auch bei „der nachträglichen Beurteilung der Rechtmäßigkeit politischer Entscheidungen“ (Rühl 1999: 126) leiten. In den Worten Kants: „Alle auf das Recht anderer Menschen bezogene Handlungen, deren Maxime9 sich nicht mit der Publizität verträgt, sind unrecht“ (Kant 1968: B 98–99; zit. n. Rühl: ebd.).
Erstes Fazit: Massenkommunikation ist öffentlich – und potenziell auch Kommunikation
Als Ergebnis der hier diskutierten Begriffsbestimmung lässt sich nun formulieren:
Massenkommunikation ist ein via Massenmedien organisierter öffentlicher, indirekter (in der Regel) einseitiger aber dennoch grundsätzlich kommunikativer Prozess, in dem die Chance auf gelingende Kommunikation (wie sie in diesem Buch definiert worden ist) durchaus besteht.
Abseits inhaltlicher Zielsetzungen sind die kommunikativen Handlungen (sowohl auf der Kommunikator·innen- als auch auf der Rezipient·innenseite) zudem von einem speziellen Interesse her motiviert: von der Attraktivität der Publizität.
5.2 Massenkommunikation, Öffentlichkeit und Internet
Diese Publizität zu erzeugen, ist eine fundamentale Leistung der publizistischen Medien10. Publizistik11 „stellt Öffentlichkeit für Personen und Sachverhalte her und macht diese bekannt“ (Saxer 2002: 3). Gegen den (älteren) Begriff Publizität, der ursprünglich mit der (im Rahmen der Französischen Revolution) erkämpften Presse- und Meinungsfreiheit im nachabsolutistischen Staat verbunden war, hat sich nach und nach der modernere Begriff der Öffentlichkeit durchgesetzt (vgl. Rühl 1999: 125 ff.). Kommunikation, die in der Öffentlichkeit stattfindet, ist daher auch ein zentraler Fokus der Publizistik- und Kommunikationswissenschaft. Was versteht man aber genau unter Öffentlichkeit, wofür ist sie wichtig und wie entsteht sie heute? Der Terminus öffentlich wird im deutschen Sprachraum in der Regel als Gegensatz zu privat verwendet. Diese Unterscheidung ist tief im abendländischen Denken verankert (Peters 1994, Weintraub 1997) und gilt als „fundamental für moderne, liberale politische und rechtliche Ordnungen“ (Peters 1994: 43). Nicht zufällig wird privat auch mit Etikettierungen wie vertraulich und geheim verbunden, denn es geht um eine soziale „Grenzziehung im Bereich von Kommunikation und Wissen“ (ebd.).
Mit Privatheit ist derjenige Bereich gemeint, in dem Menschen ihren natürlichen Affekten (v. a. innerhalb der familiären Intimsphäre) „und ihren privaten Geschäften (Markt) nachgehen“ (Imhof 2003: 193). Private, vertrauliche oder geheime Aktivitäten geschehen abgeschirmt „gegenüber Beobachtung oder Kenntnis von Unbefugten“ (Peters 1994: 44) und gelten als legitim (wie z. B. das Brief- oder das Geschäftsgeheimnis). Sogar in modernen Demokratien, die vielfach auf Transparenz setzen, werden Ausnahmen (wie Staatsgeheimnisse oder Beratungen hinter verschlossenen Türen) weithin anerkannt (ebd.).
Öffentlich nennen wir dagegen Plätze, Häuser oder „Veranstaltungen, wenn sie, im Gegensatz zu geschlossenen Gesellschaften, allen zugänglich sind“ (Habermas 1990: 54). Diese Zugänglichkeit impliziert Situationen, in denen man auch mit „der grundsätzlichen Beobachtbarkeit von allem durch alle“ (Merten 1999: 217) rechnen muss – eben „im Sinne von nicht mehr geheim“ (ebd.: 219). Als öffentlich gilt schon seit jeher das, was „der Wahrnehmung jedes Menschen zugänglich“ (Pöttker 2010: 110) ist.
Aus kommunikationswissenschaftlicher Perspektive kann man unter Öffentlichkeit „ein offenes Kommunikationsforum für alle, die etwas sagen oder das, was andere sagen, hören wollen“ (Neidhardt 1994: 7) verstehen. Im deutschen Sprachraum ist die Bedeutung des Begriffs Öffentlichkeit eng mit der Rede-, Meinungs-, Presse- und Versammlungsfreiheit verbunden, wie sie vom liberalen Bürgertum des 18. Jahrhunderts als Prinzip gegenüber dem absolutistischen Staat angestrebt wurde (Donges/Jarren 2017: 75). In einer Zeit, als das (vom jeweiligen Monarchen) zu gewährende Druck-Privileg und die Zensur repressive Instrumente absolutistischer Kommunikationspolitik waren (ausführlich dazu: Duchkowitsch 2014)12.
Öffentlichkeit „lässt sich am ehesten als ein Netzwerk für die Kommunikation von Inhalten und Stellungnahmen“ (Habermas 1992: 436) beschreiben, deren politische Funktion darin besteht, „gesamtgesellschaftliche Probleme wahrzunehmen und zu thematisieren“(ebd.: 441). Kennzeichnend für die politische Öffentlichkeit in modernen, demokratisch organisierten Gesellschaften ist eine Vielzahl an Kommunikationsforen mit prinzipiell offenem Zugang (d. h. ohne Bedingungen einer Mitgliedschaft), in denen sich verschiedene Akteure vor einem breiten Publikum zu verschiedenen politischen Themen äußern können (Gerhards 2002: 694).
Formal betrachtet, entsteht Öffentlichkeit „dort, wo ein Sprecher vor einem Publikum kommuniziert, dessen Grenzen er nicht bestimmen kann“ (Neidhardt 1994: 10). In den modernen Mediengesellschaften (Saxer 2012a) gilt dies in erster Linie für die Kommunikation via Massenmedien, die gleichsam einen allgemein zugänglichen (virtuellen) öffentlichen Raum herstellen, in dem sich verschiedene Gruppen um die Aufmerksamkeit der Bürger bemühen. Mit Blick auf Politik und Wirtschaft geht es freilich auch um die Beeinflussung des Wahl- sowie des Kaufverhaltens.
Der Soziologe Friedhelm Neidhardt (1994) hat gegen Ende des 20. Jhdts. eine vielzitierte Definition formuliert, die etwas später im Team (zwecks empirischer Umsetzung) zwar elaborierter, aber dennoch um wesentliche Aspekte verkürzt, publiziert worden ist (Gerhards/Neidhardt/Rucht 1998). Deshalb seien hier beide Versionen wiedergegeben:
Version1:
„Moderne Öffentlichkeit ist ein relativ frei zugängliches Kommunikationsfeld, in dem ‚Sprecher’ mit bestimmten Thematisierungs- und Überzeugungstechniken versuchen, über die Vermittlung von ‚Kommunikateuren’ bei einem ‚Publikum’ Aufmerksamkeit und Zustimmung für bestimmte Themen und Meinungen zu finden“ (Neidhardt 1994:7).
Version 2:
„Öffentlichkeit ist ein im Prinzip frei zugängliches Kommunikationsforum, für alle, die etwas mitteilen, oder das, was andere mitteilen, wahrnehmen wollen. In den Arenen dieses Forums befinden sich die Öffentlichkeitsakteure, die zu bestimmten Themen Meinungen von sich geben oder weitertragen: einerseits das Ensemble der Sprecher (z. B. Politiker, Experten, Intellektuelle, der ‚Mann auf der Straße‘ als ‚Augenzeuge‘), andererseits die Medien (also vor allem die Journalist·innen). Auf der Galerie des Öffentlichkeitsforums versammelt sich eine mehr oder weniger große Zahl von Beobachtern: das Publikum (Zuschauer, Hörer, Leser)“ (Gerhards/Neidhardt/Rucht 1998: 38).
Was an diesen Definitionen bzw. an diesem Verständnis von Öffentlichkeit wichtig ist:
•Zunächst, dass reale Öffentlichkeit nur als relativ frei oder als im Prinzip frei zugänglicher Kommunikationsraum begriffen werden kann. Abseits der idealtypischen normativen Vorstellung von Öffentlichkeit (vgl. Peters 1994) als einer für alle zugänglichen Sphäre, verfügen in konkreten Situationen aus verschiedenen (materiellen, physischen, psychischen, sozialen oder temporären) Gründen naturgemäß niemals wirklich „alle Individuen“ (auch nicht alle, die vom jeweiligen Thema betroffen sind) über die gleichen Teilnahmechancen. Heute wird mit dem Begriff „Öffentlichkeit“ daher in der Regel ein bestimmter Kreis von Personen gemeint, „die Zugang zu Informationen haben, über die sie ohne (oder nur unter geringen) Beschränkungen miteinander kommunizieren können“ (Pöttker 2013: 252).