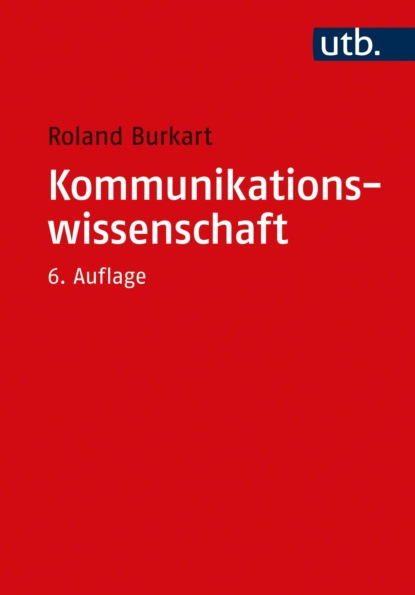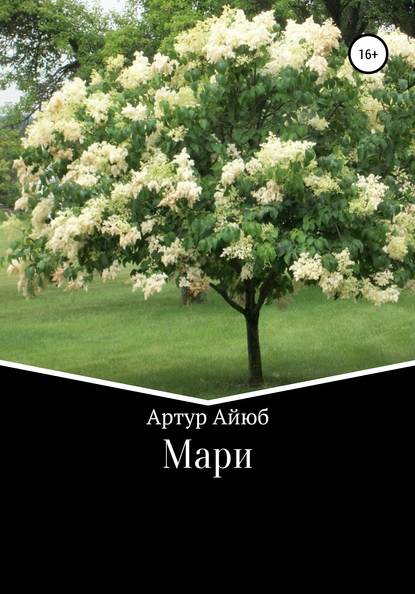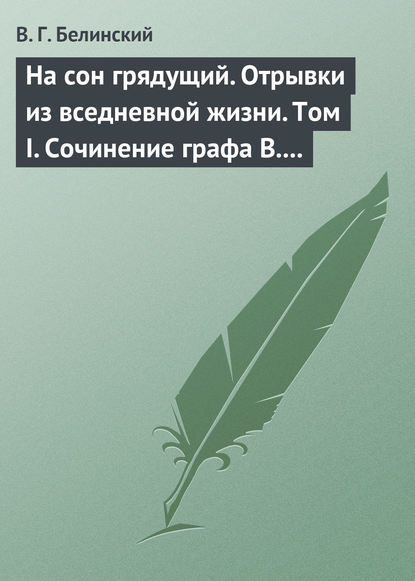- -
- 100%
- +
Ich danke Natalie Indrist für das Beschaffen so mancher Literaturstellen sowie die penible Bearbeitung des umfangreichen Literaturverzeichnisses. In erster Linie gilt mein Dank aber wieder einmal meiner Frau Monika für ihre Geduld mit mir, für ihre ständige kritisch-motivierende Diskussionsbereitschaft und diesmal vor allem in ihrer Rolle als Ärztin für die richtige medizinische Intervention im richtigen Moment, die ausschlaggebend dafür war, dass ich diese Neuauflage überhaupt realisieren konnte. Ihr widme ich dieses Buch.
Da ein Buch nur dann seinen Sinn erfüllen kann, wenn es auch gelesen wird, danke ich – last but not least – den vielen Studierenden aber auch Lehrenden der Publizistik- und Kommunikationswissenschaft und so mancher anderer Fächer, aber auch Jenen, die es außerhalb akademischer Zirkel lesen und weiterempfehlen. Sie alle sind es ja, die den Erfolg dieses Buches seit Jahrzehnten immer wieder ermöglichen und auch dafür sorgen, dass die nötigen Motivationsschübe bei den Updates nicht ausbleiben.
Wien, im Februar 2019
Roland Burkart
1Einleitung
Das Wort Kommunikation ist längst selbstverständlicher Teil der Alltagssprache geworden. In der Regel geht es dabei auch um etwas ganz Alltägliches – um Mitteilungen zwischen Menschen. Präziser formuliert: Es geht um den Prozess, in dem wir einander mit Hilfe von Mimik, Gestik, Sprache, Schrift, Bild oder Ton, von Angesicht zu Angesicht oder über verschiedene materielle sowie virtuelle (digitalisierte, computer- und internetbasierte) Übertragungs- und Speichertechniken irgendwelche Botschaften vermitteln.
Ausgerechnet diese Alltäglichkeit verdeckt jedoch vielfach die Komplexität des Geschehens, das dabei inszeniert wird. Sie ist erst bei näherer Betrachtung erkennbar1 und kommt unter anderem auch darin zum Ausdruck, dass Kommunikation in verschiedenen Wissenschaften aus unterschiedlichen Perspektiven als Erkenntnisobjekt auftaucht.
So spricht man z. B. in der Biologie von interzellulärer Kommunikation, in der Chemie von Chemokommunikation, die Physik kennt kommunizierende Gefäße und die Informatik sieht bei der Übertragung von Daten kommunizierende Hard- und Softwaresysteme. Aber keines dieser Fächer kann für sich in Anspruch nehmen, dem Kommunikationsprozess in allen seinen Dimensionen gerecht zu werden.
Das Fach, aus dessen Perspektive der Kommunikationsprozess in diesem Buch betrachtet wird, ist die Publizistik- und Kommunikationswissenschaft. Sie ist eine relativ junge Disziplin, wenigstens gemessen an so traditionsreichen Wissenschaften wie Physik oder Medizin. Am Beginn stand die Zeitungskunde bzw. Zeitungswissenschaft, die erstmals im Jahr 1916 in Leipzig durch ein eigenes Institut universitär verankert wurde. In den 1940er Jahren, nach der Vereinnahmung durch die Nationalsozialisten2 und dem Ende des Zweiten Weltkriegs, mutierte die Zeitungswissenschaft unter dem Diktat technologischer Innovationen und deren massenhafter Verbreitung (die seinerzeit neuen Medien Hörfunk und Fernsehen waren einzubeziehen) zur Publizistik3. Aber auch dieser Begriff sollte sich bald als zu enges Korsett erweisen, dem die Disziplin im Verlauf ihrer sozialwissenschaftlichen Wende in den 1970er Jahren zu entwachsen begann. Die Bezeichnung Kommunikationswissenschaft taucht erstmals im Jahre 1964 mit dem damals neugeschaffenen Lehrstuhl für „Politik- und Kommunikationswissenschaft“ der Universität Erlangen-Nürnberg auf (Ronneberger 1997: 27).4
Damit war das Fach allerdings in eine Situation geraten, die treffend mit dem „Zustand einer verzögerten Detonation“ (Ronneberger 1978a: 16) bezeichnet worden ist: Mit der Mutation zur Kommunikationswissenschaft hatten sich die Konturen ihres Erkenntnisgegenstandes eher verdunkelt (ebd.: 17). Nicht ganz zu Unrecht wurden daher die „Grenzen der Publizistikwissenschaft“ (Saxer 1980b) eingeklagt, die sich nicht so sehr um den allgemeinen Kommunikationsprozess, als vielmehr um ihr eigenes Materialobjekt, nämlich die Medien kümmern solle. Andererseits war gerade mit dem Verweis auf die Überwindung ebendieser Tradition zu hören, die Kommunikationswissenschaft dürfe ihre Problemstellungen nicht auf die sogenannte Massenkommunikation reduzieren, auch wenn damit keineswegs der Anspruch verbunden sein kann, für jedwede Problematik aus dem Bereich der Humankommunikation zuständig zu sein (vgl. Rühl 1985a).
Diesem scheinbaren Dilemma kann man freilich entkommen, wenn man sich darauf besinnt, dass eine wissenschaftliche Disziplin nicht nur durch Materialobjekte (wie z. B. die Medien) definierbar ist, sondern dass sie auch Formalobjekte benötigt (näher dazu: Kap. 8), nämlich eine Sichtweise, „eine besondere Blickrichtung auf das Material“ (Glotz 1990: 250) – oder anders formuliert: eine „spezifische Auswahl von Problemstellungen, -behandlungen und -lösungen“ (Rühl 1985a: 241)5.
Mittlerweile hat sich die Kommunikationswissenschaft vielfach ausdifferenziert und auch konsolidiert.6 Sie befasst sich – wie jede andere wissenschaftliche Disziplin auch – mit einem ganz bestimmten Ausschnitt der Wirklichkeit7 und versteht sich als Sozialwissenschaft (DGPuK 2008). Diese Wissenschaften werden – abgeleitet vom lateinischen socius (für gemeinsam, gemeinschaftlich, die Gesellschaft betreffend) – auch als Gesellschaftswissenschaften bezeichnet. Sie rücken die einzelnen „Individuen in ihrer Beziehung zu anderen“ (Seiffert/Radnitzky 1994: 302) in den Mittelpunkt. Aus diesen Beziehungen der Menschen untereinander entstehen gesellschaftliche Gruppen und die menschliche Gesellschaft insgesamt mit ihren Organisationen und Institutionen. Zu den Sozialwissenschaften zählen z. B. Soziologie, Sozialpsychologie, Kultur- und Sozialanthropologie, Pädagogik bzw. Erziehungs- oder Bildungswissenschaft, Politikwissenschaft, Wirtschaftswissenschaft und eben die Kommunikationswissenschaft.
Die Kommunikationswissenschaft interessiert sich nun für den Prozess, in dem (mindestens zwei) Menschen einander etwas mitteilen (wollen), für die Vermittlungsinstanzen (Medien), die dabei im Spiel sind, für die Bedingungen, unter denen diese Bedeutungsvermittlung stattfindet und für die Konsequenzen (Wirkungen), die daraus resultieren. Die Publizistik- und Kommunikationswissenschaft fokussiert – abgeleitet vom lateinischen publicus (für öffentlich) – vorrangig die öffentliche Verbreitung von Aussagen. Bis gegen Ende des 20. Jahrhunderts wurde diese Öffentlichkeit in erster Linie durch die Massenmedien bzw. durch Massenkommunikation hergestellt.
Spätestens seit der Jahrtausendwende haben wir es allerdings durch das Aufkommen von neuen internetbasierten (sozialen) Medien und Kommunikationstechniken mit einem Medienwandel (Kinnebrock/Schwarzenegger/Birkner 2015) zu tun, der neben der traditionellen massenmedialen Öffentlichkeit zusätzliche „digitale Öffentlichkeiten“ (Hahn/Hohlfeld/Knieper 2015) hervorgebracht und damit allem Anschein nach einen neuen strukturellen Wandel von Öffentlichkeit (Eisenegger 2021) eingeleitet hat. Insgesamt markieren die Verbreitung des Internets, das Aufkommen der Mobilkommunikation sowie das Entstehen neuer sozialer Medien und digitaler Plattformen (Meyer 2019) eine kommunikationshistorisch bedeutsame Zäsur, die unseren Kommunikationshaushalt förmlich revolutioniert hat. Davon wird in diesem Buch mehrfach die Rede sein, zumal noch kein Ende dieser Entwicklung absehbar ist.
Das vorliegende Buch ist aber auch ein Schritt auf dem Weg zu einem Selbstverständnis der Publizistik- und Kommunikationswissenschaft. Die Diskussion darüber ist eigentlich so alt, wie das Fach selbst, dennoch flammt sie bis heute immer wieder auf (näher dazu: Kap. 8). Das Buch knüpft an der Tradition unserer Disziplin insofern an, als es der massenmedial vermittelten, öffentlichen Kommunikation breiten Raum einräumt. Trotz der schleichenden digitalen Transformation nahezu aller Lebensbereiche sowie der Dauerpräsenz sozialer Medien in unserem Alltag, ist ein Ende der Massenkommunikation nämlich keineswegs in Sicht. Sowohl die Kommunikation über soziale Medien als auch die Massenkommunikation sind jedoch erst dann angemessen begreifbar, wenn man menschliche Kommunikation grundsätzlich ins Auge fasst, also auch über relevante Aspekte der Individualkommunikation Bescheid weiß. Einmal, weil Parallelen bzw. Entsprechungen zwischen beiden Realitäten existieren und darüber hinaus, weil Wechselbeziehungen nicht bloß evident sind, sondern auch in der bisherigen gesellschaftlichen Entwicklung immer wieder eine Rolle gespielt haben.
Aus diesem Anspruch ergibt sich die inhaltliche Strukturierung des Buches.
•Zunächst ist der Kommunikationsprozess in seinen Grundzügen zu reflektieren. Zu diesem Zweck wird ein Kommunikationsbegriff entwickelt, der die besondere Qualität der Humankommunikation zu erfassen vermag (2. Kapitel).
•Dabei kommt man nicht umhin, das für den Menschen typische und auch am höchsten entwickelte Kommunikationsmittel etwas näher zu betrachten: die Sprache (3. Kapitel).
•Die damit bereitgestellten Einsichten in die Besonderheiten der Humankommunikation sind Ausgangspunkt für eine Diskussion über die Bedeutung real stattfindender Kommunikationsprozesse für Mensch und Gesellschaft (4. Kapitel). Sowohl der Stellenwert von Kommunikation im Verlauf der Anthropogenese, als auch die Relevanz von Kommunikation als Sozialisationsfaktor stehen im Mittelpunkt.
•Erst auf dieser Grundlage wird die Bedeutung von Massenkommunikation in unserer internetbasierten Kommunikationsgesellschaft ausgelotet (5. Kapitel). Diskutiert werden die normativen Ansprüche an Öffentlichkeit in demokratisch organisierten Gesellschaften sowie die Veränderungen, die daraus unter den Bedingungen steigender Digitalisierung und Plattformisierung erwachsen.
•Breiten Raum nehmen sodann Erkenntnisse aus der (massen-)kommunikativen Wirkungsforschung ein – stets auch mit Blick auf neuere empirische Ergebnisse unter Einbeziehung des Internets (6. Kapitel).
•Auf Basis all dieser Reflexionen, Einsichten und empirischen Befunde gilt es, die zentralen Strukturen unserer modernen Kommunikationsgesellschaft erkennbar zu machen (7. Kapitel). Dabei geht es zunächst um die beiden Berufsfelder Journalismus und Public Relations, die in hohem Maß für die mediale Konstruktion von Wirklichkeit verantwortlich sind, sowie um die Leistungen, die von den dabei involvierten publizistischen Medien für Mensch und Gesellschaft erbracht werden. Es geht aber auch um das Fernsehen, das als das typische Medium des 20. Jhdts. gelten kann, sowie um die kommunikative Revolution, die durch Internet, Suchmaschinen, Web 2.0 und soziale Medien am Beginn des dritten Jahrtausends losgetreten worden ist.
•Schließlich können anhand ausgewählter Kommunikationstheorien zentrale Problemfelder einer Publizistik- und Kommunikationswissenschaft entfaltet werden, wie sie als interdisziplinäre Sozialwissenschaft vorstellbar ist und wie sie sich über die vergangenen Jahrzehnte hinweg auch entwickelt hat (8. Kapitel). Dabei wird deutlich, dass in Entsprechung zur jeweils gewählten theoretischen Position die kommunikativen Materialobjekte (diverse Medien sowie einzelne Kommunikationsakte) stets aus verschiedenen Perspektiven in den Blick geraten. Der eigentliche kommunikationswissenschaftliche Objektbereich entsteht dann nicht aus der Summe der (materiellen) Erkenntnisgegenstände, sondern er lässt sich – ganz im Sinn der eingangs angesprochenen Formalobjekte – aus der Summe der Perspektiven formen (9. Kapitel).
Abschließend noch ein Hinweis zum Gebrauch dieses Buches: Es ist als Lehrbuch angelegt und hat sich im Laufe der vergangenen Jahrzehnte sowohl in den einführenden Semestern als auch im Kontext der Vorbereitung auf die Abschluss examen bewährt. Es wendet sich aber auch an all jene, die an Kommunikation und Medien ganz allgemein Interesse haben. Für beide Zielgruppen ist es mir wichtig, möglichst klare Begriffsdefinitionen anzubieten, um dadurch ein behutsames Umgehen mit der Fachterminologie zu ermöglichen. Zentrale Begriffe sind daher sowohl über ein Stichwortverzeichnis auffindbar, als auch an den entsprechenden Textstellen durch Fettdruck (in weiterer Folge kursiv) hervorgehoben. Dies alles geschieht nicht als Selbstzweck, sondern der Erkenntnisqualität wegen: Ohne klare Sprache gelingt nur ein sehr trüber Blick auf die Wirklichkeit.
Um geschlechtersensible Formulierungen bemühe ich mich immer dann, wenn mir diese klare Sprache nicht gefährdet erscheint. Originalzitate werden nicht nachträglich gegendert, das gilt in der Regel auch für englischsprachige Fachtermini, wenn sie nicht bereits als Anglizismen alltagssprachlich eingedeutscht sind. Ich setze das Gendern also moderat ein und verwende dafür stets den schlichten Mediopunkt (·), weil dieser meines Erachtens die Lesbarkeit kaum beeinträchtigt und überdies die soziale Inklusion jedweder Geschlechtsidentitäten zum Ausdruck bringt.8
1Klaus Merten (1977) hat eine bis heute beispielhaft grundlegende und systematische Begriffs- und Prozessanalyse der Komplexität des Kommunikationsprozesses vorgelegt. Er typologisiert und evaluiert dort u. a. 160(!) Definitionen von Kommunikation.
2Vgl. dazu Averbeck/Kutsch 2002, Hachmeister 1987, Pöttker 2002a, 2002b; speziell für Österreich: Duchkowitsch 2015, Duchkowitsch/Haas 2015, Duchkowitsch/Hausjell/Semrad 2004 sowie Duchkowitsch/Krakovsky 2015.
3Publizistik nennt sich auch die im Jahr 1956 gegründete und bis heute existierende bedeutendste deutschsprachige wissenschaftliche Fachzeitschrift.
4Zur Fachentwicklung vgl. Kutsch/Pöttker 1997, Meyen 2015, Meyen/Löblich 2007 sowie Meyen/Wiedemann (o. J.) http://blexkom.halemverlag.de/.
5Zu Recht spricht sich Glotz grundsätzlich dagegen aus, eine Wissenschaft vom materiellen Gegenstand her zu konstruieren: „Ein solches Vorgehen wäre vergleichbar mit dem Versuch, Anthropologie, Philosophie, Medizin und ein Dutzend weiterer Wissenschaften zu einer ‚Menschenwissenschaft’ zusammenzufassen und diese dann mit der unbestreitbaren Wichtigkeit der Erforschung des ‚Menschen’ zu begründen“ (Glotz 1990: 250). Und er verweist auf einen der Väter der deutschen Zeitungswissenschaft (Otto Groth), der am Beginn seines siebenbändigen Grundlagenwerkes feststellt: „Der Forscher muss sich für eine spezifische Betrachtungsweise entscheiden, in der er die Erscheinungen sehen will, muss wählen, welche Seite dieser ihm wichtig ist, was er dementsprechend an ihnen herausheben, was er weglassen muss“ (Groth 1960: 4).
6Abzulesen ist dies an diversen Einführungs- und Überblickswerken sowie Lexika (Auswahl): Beck 2020, Bentele/Brosius/Jarren 2003, Bentele/Brosius/Jarren 2013, Bonfadelli/Jarren/Siegert 2005, Kunczik/Zipfel 2005, Noelle-Neumann/Schulz/Wilke 2009, Pürer 2014, Schmidt/Zurstiege 2007.
7Wir sprechen hier bereits von den sogenannten Realwissenschaften (das sind die Natur-, Technik-, und Sozialwissenschaften), die Teilbereiche der Erfahrungswirklichkeit zum Gegenstand haben – im Gegensatz zu den sog. Formalwissenschaften (wie formale Logik, Mathematik und Informatik).
8Der Mediopunkt (auch: Mittelpunkt oder Halbhochpunkt) kann laut Duden (Diewald/Steinhauer 2020) im Deutschen als Mittel der geschlechtergerechten Schreibweise eingesetzt werden, wenn über die sprachliche Gleichbehandlung von Frauen und Männern hinaus auch nichtbinäre Geschlechtsidentitäten einbezogen werden sollen.
2Kommunikation: Zur Klärung eines Begriffes
In diesem Kapitel geht es um eine grundlegende Auseinandersetzung mit dem Kommunikationsbegriff. Dabei wird allerdings nicht dem – sowohl in der Alltags- als auch in der Wissenschaftssprache anzutreffenden – inflationären Gebrauch dieses Wortes nachgegangen.1 Ich werde vielmehr versuchen, jene Dimensionen der Begriffsrealität herauszuarbeiten, mit denen sich die humanspezifischen Qualitäten dieses Prozesses erfassen lassen und die daher für das Verständnis von Kommunikationswissenschaft, wie es in diesem Buch entwickelt wird, wesentlich erscheinen.
Zu diesem Zweck kann man Kommunikation mit Maletzke zunächst ganz allgemein als „Bedeutungsvermittlung zwischen Lebewesen“ (1963: 18) begreifen. Mit dieser einfachen (und zugleich „klassischen“) Definition klammert man bereits alle jene kommunikativen Vorgänge aus, die zwischen „Nicht-Lebewesen“ (wie datenverarbeitenden Maschinen u. Ä.) ablaufen, und rückt soziale Kommunikationsprozesse in den Mittelpunkt des Interesses. Die lmplikationen dieses Anspruchs gilt es in der Folge zu untersuchen.
2.1 Kommunikation als soziales Verhalten
Mit dem Terminus Verhalten wird jede Regung eines Organismus bezeichnet. Neben rein motorischen Bewegungsabläufen (wie körperlich-muskulären Aktionen und Reaktionen eines Organismus auf Umweltreize) zählen dazu auch die Aktivitäten des Zentralnervensystems; beim Menschen sind dies v. a. die von Gehirn und Rückenmark gesteuerten nervösen Prozesse des Wahrnehmens, Fühlens und Denkens (vgl. Klima 2011: 725).
Soziales Verhalten meint dagegen bereits den Umstand, dass sich Lebewesen im Hinblick aufeinander verhalten. Sozial ist dasjenige Verhalten von Lebewesen (Menschen oder Tieren), das eine Reaktion auf das Verhalten anderer Lebewesen darstellt und selbst wiederum die Reaktionen anderer Lebewesen beeinflusst (vgl. ebd.). Als sozial gelten daher sowohl Verhaltensabläufe, im Rahmen derer Lebewesen miteinander agieren (z. B. das gemeinsame Abwehren eines Feindes), als auch solche, die gegeneinander gerichtet sind (z. B. das Einander-Bekämpfen). Ausschlaggebend für den sozialen Charakter von Verhaltensweisen ist also der Umstand, dass sie aufeinander bezogen sind. Auch „Einzelaktionen“ (wie etwa das Sammeln von Futter für die Jungen) können damit durchaus sozialen Charakter besitzen. Werden nun im Rahmen derartiger sozialer Verhaltensweisen zudem Bedeutungen vermittelt, dann besitzen diese Verhaltensweisen auch kommunikativen Charakter.
Strenggenommen ist dies nahezu immer der Fall. Von den erwähnten Einzelaktionen (vorzustellen wäre etwa eine isoliert stattfindende Futtersuche) abgesehen, findet ja allein infolge der – etwa durch räumliche Nähe bedingten – sinnlichen Wahrnehmung eines anderen Lebewesens eine Bedeutungsvermittlung zwischen diesen beiden statt.
So bedeutet beispielsweise das Erscheinen eines Fuchses im Wahrnehmungsfeld eines Hasen für diesen das Signal zur Flucht; ebenso bedeutet für mich das Herannahen einer überfüllten Straßenbahn etwas, nämlich entweder mich auch noch hineinzwängen zu müssen, zu Fuß zu gehen, ein Taxi zu nehmen u. Ä. In beiden Fällen vermag allein die sinnlich wahrgenommene physische Existenz anderer Lebewesen (bzw. deren Verhalten) Bedeutungen zu vermitteln.
Nicht nur soziales Verhalten, Verhalten überhaupt scheint sich damit in weiten Teilen als kommunikativ zu erweisen. Diese Ansicht vertreten auch Watzlawick (et al.), die im Rahmen ihrer Auseinandersetzung mit menschlicher Kommunikation die Begriffe Kommunikation und Verhalten überhaupt gleichbedeutend verwenden (1969: 23 f.). Ausgehend von der plausiblen Einsicht, dass es eine grundlegende Eigenschaft des Verhaltens sei, kein Gegenteil zu besitzen („Man kann sich nicht nicht verhalten“), gelangen sie zur Formulierung ihres vielzitierten Axioms „Man kann nicht nicht kommunizieren“ (Watzlawick et al. 1969: 53).
Diese Position soll allerdings hier nicht vertreten werden. Obwohl es zunächst einsichtig erscheint (und auch gar nicht in Abrede zu stellen ist), dass jedes Verhalten gewissermaßen über ein kommunikatives Potential zur Bedeutungsvermittlung verfügt, so hieße es dennoch den Begriffsrahmen überspannen (was die inflationäre Verwendung des Wortes zudem nicht gerade mindern würde), wollte man jedes Verhalten mit Kommunikation gleichsetzen: Wenn alles Verhalten Kommunikation ist, dann wäre ja z. B. auch das Betragen eines schlafenden Individuums zu Recht bereits als Kommunikation zu bezeichnen.
Denken wir an einen Studenten, der in der Vorlesung schläft. – Er signalisiert mir als Vortragendem mit seinem Verhalten „nonverbal, dass er nicht bereit oder in der Lage ist, meine Mitteilung aufzunehmen. Möglicherweise wird er als Dauersender desselben nonverbalen Signals zu einem Störfaktor für mich und die anderen Hörer. Nur: in umgekehrter Richtung, nämlich von mir zu ihm findet eine Kommunikation keinesfalls statt. Das heißt: was immer ich vortrage, er nimmt es nicht auf. Ich kann, was ich denke oder mitteile, folglich nicht mit ihm teilen. Dies gilt auch, wenn er ‚mit offenen Augen schläft‘, ‚abschaltet‘, Mitteilung verweigert“ (Wagner 1980: 171).
Wenn also Kommunikation auch nicht möglich sein soll, dann ist entscheidend, dass man unter dem Begriff Kommunikation einen Mitteilungsvorgang versteht, in dem Bewusstseinsinhalte miteinander geteilt, „vergemeinschaftet“ (ebd.) werden. Dem Axiom über die Unmöglichkeit, nicht zu kommunizieren, liegt daher „ein vollkommen anderer Kommunikationsbegriff zugrunde“. (ebd.)
Durch eine derartig hypertrophe Verwendung des Kommunikationsbegriffes geraten folgerichtig alle Versuche, eine Bedeutungsvermittlung (trotz wechselseitiger Wahrnehmbarkeit) nicht stattfinden zu lassen oder abzubrechen, in den Bereich des Pathologischen: Wenn jegliches Verhalten, also auch Schweigen, Absonderung, Regungslosigkeit, Schlafen oder irgendeine andere Form der Vermeidung von Kommunikation selbst eine Kommunikation ist, dann zeigt sich in dem Versuch, nicht zu kommunizieren, tatsächlich „ein wesentlicher Teil des schizophrenen Dilemmas“ (Watzlawick et al. 1969: 52).2
Kommunikation und Intentionalität
Hier wird nun davon ausgegangen, dass es dem Menschen sehr wohl möglich ist, Kommunikation (bzw. Kommunikationsversuche) willentlich aufzunehmen oder auch abzubrechen – und genau das soll in der Begriffsbestimmung auch zum Ausdruck kommen. Menschliches Verhalten kann nämlich bewusst (Graumann 1966: 115 f.) und zielgerichtet, d. h. intentional ablaufen. Der Mensch kann sich in seinem Verhalten ausdrücklich auf etwas beziehen, er kann sich also nicht bloß verhalten, er kann auch handeln.
Handeln gilt als (alltäglicher) Spezialfall von Verhalten, eben als intentionales Verhalten, das absichtsvoll und auch (mehr oder weniger) bewusst auf ein Ziel hin ausgerichtet ist (Lenk 1978: 281). Oder wie es Max Weber in seiner klassischen Begriffsbestimmung ausdrückt: Handeln meint dasjenige menschliche Verhalten, welches der jeweils handelnde Mensch mit subjektivem Sinn verbindet. Dabei ist einerlei, ob es sich um ein äußeres (motorische Aktivitäten) oder innerliches „Tun“ (Denken, Fühlen, …) handelt; auch ein bewusstes Unterlassen einer Aktivität (oberflächlich betrachtet: ein „Nichts-Tun“) oder ein bewusstes Dulden (von Zuständen, von Verhaltensweisen anderer etc.) ist in diesem Sinn als menschliches Handeln zu begreifen (Weber 1980: 3 f.; 1984: 19 f.).
Intentionalität gilt als Ergebnis der Evolution (der phylogenetischen Entwicklung) des Menschen. Sie besteht in der „Fähigkeit, für ein Ziel zu kämpfen […] mit mehr als nur einem rigiden Handlungsmuster“ (Lenneberg 1964: 581 f.; zit. n. Merten 1977: 129): Neuere Erkenntnisse deuten zwar darauf hin, dass auch Menschenaffen (Schimpansen) über einfache Formen der Intentionalität verfügen, aber nach wie vor gilt, dass nur der Mensch über eine Intentionalität höherer Ordnung, nämlich über eine „geteilte Intentionalität“ („shared intentionality“), auch „Wir- oder kollektive Intentionalität“ verfügt (Tomasello 2014: 4), die ihn zu Empathie und Kooperation befähigt und die „einzigartig im Tierreich ist“ (Tomasello 2011: 17).
Der Handlungsbegriff ermöglicht also, aus dem Gesamtkomplex menschlicher Verhaltensweisen bestimmte Teile herauszugreifen. Mit Hilfe des Handlungsbegriffes lässt sich der intentionale Charakter menschlichen Tuns hervorheben: Indem der Mensch seinen Handlungen „subjektiven Sinn“ zuerkennt, ihnen also bestimmte Bedeutungen attestiert, verbindet er bewusst ganz bestimmte Zielvorstellungen mit seinen Aktivitäten. Das bedeutet darüber hinaus, dass menschliches Handeln nicht Selbstzweck (ich handle nicht „um des Handelns willen“), sondern stets Mittel zum Zweck ist. Was auch immer wir beabsichtigen (die Beeinflussung eines Prozesses, das Herstellen eines Zustandes, das Dulden eines Missstandes, …), unser Handeln ist stets zielgerichtet3. Ist unser Handeln in seinem Ablauf nun auch noch an anderen Menschen orientiert, dann spricht man von sozialem Handeln.