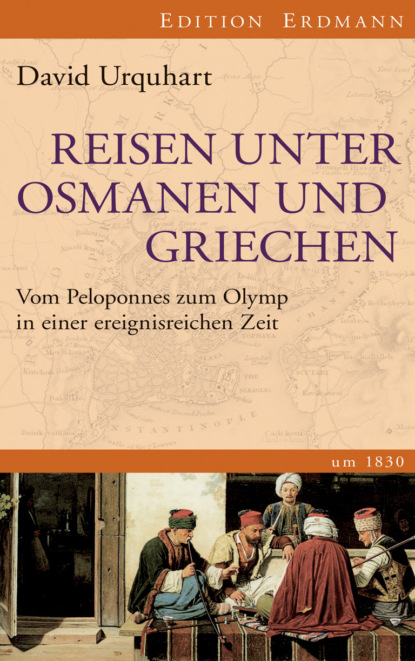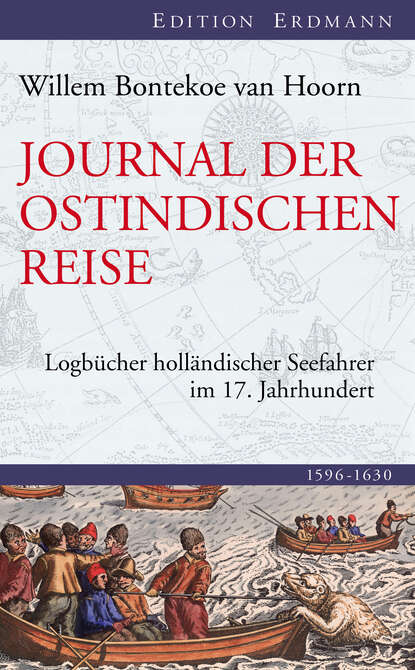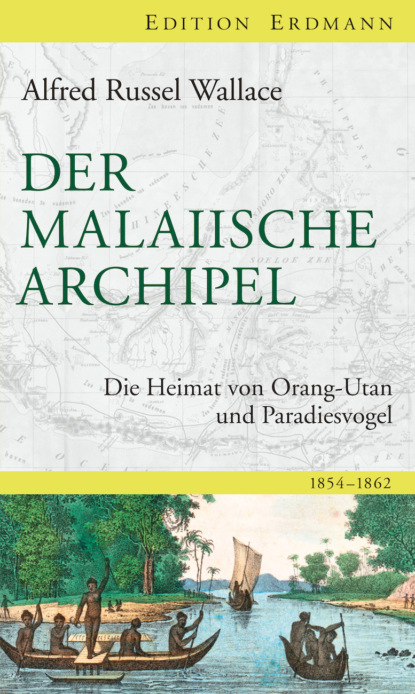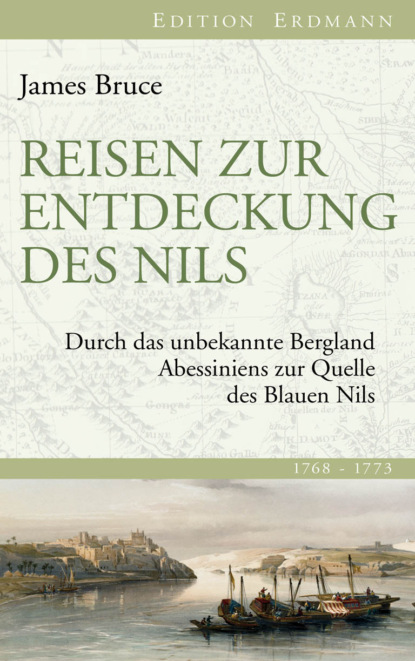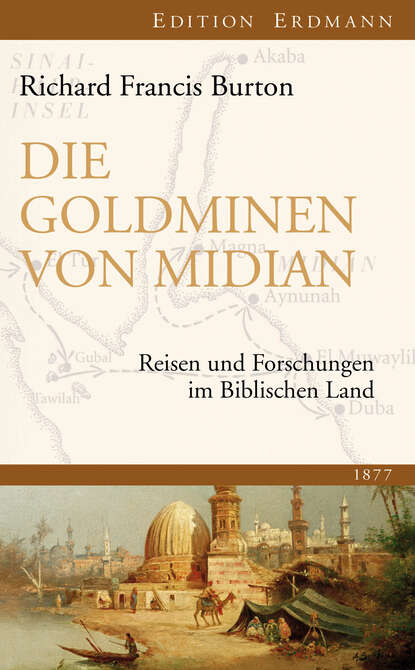Reisen im Kongogebiet
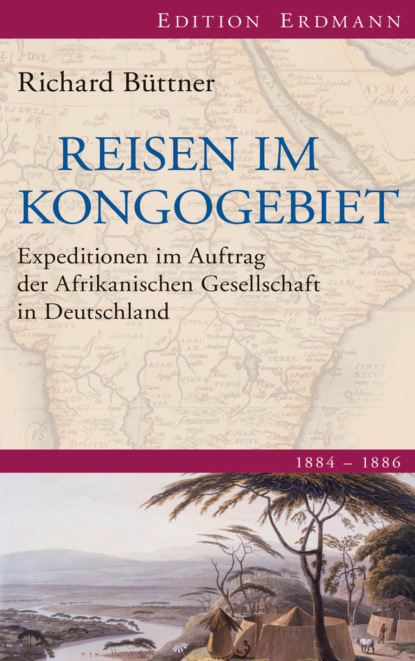
- -
- 100%
- +
In Bagidda – alle diese Plätze liegen nur einige Stunden Dampferfahrt voneinander entfernt – fanden wir in einem jungen Angestellten der Wölber und Brohmschen Faktorei den provisorischen Konsul für Lomé, Bagidda und Porto Seguro, der uns eingehend über die Ursachen und Vorgänge der Besitzergreifung Bericht erstatten konnte.
Am Morgen des 27. August lagen wir vor Little Popo, dessen König oder Chief und drei der angesehensten Männer vor kurzem die »Sophie« gefangen genommen und nach Deutschland geführt hatte. Zur Zeit unserer Anwesenheit herrschte dort eine große politische Verwirrung, indem sowohl die Deutschen als auch die Engländer und Franzosen je einen König aufgestellt hatten. Wir ignorierten natürlich die anderen Prätendenten und machten dem nationalen Cudjovi einen Besuch, bei welchem derselbe in weißem, großem Schultertuch und in schwarzem Zylinderhut erschien und uns eine Flasche Rum vorsetzte. Für noch feierlichere Staatsaktionen bedient sich der Alte eines blauen Klapphutes.
In Little Popo stellten uns die deutschen Herren in ihrer ausgezeichneten Liebenswürdigkeit – die man uns überall an der Küste in den Faktoreien der Firmen Woermann, Gödel und Götschow, Gödel, Wölber und Brohm, Vietor und Söhne und in der Baseler und Bremer Mission entgegenbrachte – für die Lagunenfahrt nach Whyda ihr hübsches Boot mit Bedienung und splendider Verproviantierung zur Verfügung. In kurzer Entfernung von der Küste zieht sich nämlich parallel mit derselben ein ausgedehntes System von Lagunenkanälen hin, die eine bequeme Verbindung der Küstenplätze darbieten, während die Dampfer natürlich ihren Weg auf dem Meere zu nehmen haben.
Der 28. August ließ uns in achtstündiger Fahrt auf der Lagune nach Grand Popo gelangen. Unser Boot war durch ein Segeldach vor den Strahlen der Sonne geschützt und wurde von drei Schwarzen durch Palmblattrippen verhältnismäßig schnell vorwärts gestoßen. Die Kanäle sind von verschiedener Breite, die bisweilen bis auf einige hundert Meter steigen mag, und von sehr einförmiger Mangroven- und Buschvegetation eingefaßt. Hier wurde uns auch zum ersten Mal der Anblick gewaltiger Krokodile zu teil, die an sonnigen Uferstellen der Ruhe pflegten, bei Annäherung unseres Bootes jedoch stets in das Wasser stürzten.
Grand Popo ist ein Ort von etwa 8 000 Einwohnern mit bedeutendem Handel und zahlreichen Faktoreien. Nach gastfreundlichster Bewirtung und moskitoumschwärmter Nacht unternahmen wir am nächsten Morgen auf dem von Gräben durchzogenen, sehr sumpfigen Gebiete in Nähe des Ortes eine zweistündige Jagdpartie, der eine Anzahl größerer Vögel, zumeist Reiherarten, zum Opfer fielen.
Nach dem Frühstück wurde die Bootfahrt auf der Lagune wieder aufgenommen, die in sechs Stunden an einer Uferstelle endete, von wo wir uns – um nach Whyda zu kommen – noch einem einstündigen, in der Dunkelheit etwas abenteuerlichen Landtransport über sehr sumpfiges Gebiet in Hängematten und auf den Schultern der aus der Gödelschen Faktorei entgegengesandten Accra- und Kruleute zu unterziehen hatten.
Das Gödelsche Haus in Whyda unterscheidet sich von den schuppenartigen und recht primitiven Faktoreien von Lomé, Little und Grand Popo durch elegante, ja selbst luxuriöse Ausstattung. Das stattliche steinerne Gebäude liegt an erhöhter Stelle der Stadt, an einem mit rotblühendem Clerodendrongesträuch bestandenen Platz. Von der Veranda erblickt man durch ein Fernrohr über die Stadt hinweg gerade noch die Spitzen der Masten der auf der Reede liegenden Schiffe, und hatten wir am 29. August das Vergnügen diejenigen des »Professor Woermann« zu entdecken.
Whyda bietet des Interessanten sehr viel. Die aus rotem Lehm gefertigten und mit Palmblättern gedeckten Häuser der Stadt, die an 40 000 Einwohner zählen soll, sind in regelrechten und teilweise mit Orangenbäumen bepflanzten Straßen angeordnet. Alle Häuser, Straßen und Stadtviertel haben Spezialfetische, die in den absonderlichsten Formen erscheinen, oft freilich nur aus ein paar Topfscherben bestehen, in denen Speisereste sich befinden. Stadtfetisch sind die Schlangen, denen man ein Heim in dem weitbekannten Schlangentempel gegeben hat. Derselbe ist ein nicht bedeutendes, ummauertes, mit einigen Bäumen bestandenes Gebiet inmitten der Stadt und enthält in einigen offenen Pavillons eine ganze Anzahl verschiedenartiger Schlangen, die sich freilich oft genug in den Häusern der Bewohner einfinden, wo die Tiere, nachdem die Tempeldiener benachrichtigt worden sind, mit Geschick wieder eingefangen und in Säcken feierlichst in ihr Quartier zurücktransportiert werden. Gewisse Verehrung genießt auch der große Fetischbaum – ein Baumwollbaum – dessen gewaltiger Stamm von Rindenstreben gestützt ist, die in einem Kreise von etwa fünfzig Meter Umfang liegen. Auffallend sind ferner die zahlreichen großen, nackthalsigen Geier, die – gleich Krähen auf den Dachfirsten sitzend – für gewissenhafte Reinigung der Straßen sorgen. Einige große Bäume inmitten der Stadt sind während der Tagszeit völlig behängt mit Scharen dicht aneinander gedrängter fliegender Hunde, die des Nachts ihre Streifzüge in die Umgegend unternehmen. Zur Zeit unserer Anwesenheit war die Stadt verhältnismäßig ruhig, denn alle angesehenen Leute, sowie die Amazonen des Königs, waren in der einige Tagereisen entfernten Residenzstadt Abómé, in der gerade die alljährlichen customs abgehalten wurden, jene Feste, bei denen die Gefangenen, die man früher als Sklaven exportiert hätte, zu Hebung der Feierlichkeit, und um sich derselben zu entledigen, in großer Zahl geschlachtet werden.
Das Königreich ist in jeder Beziehung gut organisiert und das Beamtenwesen sehr ausgebildet, so daß überall im Lande Ruhe und Ordnung herrschen, die dem krassen Despotismus des Königs, dem auch die weißen Kaufleute sich fügen müssen, als ein Verdienst anzurechnen sind.
Am Morgen des 30. August erhielten wir in der Faktorei den Besuch eines der Würdenträger des Staates, der von Abómé gekommen war, um Dr. Nachtigal die Geneigtheit des Königs, den Deutschen gewisse Rechte im Land einzuräumen, anzukündigen und ihn zum Behuf der Verhandlungen nach der Residenz einzuladen. Da die Gesandtschaft Dr. Nachtigal nicht mehr an der Küste angetroffen hatte, so wurden wir als Vertreter der deutschen Nation für würdig befunden, diese Botschaft des Königs an unseren Generalkonsul – den wir auf der Fahrt südwärts voraussichtlich treffen würden – weiter zu bestellen. Der Gesandte des Königs brachte als Legitimation einen Stock seines Herrn mit sich, bei dessen Anblick die Eingeborenen auf die Erde zu fallen, die Weißen aber die Hüte zu lüften haben.
Nach dem Frühstück am 31. August nahmen wir Abschied von unseren Gastfreunden und stiegen zur Beach hinab, wo wir über Sumpf und Lagune nach zwei Stunden anlangten, aber noch dieselbe Zeit in Sicht des Dampfers zu warten hatten, da die Erlaubnis des Stadtvorstehers, das Land zu verlassen, noch nicht eingetroffen war. Als diese Erlaubnis endlich in Gestalt des Stockes desselben anlangte, gingen wir zu Boot, um unter den Beschwörungen des Steuermanns und eines von den Faktoreien besoldeten Fetischmannes – die dadurch die Macht der Brecher zu besänftigen haben – glücklich wieder an Bord unseres Dampfers zu gelangen.
Am 3. September lagen wir vor dem Kamerundelta; am folgenden Morgen aber erst führte der offizielle schwarze Lotse, Herr Bottlebeer, den Dampfer den Fluß aufwärts, wo wir vor der Woermannschen Faktorei vor Anker gingen, um sofort in der herzlichsten Weise von den deutschen Herren begrüßt zu werden. Es waren dies Dr. Buchner, der zur Zeit hier als Reichskommissär postiert war, ferner die Herren Dr. Passavant und Dr. Pauli, welche das Hinterland zu erforschen hierher gekommen waren und ihre Wohnung auf der »Hamburger Louise«, der Hulk5 des biederen Kapitäns Voß, aufgeschlagen hatten, dessen Liebenswürdigkeit kennen zu lernen auch wir mehrfach Gelegenheit nahmen. Im übrigen fanden wir eine Anzahl Kaufleute vor, darunter auch Hern Panthenius, der als Agent der zweiten Woermannschen Kamerunfaktorei einige Monate später bei Gelegenheit des Kampfes unserer Marine ein Opfer der Bestialität der Eingeborenen werden sollte.
Einen wesentlich günstigeren Eindruck als die öde Sandküste des nördlichen Protektoratgebietes macht das erhöhte und gut mit Vegetation bestandene linke Ufer des Kamerunflusses, von dem herab dem Ankömmling Bananen, Kokos- und Ölpalmen, Pandanus und Baumwollbäume entgegenwinken. Auch ein Gang durch die Dörfer King Bells und King Akwas läßt das freundliche Bild nicht erblassen, denn das Auge trifft auf allerdings nur bescheidene Kulturen von Zuckerrohr, Voandzieen, Yams, Bataten, Kolokasien, Maniok und Bananen.
Bei einem unserer Spaziergänge mit Dr. Buchner kehrten wir im Hause Chief Joss’ ein, der uns frische Kokosnußmilch und von der Weinpalme gewonnenen Palmsaft in Karaffen und Gläsern vorsetzen ließ. Die Wohnung dieses wohlhabenden Mannes zeigte Überfluß an europäischen Artikeln, wie Stühlen, Bildern, Spiegeln, Uhren, Lampen und anderen Dingen mehr.
Das Leben auf dem Flusse ist zuzeiten ein bewegtes; so bei den von den Eingeborenen beliebten Ruderwettkämpfen, die wir mehrfach beobachteten und die in langen, von dreißig, vierzig, ja bis siebzig Leuten bemannten, originell verzierten Kanus abgehalten werden; oder auch bei der Ankunft von reich mit Fahnen geschmückten Handelskanus, die mit Palmöl und Kernen, Elfenbein, Ebenholz und Rotholz beladen unter Gesang, Geläut und Trommellärm zu den Faktoreien oder Hulks gerudert werden.
Ein anderes Bild muß der Fluß kurze Zeit vor unserer Ankunft geboten haben, denn es war, wie es alle vier Jahre zu Ende August oder Anfang September geschehen soll, ein ungeheurer Zug von Krebsen, eine Art Langschwänze, die Flüsse abwärts gekommen, und die gesamte Bewohnerschaft war mehrere Tage und Nächte beschäftigt gewesen, den Segen zu bergen und am Ufer bei großen Feuern aus den Tieren verschiedene Nahrungsmittel und Öl zu bereiten. Dieser Krebsniedergang ist die Ursache des Namens Kamerun geworden; aus den camerones und cameroes der älteren portugiesischen Seefahrer und Geschichtsschreiber ist das englische Cameroons und aus diesem das deutsche Kamerun entstanden.
Über die Eingeborenen selbst, ihre Trommelsprache, ihre und der Weißen Lebensweise, über das Kamerungebirge und andere Gebiete dieses unser Interesse in hohem Maße in Anspruch nehmenden Landes kann ich füglicherweise schweigen, da seit jener Zeit mehrfach und einige Male von berufener Seite darüber berichtet worden ist.
Unser Aufenthalt in Kamerun währte fünf Tage, ohne daß wir das Vergnügen gehabt hätten, den Kamerunberg auch nur einmal aus dem ihn umhüllenden Nebel hervortreten zu sehen.
Am 8. September verließ der »Professor Woermann« den Platz und am anderen Morgen liefen wir zugleich mit dem für Woermann gecharterten Dampfer »Graßbroek« die spanische Insel Klein-Cloby an, auf der sich die Depots von Woermann, Jansen und Thormählen und einigen anderen Firmen befinden. Von diesen Depots aus werden die einzelnen Faktoreien an der Küste sowie an den Flüssen durch kleinere Dampfer oder Boote mit Waren versehen, und hierher strömen die dort eingehandelten Produkte zusammen. Die Insel ist sehr klein und in einer halben Stunde zu umgehen, jedoch bot sie uns ein interessantes Bild eines Tropenwaldes. Am 11. lief die »Möve« mit Dr. Nachtigal an Bord die Insel an, und fand der Generalkonsul, trotzdem sein Aufenthalt nur wenige Stunden währte und diese der Korrespondenz gewidmet werden mußten, doch in seiner liebenswürdigen Weise Zeit genug, mit uns über die Aussichten und Verhältnisse unserer Expedition zu plaudern.
Es ist hier das letzte Mal gewesen, daß ich Dr. Nachtigal gesehen habe. Als ich Anfang Juni 1885 mich an der Küste befand, erhielt ich die Nachricht seines Todes, in Landana aber – wiederum an Bord des »Professor Woermann« – die Bestätigung desselben.
Während der Anwesenheit unseres Dampfers vor Cloby siedelte ich in das Woermannsche Haus über, wo mir Gastfreundschaft in ausgedehntestem Maße zu teil wurde.
Am 12. lichtete der »Professor« die Anker, um am folgenden Tage vormittags die Reede von Gabun zu erreichen, womit für mich der Moment der vorläufigen Trennung von den übrigen Herren der Expedition gekommen war, denn ich beabsichtigte für einige Wochen meinen Aufenthalt auf der bei Gabun gelegenen Sibangefarm zu nehmen, um mich dann später wieder mit den anderen Herren zu vereinigen. Angekommen am Ausgangspunkte des Inlandmarsches, als welcher damals Ambrizette in Aussicht genommen war, mußte es natürlicherweise wochenlanger Vorbereitung bedürfen, um die Expedition mit Trägern zu versehen und marschfähig zu machen. Ich glaube – worin mir Premierleutnant Schulze völlig zustimmte – einen Teil dieser Zeit in einer für die Expedition sehr vorteilhaften Weise zu verwenden, wenn ich mich auf der Sibangefarm, die Herrn Soyaux, einem früheren Mitgliede der Loangoexpedition, unterstellt war, und auf dessen Erfahrung und freundliche Unterstützung ich hierbei hoffte, naturwissenschaftlichen und speziell botanischen Studien ergeben würde. Die Anwesenheit des Herrn Soyaux, das Renommée der Anlagen der Gabuner Mission und die seit Jahren in Kultur genommene Kaffeeplantage hatten uns schon in Europa die Sibangefarm für diesen Zweck als den allergeeignetsten Ort erscheinen lassen, und Herr Woermann in Hamburg, der Eigentümer der Plantage und Chef des großen Handelshauses, hatte zu diesem Plan in liebenswürdigster Weise die erbetene Erlaubnis erteilt.
Somit verließen Premierleutnant Kund, Dr. Wolff und ich selbst bald nach unserer Landung die Gabunfaktorei, um, von einem Führer begleitet, den Weg zu der Farm anzutreten und den dortigen Herren einen Besuch abzustatten. In kurzer Entfernung vom Strande, an dem die Faktoreien unmittelbar errichtet sind, erhebt sich das Land zu einer mäßig gewellten Fläche, auf der ein etwa dreistündiger Marsch uns zum Ziele brachte. Während der ersten Weghälfte führte der Pfad über eine von Gras und Adlerfarnkraut bestandene Steppe, auf der zerstreut Gebüsch und einzelne Bäume, darunter Palmen und Mangopflaumen, hervorragten. Bei einem sehr hübschen Busch von indischem Bambus traten wir in prächtig üppigen Urwald ein, in dem ein bequemer Weg uns über eine ganze Anzahl Brücken und an zwei Eingeborenenniederlassungen vorüber zum Farmterrain führte, welches, durch Abholzen gewonnen, rings von hochstämmigem Wald umgeben ist. Ich entsinne mich noch genau des großartigen Eindruckes, unter dem ich inmitten dieser grandiosen Vegetation stand, und den ich späterhin nicht wieder in demselben Maße empfunden habe, wobei ich gleich bemerken will, daß ich während meiner ganzen Reise überhaupt nicht oft Gelegenheit gefunden habe, berechtigte Vergleiche mit diesem Gabuner Waldland anzustellen.
Inmitten der weitgedehnten Kaffeefelder erhoben sich die beiden zierlichen Wohnhäuser, in denen wir mit großer Freundlichkeit aufgenommen wurden. Das eine wurde bewohnt von Herrn Soyaux und seiner zur damaligen Zeit etwas leidenden Gattin – einer deutschen Dame, wenn ich nicht irre, aus Stade gebürtig – und dem dreimonatlichen kräftigen Sprößling, das andere hatten die beiden anderen Angestellten der Farm, die Herren Ingenieur Schran und Mahnke, inne.
Nachdem meine Übersiedelung festgesetzt war, kehrten wir, da der Kapitän noch an demselben Tage die Fahrt nach Süden fortzusetzen beabsichtigte, in Begleitung der beiden letztgenannten Herren nach Gabun zurück. Indessen wurde der Dampfer noch bis zum 15. zurückgehalten, da die Ladung am Tage der Ankunft nicht gelöscht werden konnte, am folgenden aber, einem Sonntage, nicht gearbeitet werden durfte. An diesem Sonntage fand die Einweihung der neuen Missionskirche durch den Erzbischof statt, welcher Feierlichkeit der Gouverneur nebst Gemahlin, die Offiziere der auf Reede liegenden französischen Kriegsschiffe, sowie fast die sämtlichen weißen Herren der Kolonie beiwohnten.
Am Montag Nachmittag verließ der »Professor Woermann« Gabun, und wir, die Herren Schran und Mahnke und ich selbst, machten uns auf den Rückweg zur Farm, wohin meine Sachen bereits durch einige Kru- oder Whyleute gesendet worden waren, und wo man mir in dem Nebenhause ein freundliches Heim eingerichtet hatte.
Mein Aufenthalt auf der Farm – durch verspätetes Eintreffen des nächsten Woermanndampfers wurde die ursprünglich in Aussicht genommene Zeit überschritten – hat vom 15. September bis zu Anfang November gewährt, aus welchen Wochen meiner Erinnerung nur freundliche Bilder geblieben sind, so daß ich noch heute Herrn Woermann sowohl als den Farmbewohnern mich dankbar verpflichtet fühle.
Was nun den eigentlichen Zweck meines Aufenthaltes anbetrifft, so wurde derselbe erreicht, soweit er sich im fernen Afrika ohne wissenschaftliches Material erreichen ließ. Die Zeit war nicht gerade die günstigste, denn erst während meines Aufenthaltes stellten sich die Regen häufiger ein und mit ihnen Üppigkeit und Mannigfaltigkeit der Formen. Auf zahlreichen Exkursionen, die mich zumeist in Gesellschaft des Herrn Schran in den Wald führten, wo dieser Herr einen breiten und bequemen Weg nach Gabun anzulegen hatte, sind einige hundert phanerogamische Spezimina gesammelt worden, die den Grundstock der Ausbeute meiner Reise bilden. Hierzu kommt eine Sammlung von Gefäß- und Zellenkryptogamen, sowie eine solche interessanter Früchte. Für die zoologische Kollektion fand ich reichliche Unterstützung: Herr Schran überraschte mich mit einer Anzahl auf dem Farmterrain gefangener Amphibien und Reptilien, während er seine Leute anwies, beim Holzschlagen auf die zahlreich zu Tage kommenden Insekten zu achten. Der Headman der Whyleute, Monrovia, hat mich auch in dieser Beziehung nicht in Stich gelassen, und einige neue Tiere sind eigentlich durch ihn der Wissenschaft bekannt geworden. Den mir von Herrn Soyaux zur Bedienung freundlichst übersandten Whyboy William endlich hatte ich zum Schmetterlingfangen angestellt; er leistete freilich nichts Bedeutendes darin, dagegen – wie ich erst später herausfand – machte er sich selbst etwas reichlich für seine Bemühungen aus meiner Tasche bezahlt.
Außer in rein wissenschaftlicher Beziehung war mir die Farm in praktischer Hinsicht ein wichtiger Gegenstand der Belehrung, leider – besonders für die Unternehmer – in negativer Weise, denn schon damals war nicht zu verkennen, daß die zur Anlage der Kaffeeplantage verwendete jahrelange Arbeit und die sehr bedeutenden Kosten einen Erfolg nicht geben würden. Einige Zeit nach meinem dortigen Aufenthalt – es sind im ganzen nur einige hundert Pfund Kaffee geerntet worden – ließ dann auch Herr Woermann die Farm eingehen. Es ist nicht der Zweck des Buches, diese Verhältnisse näher zu berühren, doch will ich – vielleicht zu Nutz und Frommen irgend eines Plantagenbauschwärmers – erwähnen, was mir als Ursache des massenhaften Absterbens der jungen Kaffeebäume, nachdem sie einige Zeit recht gut gediehen waren, erschien.
Laterit, jene den Tropen eigentümliche durch die Einwirkung der Atmosphärilien entstandene Bodenformation, bildet in der Farm überall die Grundlage einer zuweilen nur minimalen Lehm- und Humusschicht. Dieses Laterit genannte Gestein, dessen Haupteigenschaft völlige Durchlässigkeit ist, ist in feuchtem Zustande eine zähe, schneidbare Masse, im trocknen dagegen spröde und steinhart. Die Wurzeln vermögen, zu dieser Schicht gelangt, nicht in dieselbe einzudringen und noch weniger aus derselben – ihrer Durchlässigkeit wegen – Nährstoffe aufzunehmen. Die Pflanzen sind somit für die Ernährung auf die obersten Humus- und Lehmschichten angewiesen. Diese, zur Zeit der Anlage jungfräulicher Böden, sind aber nach Verlauf einiger Jahre völlig verändert worden. Heftige Regengüsse haben den Humus in die Rawinen abgeschwemmt – die Farm ist auf welligem Terrain gelegen – und der von der Sonne gebleichte Sand folgt allmählich nach, womit den Wurzeln Bedeckung und Ernährung genommen ist und die jungen Kaffeesträucher saisonweise in Menge dem Absterben geweiht sind.
Mit anderen Gewächsen hat die Missionsstation in Gabun bessere Erfahrungen gemacht, wovon ich mich durch mehrfachen Besuch dortselbst unter Führung liebenswürdiger Pères überzeugen konnte. Man pflanzt in Menge Kokos- und besonders Ölpalmen, deren Kultur sehr lohnende Erfolge liefert. Diese Mission verdient übrigens den Namen einer Musteranlage, wie ein jeder, der einen Gang durch die Kulturen tropischer Fruchtbäume und europäischer Gemüse macht, bestätigen wird.
Als ich am 2. November, um mich in Gabun an Bord des »Karl Woermann«, Kapitän Hupfer, einzuschiffen, die Sibangefarm verließ, wurde mir der Abschied von derselben, wo ich die liebenswürdigste Gastfreundschaft gefunden hatte, schwer genug, und noch jetzt gedenke ich in dankbarer Erinnerung der damaligen Farmbewohner, der Ausflüge mit Handpresse und Jagdflinte in den prächtigen Urwald, der Besuche in Gabun zu Fuß und zu Pferde, der Entdeckungs- und Vermessungsfahrt auf dem Abandu, der Picknicks am Bambus, wo wir halbwegs nach Gabun die deutschen Herren dieser Kolonie trafen, der Besuche in den Dörfern der Pongwe, Pangwe und Schekiani, endlich all der häuslichen Fröhlichkeit und Gemütlichkeit, die den Gedanken an die ferne Heimat kaum aufkommen ließen.
An Bord des »Karl Woermann«, der Gabun am 3. November verließ, fand ich Herrn Veth vor, einen Holländer, der eine Spedition in das Hinterland von Mossamedes unternehmen wollte, dessen Reise auch unter günstigen Auspizien begann, durch den Tod des Leiters in den ersten Monaten des folgenden Jahres aber einen traurigen Abschluß fand. Herr Veth, dem reiche Reiseerfahrungen aus Holländisch-Indien zur Seite standen, führte Pferde und Berghunde von Java mit sich, denen allen übrigens ein nur kurzes Leben in Afrika vergönnt sein sollte. Ein aus Bayern gebürtiger Pater der französischen Mission und einige Angestellte der »Association internationale africaine«, darunter Kapitän Grant Elliot, vervollständigten unsere Reisegesellschaft, letzterer indessen nur bis zur Station Grantville an der Loangoküste.
Am 6. November erreichten wir Kap Lopez, den damaligen Stapelplatz der Brazzaschen Unternehmung, und Majumba, wo wir mit frischen Mangroveaustern versehen wurden, deren vielleicht zu reichlicher Genuß einige der Herren auf vierundzwanzig Stunden recht krank machte. Am 7. passierten wir Loango mit der steilen, in interessanter Weise erodierten roten Küste, um – ehe wir Banana erreichten – noch in Landana und Cabinda vor Anker zu gehen.
In Landana betrat ich zum ersten Male eine Faktorei der »Nieuwe Afrikaansche Handels-Vennootschap« von Rotterdam, eines Hauses, dessen unvergleichliche Gastfreundschaft mir zu wiederholten Malen während meines Aufenthaltes am Kongo zuteil werden sollte. Herr de la Fontaine, der damalige stellvertretende Hauptagent dieser Gesellschaft, teilte mir bereits hier mit, daß die übrigen vier Herren der deutschen Expedition in Banana anwesend seien, um einem veränderten Reiseplan zufolge den Kongo zur Operationsbasis zu nehmen. In Landana befindet sich unter der Leitung des energischen P. Carrie eine ebenfalls mustergültige Station der französischen Mission, deren Anlagen meine ungeteilte Bewunderung hervorriefen. In Cabinda, dem Hauptstapelplatz englischer Firmen, hatten wir einen Jagdausflug auf Papageien und Turakos. Doch das Interesse an der langen Küstenfahrt war geschwunden und mit Sehnsucht schaute ich nach Süden aus, wo die Mündung des Kongo das Ende derselben bringen sollte. Am 13. November wurde glücklich Banana erreicht, wo ich die Mitteilung des Herrn de la Fontaine bestätigt fand. Die Herren der Expedition hatten nach einem vergeblichen Versuch des Premierleutnants Schulze, dieselbe in Ambrizette oder Ambriz zu organisieren, diesen Plan aufgegeben, um nun vom unteren Kongo aus den Aufbruch in die östlichen Länder zu betreiben.
1Hier eine die gesamte Insel und alle Personen umfassende Quarantäne (Red.).
2Ausstiegsgenehmigung (Red.)
3Eine Art Curling (Red.).
4Schiffsjungen (Red.)
5D. h. ein Wohnschiff (Red.)
2. KAPITEL:
AM UNTEREN KONGO
Nachdem ich den »Professor Woermann« in Gabun verlassen hatte, war Dr. Wolff in Cabinda zurückgeblieben, um bei günstiger Gelegenheit dort Träger für die Expedition zu engagieren. Premierleutnant Kund aber ging in Banana an Land, um die Verhältnisse am unteren Kongo zu studieren für den Fall, daß dem Vordringen von der südlichen Küste aus sich Schwierigkeiten entgegenstellen sollten. So landeten denn in Ambrizette nur Premierleutnant Schulze und Leutnant Tappenbeck mit dem Gepäck, um freilich sofort diesen Platz für die Ausrüstung der Expedition und die Beschaffung von Trägermaterial ungeeignet zu finden. Die Herren siedelten infolgedessen sehr bald nach Ambriz über, um dort dieselbe Erfahrung zu machen. Das Mißtrauen der portugiesischen Behörden sah in der deutschen Expedition eine Gefahr für den eigenen von den Nationen nur zum Teil anerkannten Besitz der südlich des Kongo gelegenen Küste – ein Mißtrauen, welches durch die jüngst vorausgegangenen Besitzergreifungen Deutschlands an verschiedenen Stellen der afrikanischen Westküste nicht unberechtigt zu nennen war. Die Kaufleute verschiedener Nationalität aber fürchteten in uns verkappte Konkurrenten oder durch das Vorgehen der Expedition eine Störung und Schädigung ihrer Handelsverbindungen. Premierleutnant Schulze begab sich zu erneutem Versuch über Loanda nach Benguela und Novo-Redondo, an welch letzterem Platze ein portugiesisches Haus sich bereit erklärte, innerhalb zweier Monate 200 Träger zu beschaffen und dieselben nach Ambriz zu senden, sobald der Gouverneur der Provinz Angola dazu seine Erlaubnis gegeben haben würde. Um diese Erlaubnis einzuholen, reiste Premierleutnant Schulze nach Loanda zurück, wurde aber dort auf die Gesetzesparagraphen verwiesen, denen zufolge Eingeborene, die aus den portugiesischen Besitzungen stammen, nur innerhalb der Grenzen derselben in ein Lohnverhältnis genommen werden dürfen. Der Gouverneur wollte endlich die Erlaubnis der Anwerbung erteilen, wenn die Expedition von Benguela oder Bihé vorzugehen sich entschlösse. Der Leutnant glaubte diesen Vorschlag ablehnen zu müssen und kehrte – an einem Erfolg weiterer Verhandlungen mit den portugiesischen Behörden verzweifelnd – nach Ambriz zurück, um von dort aus mit Leutnant Tappenbeck, dem inzwischen dort eingetroffenen David Kornelius und dem gesamten Gepäckmaterial nach Banana überzusiedeln, wohin unterdessen auch Dr. Wolff von Cabinda, ebenfalls ohne Erreichung des Zweckes seines Aufenthaltes, gekommen war.