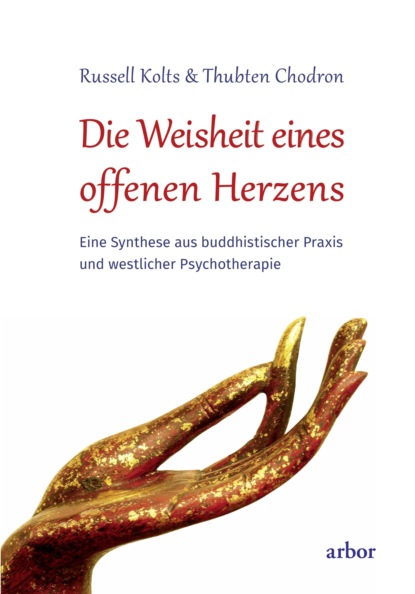- -
- 100%
- +
Mitgefühl ist ein Geschenk, das wir anderen großzügig machen. Eine Gegenleistung dafür zu erwarten, und sei es nur ein Dankeschön, kann zur Enttäuschung führen. Selbst wenn uns jemand dankt, profitiert die Person, die den Dank ausspricht, am meisten, nicht die, die ihn empfängt. Die Person, die sich bedankt, fühlt sich glücklich, weil sie ihre Wertschätzung für die ihr entgegengebrachte Güte zeigt und ihre Bereitschaft, sie zu erwidern. Wenn uns jemand nicht dankt, muss das weder unsere Freude noch unser Mitgefühl schmälern. Mit anderen Worten, wir beziehen unsere Freude aus dem Akt des Gebens, nicht daraus, dass jemand Dankbarkeit zeigt für das, was wir getan haben. Wir empfinden Zufriedenheit, weil wir in Übereinstimmung mit unseren Werten gehandelt haben. Uns begegnen im Laufe unseres Lebens vielleicht viele Situationen, in denen unser Mitgefühl ganz natürlich geweckt wird. Berührt von dem Leid, das wir beobachtet haben, sind wir vielleicht motiviert, auf eine hilfreiche Weise zu handeln. In solchen Situationen ist es wichtig, ehrlich einzuschätzen, was wir tun können – und was nicht. Dann können wir effektiv den Beitrag leisten, der uns möglich ist, ohne zu versuchen, Lasten zu schultern, die wir nicht tragen können oder die nicht die unseren sind. Wenn wir beispielsweise beobachten, wie ein Kollege mit einer ihm übertragenen Aufgabe zu kämpfen hat, geraten wir vielleicht in Versuchung, sie für ihn zu übernehmen, selbst wenn wir wissen, dass es seine Verantwortung ist und wir mit unserer eigenen Arbeit genug zu tun haben. Es könnte dann besser sein, ihm einfach freundlich zuzuhören und vielleicht ein paar ermutigende Worte zu sagen. Wenn wir uns aus einem Gefühl der Verpflichtung oder einem Schuldgefühl dazu zwingen, mehr zu tun, entsteht unterschwelliger Groll und das nimmt dem Geben die Freude. Schuld und Mitgefühl sind unvereinbar. Mitgefühl muss aus einer inneren Freiheit kommen, dann ist es am besten für uns und andere.
Manchmal ist unser Mitgefühl größer als das, was wir – oder irgend jemand anders – in der betreffenden Situation tun können. So haben wir nach dem Erdbeben auf Haiti 2010 vielleicht tiefes Mitgefühl für die Menschen empfunden, die ihr Zuhause verloren hatten oder verletzt wurden. Doch als Einzelperson sind wir nicht in der Lage, etwas gegen eine Tragödie solchen Ausmaßes zu tun. Wir müssen stattdessen tun, was wir können – beispielsweise eine Spende an eine Wohltätigkeitsorganisation überweisen. Um unser Mitgefühl auch dann aufrechtzuerhalten, wenn wir keine praktische Hilfe geben können, können wir die „Geben-und-Nehmen-Meditation“ üben, die in Beitrag 30 beschrieben wird.
BETRACHTUNG
Die Verwirrung in Bezug auf Mitgefühl beseitigen
Denken Sie an eine Zeit zurück, in der Sie eine falsche Vorstellung von Mitgefühl hatten: Als Sie beispielsweise dachten, Mitgefühl bedeute, es anderen recht zu machen oder jemandem aus einer Verpflichtung oder einem Schuldgefühl heraus zu helfen. Wie hätten Sie Ihre Haltung in echtes Mitgefühl umwandeln können? Stellen Sie sich vor, dass Sie das tun. Stellen Sie sich dann vor, aus echtem Mitgefühl heraus zu handeln.
8 Eine andere Art von Stärke

Obwohl das Entwickeln und Kultivieren von Mitgefühl manchmal herausfordernd und unbequem sein kann, lohnt es sich. Mitgefühl hilft uns, unsere Werte zu leben, anderen Menschen zu helfen, Probleme in unseren Gemeinden zu lösen und zu einer besseren Welt beizutragen. Wenn wir mit Mitgefühl auf Herausforderungen antworten, können wir unsere innere Einstellung ändern und positiv auf die Situationen und Menschen einwirken, die uns begegnen; wir können anderen und uns selbst Unterstützung geben, wenn wir mit Dingen konfrontiert werden, die wir nicht ändern können.
Je öfter wir Mitgefühl praktizieren, desto einfacher wird es. Wir entdecken, dass wir dazu fähig sind. Wir stellen fest, dass wir mit all den beängstigenden Gedanken, die wir in unserem Geist erzeugt haben, sowie mit den Gefühlen, von denen wir glaubten, sie seien ganz und gar unerträglich, umgehen können. Wenn wir uns den Dingen, die uns ängstigen, immer wieder mutig stellen, hören sie auf, so beängstigend zu sein.
Psychologen nennen dies Habituation. Es bedeutet, dass ein Gewöhnungseffekt eintritt, wenn wir uns immer wieder den Dingen aussetzen, die uns ängstigen, und dann nichts Schreckliches passiert. Unsere Angst lässt dann im Lauf der Zeit allmählich nach. Wie Shantideva in The Way of the Bodhisattva schrieb: „Es gibt nichts, das nicht durch Vertrautheit leichter wird.“1
Wenn wir mit Menschen zusammen sind, die trauern, Angst haben oder wütend sind, und ihnen gegenüber eine mitfühlende Haltung einnehmen, beginnen wir zu verstehen, dass wir intensive Gefühle anderer aushalten können, ohne darauf reagieren oder etwas in Ordnung bringen oder flüchten zu müssen. Wenn wir mit Menschen in Kontakt kommen, deren Herkunft oder Hintergrund, Manieren, Glaubensvorstellungen oder Lebensweise uns anfangs abstoßen, verstehen wir allmählich, dass auch sie wertvolle Menschen sind, die genau wie wir Hoffnungen und Träume haben und genau wie wir einfach glücklich sein und nicht leiden wollen.
Als ich (Russell) anfing, in Gefängnissen Compassion-Focused-Therapy-Gruppen für den Umgang mit Wut zu leiten, war ich zunächst ein bisschen eingeschüchtert. Einige der Gefangenen saßen wegen Vergewaltigung, Mord und anderen Gewalttaten ein, und ich war hier, um mit den richtig Wütenden zu arbeiten! Doch bald stellte ich fest, dass diese Männer in vielen Dingen genau wie ich waren und dass sie, wenn man ihnen die Gelegenheit gab und ihnen mit Mitgefühl begegnete, nicht nur Verantwortung für ihre Taten übernahmen, sondern auch dafür, ihr Leben zu ändern, und sich darum bemühten, ihre Wut durch Mitgefühl zu ersetzen.
Jetzt, nach mehr als drei Jahren Gruppenarbeit, kann ich voller Überzeugung sagen, dass ich niemals mit einer engagierteren Gruppe von Menschen gearbeitet habe. Obwohl es einige Sitzungen dauerte, bis diese Männer die Vorstellung an sich heranlassen konnten, sich selbst als „mitfühlend“ zu betrachten, begannen sie fast unmittelbar, alles umzusetzen, was ich sie über Mitgefühl und das Praktizieren von Mitgefühl lehrte. Anstatt sich selbst und andere zu verurteilen und zu verdammen, versuchten sie zu verstehen. Anstatt auf kleine (und große) Provokationen mit Wut und Gewalt zu reagieren, begannen sie, in solchen Situationen einen Moment innezuhalten, um „sich abzuregen“, und versuchten, die Dinge von einem anderen Standpunkt aus zu sehen. Anstatt gleichgültig zu bleiben, fingen sie an, anderen Inhaftierten mit Freundlichkeit zu begegnen. Das ging so weit, dass sie ihren Zellengenossen und anderen im selben Trakt beizubringen versuchten, was sie lernten. Der häufigste Kommentar, den ich von diesen Männern zu hören bekam, war, dass sie oft von anderen Menschen – von den Vollzugsbeamten bis hin zu ihren Angehörigen – gefragt wurden: „Was ist passiert? Du bist so anders. Was machst du?“ Ihre Antwort lautete: „Mitgefühl.“
Wenn wir uns erlauben, voller Mitgefühl die ganze Bandbreite unserer Emotionen zu erleben, auch solche, die uns überwältigend oder abstoßend erscheinen, fangen wir an zu verstehen, dass wir sie fühlen können, ohne davon überwältigt zu werden. Indem wir mit unserer Angst, Wut, Trauer, Gier oder unserem Abscheu vertraut werden, lernen wir, dass es möglich ist, in diese Gefühle hinein- und wieder herauszukommen, ohne darin gefangen zu bleiben. Wir können lernen, mit uns selbst warmherzig und mitfühlend umzugehen, wenn wir mit unseren schwierigen Gefühlen zu kämpfen haben – so wie wir mit anderen Menschen in solchen Situationen umgehen. Auf diese Weise entdecken wir allmählich Möglichkeiten, uns sicher zu fühlen, während wir zulassen, alle Gefühle, die da sind, zu erleben. Wir lernen, Empathie auszudrücken, und entwickeln mitfühlende Kompetenzen, auf die wir in unserem Leben zurückgreifen können.
Wenn all das zusammenkommt – Habituation, Erkennen, Verständnis und neue Kompetenzen –, verfügen wir über eine neue Art von Stärke. Wir erleben ein Selbstvertrauen und eine Furchtlosigkeit, die in der Tat beeindruckend sind. Es ist die Stärke, sich dem Leben zu stellen – gerade so, wie es kommt.
Unsere Angst weicht der Zuversicht: „Was auch geschieht, ich kann einen Weg finden, damit umzugehen.“ Indem wir erkennen, was uns verbindet, wird die Vorstellung vom „Feind“ lächerlich. Wenn wir uns durch Sichtweisen, die sich von unseren unterscheiden, nicht länger bedroht fühlen, werden wir besonnener, und das Bedürfnis, ständig unsere eigenen Ansichten durchzusetzen, weicht der Bereitschaft, zuzuhören und von anderen zu lernen.
Indem wir erkennen, dass die Dringlichkeit, die wir empfinden, wenn ein starkes Gefühl hochkommt, einfach nur ein Aspekt des Gefühls selbst ist, können wir auch sehen, wenn eine Situation eine ausgewogenere, differenziertere Herangehensweise erfordert. Denken Sie an eine Auseinandersetzung mit einem Partner oder einem Familienmitglied, bei der Sie wütend wurden und absolut sicher waren, dass Ihre Sichtweise die richtige ist. Die Wut oder Frustration kommt hoch und Sie verspüren den intensiven Drang, die Auseinandersetzung fortzuführen – zu versuchen, dem Gesprächspartner Ihren Standpunkt einzuhämmern –, selbst wenn Ihnen die Körpersprache Ihres Gegenübers eindeutig zu verstehen gibt, dass im Moment nichts zu ihm durchdringt. In solchen Situationen können wir erkennen, dass es bei unserem Drang, das Gespräch fortzusetzen, weniger darum geht, was jetzt hilfreich wäre. Es ist einfach nur die Art, wie sich unsere Wut in unserem Geist ausdrückt. Wenn wir das verstehen, können wir uns stattdessen entscheiden, zunächst einmal innezuhalten. Es ist bemerkenswert, wie unsere Fähigkeit, dies zu tun und dem anderen zuzuhören, dazu beiträgt, auch ihn dazu zu bewegen, sich „abzuregen“ und uns zuzuhören. Wir lernen auch, dass wir unsere Gefühle akzeptieren können, ohne sie auszuagieren, ihnen auszuweichen oder uns vorzuwerfen, dass wir sie haben. Stattdessen können wir ihnen wohlwollend begegnen, wie alten Freunden, die wir schätzen, die uns aber manchmal in die Irre führen können: „Wut, ich erkenne dich. Obwohl ich verstehe, dass du nur versuchst, mich zu schützen, ist deine Art, an die gegenwärtige Situation heranzugehen, nicht wirklich angemessen. Ich will dir helfen.“
Denken Sie an Menschen, die Ihnen vielleicht als Vorbild für Mitgefühl dienen können: Seine Heiligkeit der Dalai Lama, Jesus Christus, Mahatma Gandhi, Nelson Mandela, Mutter Theresa. Sie alle zeigen Furchtlosigkeit im Angesicht von Situationen, die viele von uns veranlassen würden, sich wegzuducken. Sie machen weiter, wo sich viele andere abwenden würden. Das heißt nicht, dass sie nie Angst hatten. Es heißt einfach, dass sie keine Angst vor der Angst hatten. Sie akzeptierten ihre Angst und gingen dennoch weiter. Das ist der Mut des Mitgefühls.
BETRACHTUNG
Die Essenz des Mitgefühls ist die Erkenntnis, dass wir alle glücklich und frei von Leiden sein wollen.
Diese einfache Wahrheit verbindet uns alle. Denken Sie einmal über Ihr tiefstes Verlangen nach: Drehen sich nicht alle Ihre Aktivitäten jeden Tag um den Wunsch, glücklich zu sein und nicht zu leiden?
Das gilt auch für jeden anderen Menschen. Die Person, die im Supermarkt vor Ihnen in der Kassenschlange steht und laut in ihr Handy spricht, will glücklich sein und nicht leiden. Der Politiker, der in der Fernsehsendung seinen Kontrahenten bösartig attackiert, will glücklich sein und nicht leiden. Der Mann, der am Straßenrand um ein paar Münzen bettelt, will glücklich sein und nicht leiden. Wenn wir hinter die äußere Fassade der Handlungen anderer schauen können, sehen wir den tiefen Wunsch, glücklich zu sein und nicht zu leiden.
Erinnern Sie sich im Laufe des Tages bei Ihren Begegnungen mit anderen immer wieder daran, dass deren tiefster Wunsch, wie der Ihre, darin besteht, glücklich zu sein und nicht zu leiden. Wenn Sie an einer roten Ampel stehen, im Zug unterwegs sind, eine Straße entlang gehen oder in einer Schlange warten, schauen Sie sich die Menschen an und denken Sie: „Dieser Mensch wünscht sich genau wie ich, glücklich zu sein und nicht zu leiden.“ Lassen Sie dieses Bewusstsein tief in Ihr Herz sinken. Gehen Sie dann noch einen Schritt weiter und senden Sie diesen Menschen gute Wünsche: „Mögest du glücklich und frei von Leiden sein.“ Und diesen freundlichen Wunsch können wir auch zu uns selbst aussenden. Das wiederholte Aussenden mitfühlender Wünsche kann uns innerlich transformieren: Während wir uns allmählich mitfühlende Verhaltensweisen angewöhnen, ersetzen diese unsere Angewohnheit, zu urteilen, zu kritisieren und zu beschämen, die uns in der Wut, der Angst und Negativität gefangen hält.
TEIL II
Die „Bausteine“ des Mitgefühls
9 Achtsames Gewahrsein

Mitgefühl wird oft blockiert, wenn unser Geist von belastenden Gefühlen oder Gedanken quasi überrollt wird. Es ist ziemlich einfach, freundlich und mitfühlend zu sein, wenn alles gut läuft. Ein Problem entsteht erst, wenn uns Gefühle wie Wut, Angst, Eifersucht, Anspannung oder kritische und negative Gedanken „anspringen“. Wenn wir nicht achtgeben, können wir uns in solchen Emotionen und Gedanken verlieren und mit unserem Mitgefühl ist es schnell vorbei.
Seit Jahrzehnten arbeiten westliche Therapeuten mit achtsamkeitsbasierten Therapieansätzen, die auf traditionelle buddhistische Praktiken zurückgehen, um ihren Patienten zu helfen, mit problematischen Gefühlen und Gedanken umgehen zu lernen. Immer mehr wissenschaftliche Forschungsergebnisse weisen darauf hin, dass das regelmäßige Praktizieren der Achtsamkeitsmeditation sogar das Wachstum in Gehirnregionen anregen kann, die mit der Regulierung von Emotionen, dem Gefühl von Identität, Mitgefühl und Empathie assoziiert werden1. Es gibt eine Reihe ausgezeichneter Bücher und anderes Material über Achtsamkeit, falls Sie mehr darüber erfahren möchten. Wir werden nun kurz erläutern, auf welche Weise erhöhte Achtsamkeit uns dabei helfen kann, unser Potenzial zum Mitgefühl zu entfalten. Was genau ist eigentlich mit Achtsamkeit gemeint? In psychologischen Kreisen definieren wir Achtsamkeit allgemein als bewusstes, nicht urteilendes Gewahrsein dessen, was in unserem Inneren und um uns herum im gegenwärtigen Moment vor sich geht. Mit achtsamem Gewahrsein halten wir weder an unseren Erfahrungen fest noch lehnen wir sie ab, wir nehmen sie einfach zur Kenntnis und akzeptieren sie, wie sie sind. Wir können beispielsweise mit einem Familienmitglied über ein heikles Thema sprechen und wahrnehmen, wie unsere Stimme lauter wird und eine gewisse Schärfe bekommt. Dann wird uns bewusst, dass das von einem empfundenen Gefühl der Bedrohung herrührt und dass wir in die Defensive gehen und wütend werden. Achtsames Gewahrsein versetzt uns dann in die Lage, kluge Entscheidungen zu treffen – beispielsweise innezuhalten, „uns abzuregen“ und zu denken, bevor wir sprechen. Wenn wir belastende Gefühle und Gedanken nicht als solche wahrnehmen und nicht erkennen, dass es vorübergehende geistige Zustände sind, können wir leicht von ihnen fortgetragen werden.
Hier ein paar Beispiele: Ich (Russell) habe sowohl viel mit Eltern gearbeitet, die bei der Erziehung ihrer herausfordernden Kinder an ihre Grenzen stießen, als auch mit Erwachsenen, die schreckliche Kindheitserfahrungen mit ihren Eltern gemacht hatten. Stellen Sie sich eine Situation vor, in der ein Kind etwas tut, das uns wirklich sehr aufregt. Nehmen wir an, mein Sohn regt sich über irgendetwas auf und stößt aus Versehen gegen meine Lieblingsgitarre, die von ihrem Ständer rutscht und auf die steinerne Kamineinfassung knallt, sodass sie einen tiefen Kratzer abbekommt. In der Hitze des Gefechts, in der rasch Wut hochkommt, könnte es leicht passieren, dass wir gedankenlos Dinge sagen, die unserem geliebten Sohn großen Schmerz bereiten, Dinge, die wir niemals sagen würden, wenn wir in einer ausgeglichenen Stimmung wären: „Warum kannst du nicht aufpassen, wo du hintrittst? Bist du blöd? Ich kann nie etwas Schönes haben, ohne dass du es kaputtmachst! Geh‘ mir aus den Augen!“ Solche Kommentare können dauerhaften Schaden anrichten, besonders, wenn sie im Laufe vieler Jahre ständig oder häufig wiederholt werden.
Achtsames Gewahrsein kann uns helfen, bewusst wahrzunehmen, wenn wir von intensiven Gefühlen überwältigt werden, sodass wir unser Handeln in bessere Bahnen lenken können: „Oh je … ich bin wirklich wütend im Moment. Alles, was ich zu ihm sage, während ich mich so fühle, wird wahrscheinlich verletzend sein, also bin ich jetzt besser erst einmal still.“ Indem man dadurch eine gewisse Distanz zu dem intensiven Gefühl hergestellt hat, tun sich eine ganze Menge andere Optionen auf: Ich kann anfangen, tief und langsam zu atmen, kann mir ins Gedächtnis rufen, dass es ein Versehen war, kann mir sagen, dass es nur eine Gitarre ist und dass ich, wenn mir soviel daran liegt, dass sie nicht beschädigt wird, besser daran täte, sie in ihrer Hülle aufzubewahren und nicht auf einen instabilen Ständer neben den Kamin zu stellen, wo alle ständig vorbeilaufen! Wenn ich mich dann beruhigt habe, könnte mir sogar bewusst werden, dass dies eine wertvolle Lektion war – eine Chance, meinem Sohn zu zeigen, dass man mit stressigen Situationen auf eine ruhige, ausgeglichene Weise umgehen kann, anstatt Gift und Galle zu speien – so, wie ich gerne hätte, dass er als Erwachsener mit solchen Situationen umgeht. Im Laufe der Zeit kann er durch solche Interaktionen lernen, selbst auf konstruktive Art und Weise mit frustrierenden Situationen umzugehen.
Da wir gerade beim Thema Erziehung sind, sollte ich vielleicht noch anmerken, dass man Achtsamkeit auch auf andere Gefühle wie Angst und innere Unruhe anwenden kann. Zur Kunst der guten Erziehung gehört auch die Fähigkeit, ein gewisses Maß an Angst und Unbehagen auszuhalten, wenn unsere Kinder flügge werden und anfangen, die Welt auf eigene Faust zu erkunden. Das findet während ihrer gesamten Entwicklung statt – von dem Moment an, in dem sie laufen lernen und anfangen, unabhängig auf Spielplätzen herumzuspringen und zu spielen (herumrennen und unweigerlich hinfallen), bis zu dem Zeitpunkt, zu dem sie anfangen auszugehen, sich um Jobs zu bewerben und schließlich das Haus verlassen. In jedem Fall erfordert gute Elternschaft, dass wir ein Gleichgewicht herstellen können, das heißt, unseren Kindern soviel Unterstützung geben, wie sie brauchen, und gleichzeitig die Freiheit, zu lernen, herausfordernde oder schwierige Lebenssituationen selbst zu meistern. Wenn wir nicht in der Lage sind, unsere Angstgefühle oder unser Kontrollbedürfnis zu beobachten und zu akzeptieren, können wir leicht überbehütend und kontrollierend werden, um sicherzugehen, dass unsere Kinder nie etwas Leidvolles erleben. Doch dadurch lähmen wir sie.
Werden wir von solchen Emotionen überwältigt, könnte es sein, dass wir eine noch weniger hilfreiche Strategie verfolgen: dass wir unsere Kinder ignorieren oder uns gar völlig von ihnen zurückziehen, weil wir es nicht aushalten, mit anzusehen, wie sie sich abstrampeln. Achtsames Gewahrsein hilft uns, unsere eigenen Gefühle zu beobachten, zu akzeptieren und Verantwortung für sie zu übernehmen, damit wir mit ihnen arbeiten können, anstatt uns von ihnen unser Handeln diktieren zu lassen: „Natürlich ist es schwer, mit anzusehen, dass meine Tochter das durchmacht (und „das“ könnte alles sein, vom Sturz von einem Klettergerüst auf dem Spielplatz bis hin zu einer schmerzhaften Trennung), aber so lernt sie, solche Situationen selbst zu bewältigen. Was könnte mir helfen, meine eigenen Gefühle in den Griff zu bekommen, sodass ich für meine Tochter da sein kann, wenn sie mich braucht, aber ihr dennoch genügend Raum geben kann, sich als Individuum weiterzuentwickeln?“
Um auf das Thema belastende Emotionen und Gedanken zurückzukommen: Wir betrachten das, was wir denken, oft als absolute Wahrheit, sind überzeugt, dass „die Dinge so sind“, und reagieren dann, wenig überraschend, ziemlich heftig darauf. Unsere Gefühle sind sehr machtvoll, aber sie sind oft nicht besonders schlau – sie können nicht gut unterscheiden zwischen dem, was uns in der Außenwelt widerfährt, und den Gedanken und Bildern, die wir in unserem Geist produzieren.
Stellen Sie sich beispielsweise vor, Joe hält einen Vortrag und Gina, einer Frau in der ersten Reihe, fällt plötzlich ein, dass sie vergessen hat, einen Scheck einzureichen, der einige Abbuchungen decken soll, die übers Wochenende fällig werden. Die Bank schließt in zwanzig Minuten, also steht Gina abrupt auf – verärgert über sich selbst, weil sie es vergessen hat – und verlässt den Raum. Stellen Sie sich weiter vor, Joe bemerkt das und interpretiert ihr Verhalten auf eine selbstkritische Weise: „Sie denkt sicher, dass ich inkompetent bin und Unsinn rede.“ Er empfindet wahrscheinlich dieselben Gefühle, die er gehabt hätte, hätte Gina dies tatsächlich zu ihm gesagt: Scham, Anspannung, ein Gefühl der Peinlichkeit und vielleicht Feindseligkeit gegenüber Gina. Aber wir wissen natürlich, dass die Situation überhaupt nichts mit Joe zu tun hatte, er interpretierte ihr Handeln völlig falsch. Wir reagieren normalerweise sehr empfindlich auf wahrgenommene Bedrohungen, was dazu führen kann, dass wir Ereignisse irrtümlicherweise auf die denkbar schlimmste Art interpretieren und damit intensive emotionale Reaktionen auf mentale Vorgänge auslösen – auf Gedanken, Vorstellungen, Fantasien –, die kaum etwas mit dem zu tun haben, was tatsächlich vor sich geht.
Versuchen Sie sich nun vorzustellen, dass Joe anders reagiert. Stellen Sie sich vor, er ist sich seines Gedankens „Gina denkt, ich bin inkompetent und rede Unsinn“ bewusst und erkennt, dass es bloß ein Gedanke ist. Er hält inne, um nachzudenken: „Ich frage mich, ob es einen anderen Grund für ihr Verhalten gibt. Sie wirkte interessiert und engagiert. Vielleicht ist irgendetwas passiert, wovon ich nichts weiß.“ Stellen Sie sich vor, wie anders Joes emotionale Reaktion ausfallen würde, wenn ihm bewusst wäre, was in seinem Kopf vor sich geht.
Mit Achtsamkeit üben wir uns darin, unsere mentalen und emotionalen Erfahrungen als vorübergehende geistige Zustände zu erkennen und zu akzeptieren, ohne darüber zu urteilen oder daran festzuhalten. Indem wir uns auf unsere Gedanken und Gefühle als temporäre Erfahrungen beziehen, anstatt zu glauben, dass wir das sind oder dass die Dinge so sind, verschaffen wir uns den nötigen Raum, um damit zu arbeiten. Es ist der Unterschied zwischen dem völligen Gefangensein in der Wut und der Beobachtung: „Ich bin im Moment wirklich wütend. Ich frage mich, was mir jetzt helfen könnte, meinen Gefühlszustand zu ändern.“
Das Akronym RAIN kann uns helfen, uns an den inneren Prozess zu erinnern, um den es bei der Achtsamkeit geht:
R – Registrieren: zur Kenntnis nehmen, was in uns vor sich geht.
A – Akzeptieren: unserer Erfahrung erlauben, zu sein, wie sie ist.
I – Inspizieren: genau anschauen, was sich in uns abspielt.
N – Nicht identifizieren: durch das Beobachten unserer Erfahrung, ohne eins mit ihr zu werden.2
Achtsamkeit ermöglicht ein akzeptierendes, urteilsfreies Gewahrsein unserer Gedanken und Gefühle, sodass wir sie nicht notwendigerweise glauben müssen. Dadurch beginnen wir allmählich, anders über unsere Gefühle zu denken und zu sprechen, indem wir beispielsweise sagen: „Ich fühle Wut“ anstatt „Ich bin wütend.“ Die erste Aussage erkennt Wut als eine Erfahrung innerhalb unseres umfassenderen Gewahrseins an, mit der wir arbeiten und die wir verändern können. Die zweite Aussage spiegelt Identifikation wider: Wir fühlen uns eins mit der Emotion und sehen keine Möglichkeit, damit zu arbeiten.
Achtsamkeit hilft uns, Mitgefühl zu entwickeln, denn je mehr wir unserer sich ständig verändernden Gedanken und emotionalen Zustände gewahr sind, desto besser können wir mit den schwierigen arbeiten und jene inneren Erfahrungen kultivieren, die wir haben möchten (wie Mitgefühl!). Wir können auch beschließen, Mitgefühl in unser achtsames Gewahrsein hineinzubringen. Auf diese Weise praktizieren wir gleichzeitig Achtsamkeit und Selbstmitgefühl: „Ich fühle mich jetzt ängstlich (wütend, eifersüchtig, traurig). Wie kann ich mir in diesem Leiden selbst helfen und damit arbeiten?“