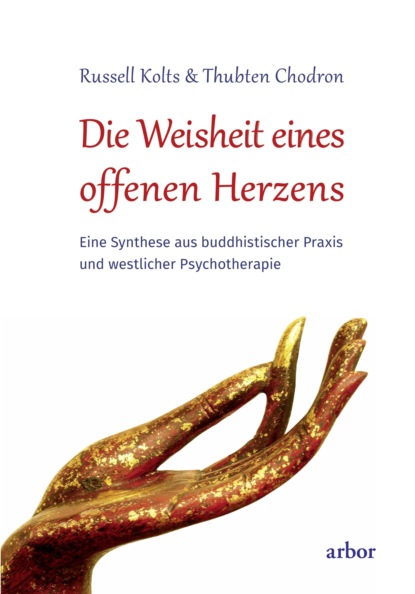- -
- 100%
- +
Eine bekannte Methode, sich in Achtsamkeit zu üben, ist die achtsame Beobachtung des Atems, die gerne zu Beginn angewandt wird. Dazu setzen wir uns aufrecht hin und lenken unsere Aufmerksamkeit sanft und freundlich auf den Atem. Wenn die Aufmerksamkeit nachlässt, weil sich Gedanken oder Ablenkungen einblenden, nehmen wir diese wahr, akzeptieren sie und bringen unsere Aufmerksamkeit sanft zum Atem zurück. Es gibt keinen Grund, frustriert zu sein, wenn wir feststellen, dass wir von unseren Gedanken fortgetragen wurden. Es ist ganz natürlich, dass Ablenkungen auftauchen, und es gelingt uns mit der Zeit immer besser, mit der Aufmerksamkeit da zu bleiben. Tatsächlich helfen uns diese Ablenkungen, uns darin zu üben, bestimmte Vorgänge in unserem Geist wahrzunehmen – beispielsweise, wenn Gedanken oder Gefühle auftauchen –, sodass wir dann mit diesen Erfahrungen arbeiten können. Im Laufe der Zeit werden wir diese Gedanken schneller wahrnehmen, akzeptieren, loslassen und unser achtsames Gewahrsein wieder zum Atem zurückbringen. Indem wir unsere Aufmerksamkeit wieder auf den Atem lenken, wollen wir unsere Gedanken oder Gefühle nicht unterdrücken oder ignorieren, sondern lernen, sie wahrzunehmen und ein wenig inneren Raum zu schaffen, damit wir nicht automatisch in unproduktive Gedankenschleifen hineingezogen werden, die uns leiden lassen. Es gibt viele gute Bücher und Informationsquellen zum Erlernen von Achtsamkeit. (Eine Reihe von Empfehlungen finden Sie im Abschnitt „Literatur“ am Ende des Buches. Auf www.compassionatemind.net finden Sie geführte Meditationen mit Übungen zum achtsamen Atmen.)
BETRACHTUNG
Achtsames Nach-Innen-Schauen
Die folgende Übung wird Ihnen helfen, dessen gewahr zu sein, was Sie in jedem Moment erleben, und zu lernen, auftauchende Gedanken und Gefühle bewusst wahrzunehmen, zu unterscheiden und zu akzeptieren. Versuchen Sie ein paar Mal am Tag innezuhalten, um Ihr inneres Erleben wahrzunehmen und zu beobachten, wie sich dies auf Ihr Leben auswirkt.
Beginnen Sie, indem Sie Ihre Aufmerksamkeit auf den Atem lenken und bewusst die Empfindungen beim Ein- und Ausströmen des Atems wahrnehmen. Machen Sie das etwa 30 Sekunden lang. Lenken Sie Ihre Aufmerksamkeit nun auf die durch äußere Eindrücke hervorgerufenen körperlichen Empfindungen: Nehmen Sie die Geräusche und Bilder wahr, die Ihre Sinne aufnehmen. Nehmen Sie auch andere körperliche Empfindungen wahr, beispielsweise die Temperatur, den Druck an den Stellen, an denen Ihr Körper in Kontakt mit dem Boden, Ihrer Sitzgelegenheit und so weiter ist.
• Richten Sie Ihre Aufmerksamkeit jetzt auf Ihre inneren Körperempfindungen, den Herzschlag, die Atmung, Spannungen im Körper, Hunger oder ein Gefühl der Sättigung, Schmerzen oder Unwohlsein, innere Temperatur.
• Achten Sie auch auf Ihr mentales Erleben; nehmen Sie wahr, was Sie denken, beispielsweise: „Das ist sonderbar.“ „Was ist jetzt?“ „Ich glaube nicht, dass das funktioniert.“
• Nehmen Sie Ihre emotionalen Zustände wahr: Interesse? Irritation? Erwartung? Langeweile? Angst? Nehmen Sie wahr, wie der Inhalt Ihrer Gedanken Ihren Gefühlszustand beeinflussen kann.
• Machen Sie sich nun Ihre Motivation (was Sie tun wollen) und Ihre Vorstellungen (innere Bilder oder Fantasien) bewusst.
Werden Sie sich dieser Erfahrungen bewusst, nehmen Sie Ihre Gedanken, Gefühle, Motive und inneren Bilder als vorübergehende geistige Zustände zur Kenntnis und akzeptieren Sie sie als solche. Durch diesen Prozess der „Innenschau“ werden wir immer besser darin, diese mentalen, emotionalen und körperlichen Erfahrungen als das zu erkennen, was sie sind – temporäre Erfahrungen und Ereignisse –, anstatt sich von ihnen davontragen zu lassen. Wir werden auch lernen, wahrzunehmen, wie eine mentale Erfahrung zur nächsten führen kann, wie eine Reihe von Dominosteinen, die nacheinander umfallen.
10 Mitfühlendes Verstehen von Emotionen

Schauen Sie sich manchmal in der Welt um und fragen sich, warum wir Menschen solche verrückten, törichten Dinge tun? Vielleicht blicken Sie auch hin und wieder auf Ihr eigenes Leben zurück und erinnern sich an Entscheidungen, die Sie einst getroffen haben und bei denen Ihnen, wenn Sie heute daran denken, die Haare zu Berge stehen. So als könnten Sie fast nicht glauben, dass Sie es waren, der so gehandelt hat. Manchmal versuchen wir, uns diese Dinge zu erklären, indem wir sie mit bestimmten Etiketten versehen: „Er hat keinen Weitblick!“, „Ich habe keine Selbstkontrolle“, „Diese Leute sind Idioten!“ Um allerdings Mitgefühl entwickeln zu können, braucht es ein Klima des Nicht-Urteilens, der Akzeptanz und Freundlichkeit.
Zu verstehen, wie unsere Emotionen funktionieren, ist eine große Hilfe. Rufen Sie sich ein Gefühl ins Gedächtnis, das Sie kürzlich hatten – vielleicht ein herausforderndes wie Wut oder Angst. Wenn Sie genau hinschauen, werden Sie erkennen, dass dieses Gefühl auf vielfältige Weise auf Ihren Geist einwirken kann. Emotionen richten unseren Geist aus, indem sie viele Aspekte unserer inneren Erfahrung beeinflussen:
• Körpererfahrungen: Emotionen drücken sich in Empfindungen im Körper aus. Manche Gefühle bewirken körperliche Unruhe, während andere den Körper entspannen.
• Aufmerksamkeit: Emotionen bestimmen, wie eng oder weit unser Aufmerksamkeitsfeld ist und worauf wir unsere Aufmerksamkeit richten.
• Denken: Unsere Gefühle bestimmen, wie flexibel wir denken können und auch woran wir denken.
• Bildliche Vorstellungen: Emotionen sind oft mit inneren Bildern verbunden. Sie können wie kleine Filme sein, die wir in unserem Geist abspielen.
• Motivation: Emotionen bestimmen mit, was wir tun wollen und warum wir es tun wollen.
• Verhalten: Emotionen steuern unser Verhalten. Wir verhalten uns sehr unterschiedlich, je nachdem, welche Gefühle gerade im Vordergrund stehen.
Rufen Sie sich nun eine positive Emotion wie Zuneigung oder Freude ins Gedächtnis. Denken Sie darüber nach, wie diese Emotion die oben genannten Faktoren auf ganz unterschiedliche Weise beeinflusst.
Wenn wir all diese Aspekte betrachten, können wir erkennen, wie schwierig es sein kann, mit unseren Gefühlen umzugehen – insbesondere den „negativen“ –, und wie leicht wir uns darin verfangen können. Diese Faktoren können sich gegenseitig beeinflussen und zu einer Art emotionaler Trägheit führen, die unseren Geist so strukturiert, dass es schwierig sein kann, kurzfristig etwas zu verändern. Wenn wir beispielsweise Wut fühlen, spüren wir Stimulation und Anspannung im Körper und unsere Aufmerksamkeit wird fast völlig vom Objekt unserer Wut in Anspruch genommen. Wir neigen dann dazu, unseren eigenen Standpunkt als absolut richtig zu betrachten, zwanghaft an der Situation festzuhalten und sie im Geiste immer wieder durchzuspielen wie einen Film. Wir sind wahrscheinlich auf Angriff „gepolt“, kritisieren den anderen oder sagen etwas Hässliches hinter seinem Rücken. Da spielt sich nur wegen eines Gefühls eine ganz Menge ab. Wenn wir sehen, wie viele Reaktionen bereits durch ein Gefühl ausgelöst werden, wird uns vielleicht allmählich klar, wieso wir oft solche dummen, kontraproduktiven Dinge tun, wenn uns verschiedene Gefühle im Griff haben.
Hier ein Beispiel: Einer meiner (Russells) Klienten, Jim, beschloss mit dem Rauchen aufzuhören und kam ganz gut damit zurecht. Dem Verlangen zu widerstehen, eine Zigarette zu rauchen, verglich Jim mit dem Gefühl, dem Drang zu widerstehen, aus einer Emotion heraus zu handeln – nicht wirklich schmerzhaft, aber sehr unangenehm, wie ein intensives Jucken, bei dem man versucht, sich nicht zu kratzen. Einmal, so erinnerte er sich, war er im Pub gewesen und hatte ein Bier mit seinen Freunden getrunken, als einer von ihnen eine Packung Zigaretten aus der Tasche zog und sich eine anzündete. Das intensive Verlangen richtete Jims Geist schnell so aus, wie wir es beschrieben haben: Die Aufmerksamkeit war fokussiert, die Motivation zielgerichtet und die Herzfrequenz stieg an. Aber am stärksten war ihm in Erinnerung geblieben, wie sehr es sein Denken beeinflusst hatte: „Als mein Freund mir die Packung hinhielt, um mir eine anzubieten, sprangen mich folgende Gedanken förmlich an: ‚Ich habe das ganz prima gemacht – zwei Wochen ohne zu rauchen. Es ist ja nur eine Zigarette. Das wird nichts ausmachen. Ich kann einfach diese eine rauchen und dann sofort wieder aufhören.‘“ Damals fand Jim seine Argumentation ziemlich überzeugend und rauchte die Zigarette. Dann passierte etwas Faszinierendes: „Beim ersten Zug stand diese Argumentationskette plötzlich auf dem Kopf. Die Gedanken, die mir jetzt in den Sinn kamen, waren völlig entgegengesetzt: ‚Oh, jetzt habe ich es vermasselt! Ich hatte es so gut im Griff und jetzt habe ich es kaputtgemacht. Kann mir ebenso gut eine Packung kaufen!‘“ Wir sehen, wie stark dieses Gefühl – in diesem Fall das Verlangen – Jims Denken, und dadurch sein Handeln, beeinflusste.
Nun, da wir ein wenig darüber wissen, wie wir (und jeder andere Mensch) von unseren Gefühlen „entführt“ und dazu gebracht werden können, Dinge zu tun, die für niemanden gut sind, fragen wir uns: Was können wir dagegen tun? All dessen gewahr zu sein, was da abläuft, ist ein guter Anfang. Wenn wir achtsam und bewusst wahrnehmen, was in unserem Geist und Körper vor sich geht – was wir fühlen, denken, beabsichtigen und so weiter –, haben wir etwas Abstand, um unsere Absichten zu bewerten und zu überdenken, um die Situation zu beobachten, etwas zu unternehmen, um mit unseren Gefühlen fertig zu werden und um unsere weitere Vorgehensweise zu planen. „Meine Güte, ich arbeite wirklich hart daran, mich zu überzeugen, diese Zigarette zu rauchen. Will ich das wirklich oder hat das einfach nur mit dem Verlangen zu tun, dem zu widerstehen ich lernen muss, wenn ich tatsächlich aufhören will?“
Ein mitfühlendes Verstehen dieser inneren Prozesse, des Einflusses, den unsere Gefühle auf unser Denken haben, kann uns helfen, bewusst zu handeln. Und wenn wir dieses mitfühlende Verstehen noch erweitern wollen, müssen wir begreifen, dass es keinen Grund gibt, sich Vorwürfe wegen dieser Prozesse zu machen. Wir haben das nicht selbst gewählt. Es ist einfach die Art und Weise, wie unser Gehirn (auf der physischen Ebene) und unser Geist (auf der Ebene unseres Bewusstseins) funktionieren. Aber wenn wir uns dieser Dinge erst einmal bewusst sind, können wir Verantwortung für den Prozess übernehmen.
Hier kommt Mitgefühl ins Spiel. Denn nicht nur Emotionen wie Wut und süchtiges Verlangen können einen machtvollen Einfluss auf unseren Geist ausüben, auch Mitgefühl und Güte können das. Die gute Nachricht ist, dass Mitgefühl unseren Geist auf eine wirklich hilfreiche, konstruktive Weise beeinflusst, indem es unsere Aufmerksamkeit auf das Leiden richtet und darauf, wodurch es gelindert werden könnte. Indem wir die Qualität Mitgefühl in uns nähren, nutzen wir unsere Denkfähigkeit zu unserem Vorteil. Wir können uns vorstellen, dass wir auf andere Weisen handeln, um herauszufinden, was am besten helfen könnte. Wir können unsere Denkfähigkeit nutzen, um Fragen zu stellen: „Was könnte ihn dazu gebracht haben, so zu fühlen?“, „Was würde ihr helfen, sich sicher zu fühlen?“, „Was wäre in dieser Situation hilfreich?“ Wir können all diese inneren Fähigkeiten einsetzen, um einen mitfühlenden Bewusstseinszustand wachzurufen:
• Unsere Aufmerksamkeit auf Dinge richten, die hilfreich sind und die uns helfen, mitfühlender zu empfinden.
• Mit unserer Motivation arbeiten, uns dafür einsetzen, mitfühlender zu werden.
• Unsere Vorstellungskraft nutzen, um uns auszumalen, wie wir als zutiefst mitfühlende Wesen denken, fühlen und handeln würden und um mitfühlendes Handeln im Geiste zu üben.
• Unsere mentalen Fähigkeiten nutzen, um unsere Motivation zu stärken sowie Empathie und andere mitfühlende Qualitäten zu entwickeln.
• Uns in mitfühlendem Verhalten üben.
• Mit dem körperlichen Ausdruck unserer Gefühle arbeiten (beispielsweise mit der von Wut ausgelösten körperlichen Unruhe und Anspannung), das heißt den Körper zur Ruhe bringen, sodass wir aus dem Zustand der Gereiztheit herauskommen und in einen mehr mitfühlenden inneren Zustand gelangen können.
Durch mitfühlendes Verstehen dessen, wie sich unsere Gefühle in unserem Geist ausdrücken und ihn beeinflussen, bekommen wir eine Art Werkzeug für den Umgang mit unseren Gedanken an die Hand. Wir können uns zurücklehnen und zulassen, dass unsere Gefühle die Bühne beherrschen oder wir können uns dafür entscheiden, achtsam zu sein und uns auf eine Weise zu verhalten, die uns hilft, jene geistigen Qualitäten zu entwickeln, die wir haben möchten.
BETRACHTUNG
Wie Mitgefühl den Geist beeinflusst
Nehmen Sie sich einen Moment Zeit, um sich innerlich mit dem Empfinden von Mitgefühl zu verbinden. Atmen Sie ein wenig langsamer und versuchen Sie, sich eine Zeit ins Gedächtnis zu rufen, in der Sie vom Leiden – vielleicht vom Leiden einer geliebten Person – berührt wurden und helfen wollten. Lassen Sie sich noch einmal diesen inneren Wunsch spüren, der oder die andere möge frei vom Leiden sein. Was ging dabei in Ihrem Geist vor sich? Was haben Sie gefühlt? Was hat Ihre Aufmerksamkeit auf sich gezogen? Woran haben Sie gedacht und was haben Sie zu sich selbst gesagt? Was haben Sie sich vorgestellt? Welche körperlichen Empfindungen haben Sie wahrgenommen (Anspannung, Aktivierung etc.)? Zu welchem Handeln wurden Sie motiviert? Welche Schritte haben Sie unternommen? Nehmen Sie wahr, wie Mitgefühl Ihren Geist beeinflusst.
11 Optimismus – eine positive Kraft

Eine optimistische Einstellung ist nicht nur wesentlich für das Aufrechterhalten von Mitgefühl, sondern auch ganz allgemein für ein glückliches Leben. Und es gibt viele Gründe, optimistisch zu sein. Wenn wir Unangenehmes oder Leidvolles erleben, gibt es immer eine Ursache oder Bedingung, die diese Erfahrung hervorgebracht hat: Ein Mangel an Nahrung führt dazu, dass wir hungrig sind, Krankheit führt dazu, dass wir Schmerzen leiden und uns schlecht fühlen. Aber diese Ursachen und Bedingungen sind nicht permanent. Sie lassen nach oder verschwinden oft ganz, sodass unser Leiden ein Ende hat. Um beim Beispiel Krankheit zu bleiben: Es geht uns vielleicht extrem schlecht, weil wir eine bakterielle Lungenentzündung haben. Aber wenn Antibiotika die Ursache unserer Erkrankung – die Bakterien – zerstören, verschwindet auch unser Krankheitsgefühl. Selbst wenn die Beseitigung der unmittelbaren Ursache unseres Leidens nicht in unserer Macht steht – beispielsweise wenn ein geliebter Mensch gestorben ist –, wissen wir, dass der Schmerz im Laufe der Zeit nachlassen wird.
Vor einigen Jahren interviewte eine amerikanische Journalistin den Dalai Lama. Sie fragte: „Sie wirken so glücklich, aber Sie mussten vor vielen Jahren aus Ihrer Heimat fliehen und konnten bis heute nicht nach Tibet zurückkehren. Dort ereignete sich ein Völkermord und die Umwelt wurde in unglaublichem Ausmaß zerstört. Ihr Volk hat ungeheuer gelitten, sowohl die Menschen, die in Tibet blieben, als auch die, die Ihnen ins indische Exil gefolgt sind. Wieso sind Sie nicht wütend über die illegale Besetzung Ihres Landes durch die kommunistischen Chinesen?“
Der Dalai Lama schenkte ihr sein ansteckendes Lächeln und erwiderte: „Wenn ich wütend wäre, würde ich mich elend fühlen. Ich könnte nicht richtig schlafen oder essen und meine Gesundheit würde darunter leiden. Das würde niemandem helfen. Also schaue ich auf alles, was gut ist, erfreue mich daran und bleibe optimistisch.“
Die Antwort des Dalai Lama zeigt uns, dass es sogar unter schrecklichen Umständen möglich ist, optimistisch zu bleiben und sich zu freuen. Über die Segnungen des Mitgefühls für andere und für uns selbst nachzudenken, gibt uns Hoffnung und Zuversicht. Mit dieser positiven Haltung können wir geistige Muster transformieren und unsere guten Eigenschaften stärken, indem wir Mitgefühl entwickeln.
Echtes Mitgefühl bedeutet nicht, dass wir uns selbst ignorieren oder vernachlässigen. Es ist sogar sehr wichtig, dass wir Mitgefühl mit uns selbst haben: Wir sind Lebewesen, die wie alle anderen leidvolle Erfahrungen machen. Ist uns unser Wunsch, mitfühlend zu sein, bewusst, können wir auf uns selbst achten, unser eigenes Leiden anerkennen und damit umgehen. Das hat überhaupt nichts mit Selbstbezogenheit zu tun. Wenn wir selbstbezogen sind, interpretieren wir jede Situation von unserem begrenzten Standpunkt aus. Ich beziehe dann alles auf MICH, so als sei mein Glück wichtiger als das aller anderen und mein Leiden schlimmer als das aller anderen. Selbst unter katastrophalen Umständen ist es möglich, Optimismus und Lebensfreude zu bewahren, wenn man über die Segnungen des Mitgefühls für andere und sich selbst reflektiert.
Es stimmt auch nicht, dass wir leiden müssen, um echtes Mitgefühl für andere empfinden zu können. Manche Leute meinen, es sei egoistisch, auch nur das kleinste bisschen Freude zu empfinden: „Es gibt so viel Schmerz und Leid auf der Welt. Wenn ich mich davon nicht ständig niedergedrückt fühle, habe ich kein echtes Mitgefühl.“ Diese Denkweise ist jedoch falsch. Es ist nichts verkehrt daran, glücklich zu sein. Jeder von uns wünscht sich das! Es ist möglich, Freude zu empfinden, ohne egoistisch zu sein. Tatsächlich entfernt uns Mitgefühl von der Selbstbezogenheit, indem wir sowohl das Glück anderer als auch unser eigenes im Blick haben, und das vergrößert die Freude. Und diese Freude macht es uns wiederum leichter, Mitgefühl zu kultivieren.
BETRACHTUNG
Sich selbst mitfühlendes Verständnis entgegenbringen
Wie reagieren Sie, wenn Sie das Leid anderer sehen oder davon erfahren? Fühlen Sie sich schuldig, weil Sie glücklich sind, während andere leiden? Überlegen Sie, ob Sie dadurch mehr oder weniger hilfreich für andere sein können. Wenn wir von uns selbst verlangen, zu leiden, um mitfühlend sein zu können, wird uns unser Mitgefühl bald versiegen und damit ist niemandem geholfen. Schauen Sie, ob es Ihnen möglich ist, positive Gefühle zu haben – beispielsweise, sich darüber zu freuen, dass Sie in der Lage sind, sich berühren zu lassen und Empathie und Mitgefühl zu empfinden –, wenn Sie mit einer Situation konfrontiert werden, in der jemand wirklich leidet. Es kann inspirierend sein, zu erleben, dass an die Stelle unserer Schuldgefühle ein Gefühl der Fürsorge für andere tritt.
12 Drei Arten von Emotionen

Wenn wir daran arbeiten, Mitgefühl zu entwickeln, müssen wir unsere Bemühungen auf zwei Aspekte konzentrieren. Erstens ist es wichtig, eine mitfühlende Haltung zu entwickeln, indem wir unsere Motivation stärken und unsere Fähigkeit trainieren, mitfühlend zu empfinden, zu denken und zu handeln. Und zweitens müssen wir lernen, die Hindernisse auszuräumen, die uns daran hindern, Mitgefühl zu empfinden, und die uns davon abhalten können, aus unserer besten Absicht heraus zu handeln.
Wir haben bereits darüber gesprochen, wie stark unsere Emotionen unseren Geist beeinflussen und ausrichten. Das ist kein Zufall. Aus der Perspektive der Evolutionspsychologie betrachtet, haben wir all diese Gefühle, weil sie unseren Vorfahren halfen, zu überleben und ihre Gene an uns weiterzugeben.1 Von diesem Standpunkt aus gesehen, fallen menschliche Emotionen unter drei Kategorien: diejenigen, die sich entwickelten, um uns zu helfen, wahrgenommene Bedrohungen einzuordnen und darauf zu antworten, die, die uns helfen sollen, Ziele zu verfolgen und Dinge zu erwerben, welche wir für unser Überleben und die Reproduktion benötigen, und die, die entstanden sind, damit wir uns sicher fühlen, zufrieden sein und uns mit anderen verbinden können. Wir bezeichnen diese drei emotionalen Kategorien als das „Bedrohungssystem“, das „Antriebssystem“ und das „Beruhigungssystem“. Das Problem beginnt, wenn diese emotionalen Systeme aus dem Gleichgewicht geraten. Das kann zum Beispiel passieren, wenn unser Geist sich wie besessen auf reale oder eingebildete Bedrohungen fokussiert, oder auf die Dinge, die wir unbedingt haben wollen, und wir blind für die Bedürfnisse anderer (und manchmal auch unsere eigenen) werden. Das ist eines der größten Hindernisse für Mitgefühl. Das Bedrohungs- und das Antriebssystem sind sehr machtvoll, und wenn sie die Bühne beherrschen, kann die innere Stimme unserer besseren Natur von Gefühlen der Wut, Feindseligkeit und Angst, von materialistischen Wünschen, Verlangen oder kaltem, egoistischem Streben überlagert werden.
Obwohl all diese Reaktionen letztendlich dem Wunsch entspringen, glücklich zu sein und Leiden zu vermeiden, können sie Probleme verursachen. Es zeigen sich nicht die besten Seiten unseres Wesens, wenn wir uns in den Reaktionen des Bedrohungs- und Antriebssystems verfangen. Vielleicht sind wir sehr gut darin, diese Reaktionen bei anderen aufzuspüren – sind verärgert, wenn Leute sich auf eine Weise verhalten, die uns feindselig, schwammig oder habgierig vorkommt –, und kaum in der Lage, Wärme und Mitgefühl für sie zu empfinden. Und kurz darauf bemerken wir vielleicht, dass wir uns auch selbst dafür kritisieren, dass wir ähnlich fühlen oder handeln! Man kann leicht in so ein Muster hineingeraten, und es ist ebenso leicht, andere oder auch sich selbst dafür zu verurteilen, anzuklagen oder zu beschämen: „Er ist einfach ein Idiot!“ „Ich bin ein schwacher Mensch.“ Wir mögen überzeugt sein, dass diese Urteile gerechtfertigt sind; sie scheinen sehr gut zu passen. Aber wenn wir genauer hinschauen, können wir erkennen, dass diese harten Urteile ein weiteres Beispiel dafür sind, wie das Bedrohungssystem die Kontrolle über unseren Geist übernimmt und andere (oder uns selbst) angreift, wenn sie (oder wir) nicht so handeln, wie sie oder wir es unserer Meinung nach tun sollten. Es ist verständlich, aber es ist nicht hilfreich.
Meine (Russells) Antwort auf die Frage: „Was ist Mitgefühl?“, beinhaltet also die Erkenntnis, dass ein großer Teil unseres Leidens mit machtvollen, intensiven Gefühlen zu tun hat, die ohne unser bewusstes Gewahrsein in uns hochkommen können – Gefühle, die wir unbeabsichtigt mit unserem Denken und Handeln befeuern, was die Dinge letztendlich schlimmer statt besser macht. Anstatt sich selbst und andere dafür zu kritisieren, dass man diese Gefühle hat und ausdrückt, bedeutet Mitgefühl, zu akzeptieren, dass wir alle solche Gefühle hin und wieder haben, und bereit zu sein, sich mit ihnen auseinanderzusetzen, wenn sie hochkommen. Mitgefühl heißt, etwas zu verstehen versuchen, anstatt zu urteilen. Es bedeutet, zu fragen: „Was könnte hilfreich bei meiner Auseinandersetzung mit diesen Gefühlen sein?“ Und dazu gehört auch, zu erkennen, dass es unsinnig ist, sich vorzuwerfen, dass man diese normalen menschlichen Gefühle hat, aber gleichzeitig zu sehen, dass man, will man das Leben führen, das man sich wünscht, die Zügel in die Hand nehmen und den eigenen Geist dahin lenken muss, wo man ihn haben möchte.
Dieses Gewahrsein kann transformierend sein. Wir verstehen das herausfordernde Verhalten von anderen (und unser eigenes) dann nicht so, dass etwas mit ihnen (oder mir) nicht stimmt, sondern als das Resultat emotionaler Reaktionen, die aus dem Gleichgewicht geraten sind. Indem wir verstehen, dass Gefühle wie Wut und Angst entstehen, wenn wir uns bedroht fühlen (ganz gleich, ob die Bedrohung real ist oder etwas, das wir uns zusammengereimt haben), können wir Mitgefühl für diejenigen empfinden, die in diesen Gefühlen gefangen sind. Wenn wir erleben, dass sich jemand feindselig verhält, können wir, anstatt zu sagen „Was für ein Idiot!“, vom Urteilen auf das Verständnis umschalten, das mit Mitgefühl verbunden ist: „Er ist gerade im Bedrohungssystem. Ich weiß, wie sich das anfühlt! Was könnte ich tun, um ihm zu helfen, sich sicher oder zumindest nicht noch stärker bedroht zu fühlen?“ Indem wir mitfühlend zu verstehen versuchen, anstatt zu urteilen und Etiketten zu kleben, finden wir oft Lösungen für Probleme, die zuvor unlösbar erschienen. Wir fangen an, Menschen eher als grundsätzlich wertvolle Wesen zu sehen, die mit Schwierigkeiten kämpfen, denn als Idioten, die uns Probleme bereiten. Das können wir auch für uns selbst tun. Wir können aufhören uns vorzuwerfen, dass wir normale menschliche Gefühle haben, vor allem, wenn wir uns vorgenommen haben, auf eine konstruktivere Art und Weise mit diesen Emotionen zu arbeiten. Wenn wir anfangen, auf die kritischen Urteile zu verzichten, die das Gefühl der Bedrohung bei uns und anderen aufrechterhalten, bekommen wir immer leichter Zugang zum Mitgefühl.