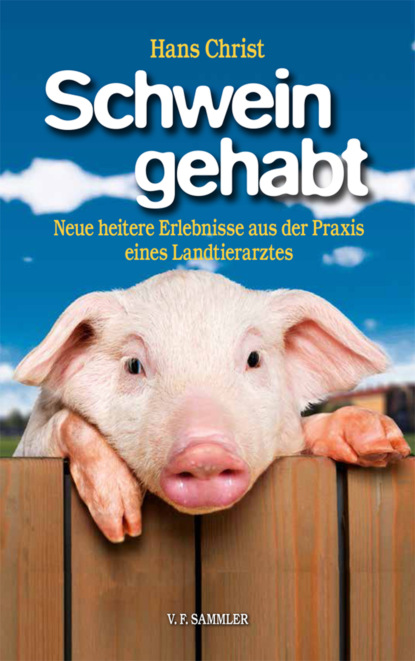- -
- 100%
- +
„Seit wann hat er denn das?“
„Seit gestern. Der Kerl hat sich vorgestern von der Anbindung losgerissen und über einen Sack Hendlfutter hergemacht.“
„Dann ist alles klar! Es handelt sich um schwere Pansenacidose!“
„Was ist eine Pansendose?“, fragte der Hintersteiner, für den Fremdwörter reine Fremdwörter waren.
„Eine Übersäuerung des Magens! So eine Art Sodbrennen!“
Der Hintersteiner nickte: „Sodbrennen habe ich öfter. Das ist zwar unangenehm, aber doch nicht so schlimm?“
„Bei Wiederkäuern liegt die Sache ein bisschen anders. Die übermäßigen Kohlenhydrate, wie sie im Hühnerfutter mit seinem hohen Mais- und Getreideanteil vorkommen, fangen zu gären an und senken den pH-Wert im Pansen. Dadurch wird auch das Blut sauer und schädigt die Organe. Warum haben Sie nicht schon gestern angerufen? Dann wäre noch genug Zeit gewesen, die Übersäuerung einzudämmen.“
„Weil er zuerst nicht so schlecht beieinander war. Zur Jaus’n (regionale Bezeichnung für alles Mögliche zur späteren Nachmittagszeit, zum Beispiel Besamungen, Heimkehr des Bauern von der Arbeit, Fütterung usw.) hat er nichts mehr gefressen, aber da habe ich mir gedacht, wenn ich drei Mal zu Mittag esse, habe ich am Abend auch keinen rechten Hunger mehr.“
Oh heilige Einfalt! Dass manche Bauern noch immer von sich auf ihre Tiere schließen!
„Wird er sterben?“
„Das kann ich Ihnen noch nicht beantworten. Jedenfalls ist der Zustand ernst. Manchmal löst sich sogar die gesamte Pansenschleimhaut ab und dann ist finito.“
„Der arme Poldi. Mein bester Jungstier! Hätte mein nächster Zuchtstier werden sollen!“
„Na, noch ist Hopfen und Malz nicht gänzlich verloren“, bemühte ich eine alte Bierbrauerweisheit. „Einen Versuch ist es immer noch wert!“
Ich kniete mich neben Poldi auf die Gummimatte und legte ihm die Staukette um die Halsvene. Dazu mussten wir ihn gar nicht groß fixieren, er ließ es einfach apathisch über sich ergehen. Der Hintersteiner hatte am Telefon Recht gehabt. Es ging dem Stier nicht gut. Nach der Traubenzuckerinfusion, die reichlich Bicarbonat enthielt, um den pH-Wert des Körpers wieder zu stabilisieren, drückte ich dem Bauern zwei Päckchen Pulver, die das Gleiche im Pansen bewirken würden, zum Eingeben in die Hand und versorgte ihn noch nebenbei mit einem guten Rat: „Lassen Sie nie offen Futter im selben Raum stehen, wo sich die Tiere befinden. Morgen schaue ich nochmals nach Poldi!“
Als ich heimkam, war die Garage leer, Karin in der Schule und die indische Reispfanne sehr exotisch, weil mittlerweile ziemlich trocken.
Obwohl ich noch andere dringende Visiten hatte, drängte es mich am nächsten Tag zuallererst auf den Hintersteinerhof.
Zu meiner großen Erleichterung empfing mich der Bauer mit einem Gesichtsausdruck, der zur Hoffnung Anlass bot. Und tatsächlich, dem Stier ging es eindeutig besser. Der Kot roch zwar noch immer etwas säuerlich, hatte aber schon eine breiige Konsistenz angenommen, die Körpertemperatur war auch schon gestiegen und, das Beste, Poldis Augen lagen nicht mehr tief und trüb in den Höhlen, sondern besaßen wieder Glanz.
Er zeigte sich gegenüber gestern auch schon wesentlich lebhafter, sprich wehrhafter, als ich die Behandlung vom Vortag wiederholte.
„So, ein paar Tage lang gutes Heu, dann ist er wieder der Alte!“, beschloss ich meine Visite.
Ich sollte Recht behalten. Poldi entwickelte sich in der Folge zum prächtigen Zuchtstier und bescherte dem Hintersteiner eine Menge hübscher Kälber.
Eines Tages musste ich aber doch wegen einer künstlichen Besamung auf den Hof, weil es sich bei der Kuh diesmal um Poldis Mutter handelte – und mit Inzucht machst Du Dir beim Zuchtverband keine Freunde.
Der Hintersteiner hatte mittlerweile den Stall erweitert und einen Laufstall daraus gemacht.
„Ich werde nicht da sein“, hatte er am Telefon gemeint, „weil ich einen Termin auf der Bauernkammer habe. Förderungsansuchen, Sie wissen schon. Aber ich habe Ihnen alles aufgeschrieben, die Kuh ist markiert und im Fressgitter eingesperrt.“
Was er nicht gesagt hatte und ich bei meinem Eintreffen feststellen musste, war, dass das Türchen, durch welches man die Kuhabteilung betrat, dermaßen verbogen war, dass es sich nicht öffnen ließ. Zumindest nicht mit einer Hand, in der anderen hatte ich ja die Besamungspistole samt Samenröhrchen, Plastikhülle und Schere. Also blieb nur der Weg durch die Laufbox von Poldi, was mich jetzt nicht sonderlich störte, denn der Stier steckte offensichtlich ebenfalls mit dem Kopf im Fressgitter. Aber man soll nichts auf den Augenschein geben.
Sobald ich zwei Schritte in sein Arreal getan hatte, grummelte er und zerrte den Schädel heftig aus der Absperrung. Wahrscheinlich war die Arretierung wegen seines dicken Halses nicht vollständig eingerastet gewesen. Er drehte sich in meine Richtung und musterte mich aus nachdenklichen Augen, wobei seine Gedanken, soweit ich sie lesen konnte, nicht unbedingt freundlich waren.
„Hallo Poldi. Du hast Dich ja bestens herausgemausert, alter Bursche“, versuchte ich, ein bisschen Spannung aus der Atmosphäre zu nehmen, aber Poldi hatte offenbar keinen Bock auf Komplimente. Endlich schien er zu einem Entschluss gekommen zu sein, denn er senkte den Kopf und begann, mit dem Vorderfuß zu scharren. Das war kein gutes Zeichen! Was sollte ich tun? Mich an ihm vorbei zu den Kühen hinüberzuretten, ging nicht, weil er mir den Weg versperrte. Also blieb nur die Richtung, aus der ich gekommen war. Der Rückzug erinnerte ein bisschen an den der Napoleonischen Armee aus Russland, nur ging er bei mir wesentlich schneller.
Allerdings nicht schnell genug. Bevor ich die Box wieder schließen konnte, immerhin hatte ich ja noch immer das vermaledeite Besamungszeug in der Hand, war Poldi bereits zur Stelle. Ein wuchtiger Kopfstoß riss mir die Türe aus der Hand und der Stier war bereits halb auf dem Gang, den ich nun nach Leibeskräften entlangrannte.
An sich ist es ja ein Blödsinn, einem Stier durch Laufen entkommen zu wollen, nicht einmal mit den besten Sportschuhen von Olympiasprintern und schon gar nicht in Gummistiefeln. Aber vielleicht, und vor allem hoffentlich, gelang es mir, vor ihm den schmalen Stiegenaufgang zum Heuboden hinauf zu erwischen. Dorthin konnte er mir nicht folgen, dazu war er zu dick.
Aber soweit musste ich gar nicht kommen, weil Poldi plötzlich abbremste. Er hatte den Sack mit Hühnerfutter, der schon wieder an der Stallwand lehnte, erspäht oder gewittert, jedenfalls brach er die Verfolgung ab, weil irgendetwas in seiner Erinnerung ihm sagte, dass das damals ganz prima geschmeckt hatte. Er tauchte seine Nase in die Mais-Getreidemischung und begann genüsslich, sich das unerwartete Angebot einzuverleiben.
Himmelarschundzwirn! Ich stand dieser Völlerei vollkommen hilflos gegenüber und musste zusehen, wie sich das Vieh die nächste Pansenacidose anfraß. Oder hat schon wer einmal versucht, einen ohnehin nicht leutselig aufgelegten Stier von der Futterquelle zu vertreiben? Mundraub gilt auch im Tierreich als Verbrechen und Poldi war ganz und gar in der Stimmung, dafür die Todesstrafe zu verhängen.
Das Einzige, das mir übrigblieb, war, dem Hintersteiner erneut zwei Päckchen mit dem Acidosepulver in einem zusammengebundenen Rektalhandschuh außen an die Stalltüre zu hängen mit dem Vermerk: „Sobald wie möglich eingeben, sonst ist morgen der Stier schwer krank.“
Am nächsten Tag rief der Hintersteiner an, ich möchte doch bitte nach Poldi sehen, er frisst nichts.

Wie ich erwartet hatte, war das Rindvieh, im wahrsten Sinne des Wortes, von einer Pansenacidose verschont geblieben, hatte aber natürlich trotzdem eine veritable Verdauungsstörung. Aber diesmal war die Geschichte nicht dramatisch. Ich gab ihm eine Spritze, verordnete ein Mittel zur Magenstimulanz und eine Drei-Tages-Heudiät.
Aus Ärger, dass der Hintersteiner meine Warnung, Futter im Stall aufzubewahren, in den Wind geschlagen hatte, hielt ich den Mund und verzichtete auf eine Aufklärung. Das sollte sich auszahlen, ganz nach dem Sprichwort: Reden ist Silber, Schweigen ist Gold!
Weil mir der Wagnerbauer in der darauffolgenden Woche breitgrinsend mitteilte: „Na, mit dem Hintersteiner haben Sie sich ja einen Fan aufgerissen!“
„Wieso?“
Der Wagner lachte: „Der Mensch hat am Sonntag im Wirtshaus jedem, den er erwischt hat, vorgeschwärmt: ‚So einen Tierarzt muss man einmal finden! Weiß schon im Voraus, dass der Stier am nächsten Tag was hat!‘“
Liebe geht unter die Haut
Haus und Stallgebäude vom Strampflgut hätten für jeden Historienfilm eine authentische Kulisse abgegeben. Das Haus stammte aus dem frühen siebzehnten Jahrhundert, wenn man der in den Türbalken eingeschnitzten Jahreszahl trauen durfte. Der Stall war zwar zwischenzeitlich einmal abgebrannt, hatte aber auch schon mehr als zweihundert Jahre auf dem Buckel, will sagen, den Dachschindeln.
Und der Strampflbauer selbst, der Letzte seiner Sippschaft, weil unbeweibt und daher auch kinderlos, zumindest wusste er von keiner Vaterschaft, passte haargenau in diese Idylle, um den hätte sich ebenfalls jeder Regisseur für eine Komparsenrolle gerissen. Weil original!
Sein Alter ließ sich nicht einschätzen, und als ich ihn einmal danach fragte, erklärte er, er wüsste es selbst nicht genau. So achtzig oder mehr, um Formalitäten hätte er sich zeitlebens nie gekümmert.
Er war ein dürrer Mann von mittlerer Größe, kein Gramm Fett auf den Rippen und unter der scharfen Hakennase wucherte ein grauer Vollbart, mit dem man eine Seegrasmatratze neu hätte stopfen können.
Sommers wie winters trug er eine ausgeschossene Lodenweste und eine Lederhose, deren ursprüngliche Farbe nicht mehr zu erkennen war, die jedoch infolge der beständigen Stallarbeit von selbst starr in der Ecke stehen würde, täte sie der Strampfl in der Nacht ausziehen, woran ich beträchtliche Zweifel hegte.
Graue Kniestrümpfe und ein speckiger Filzhut mit einem räudigen Gamsbart vervollständigten sein tägliches Erscheinungsbild. Als unerlässliches Attribut hielt er eine Gesteckpfeife aus Holz zwischen den gelben Zähnen, was seiner Redeweise einiges an Verständlichkeit raubte.
Ein Tierarzt, der lauter solche Kunden hätte, würde binnen Kürze genauso daherkommen, weil eine Visite am Strampflgut ein Ereignis war, das vielleicht nur alle Schaltjahre einmal passierte.
Diesmal aber musste es sein.
„Servus Doktor“, nuschelte der Strampfl und kratzte sich zur Begrüßung ungeniert am Hosenboden.
„Was gibt es für ein Problem“, fragte ich und war heilfroh, dass er mir nicht die Hand gegeben hatte, weil ich auf den ersten Blick den hässlichen Ausschlag an seinen Händen und teilweise Unterarmen erkennen konnte.
„Ein Kalb! Gestern auf die Welt gekommen. Trinkt nicht!“ Mit den Worten ging er ebenso sparsam um, wie mit allen anderen Dingen, vor allem der Hygiene.
„Schlecht“, antwortete ich. Wenn er mundfaul war, stand mir auch nicht der Sinn nach Volksreden.
Das Kalb lag in seinem Kobel und atmete schwer. Obwohl ich vermutete, was die Ursache war, steckte ich ihm der Vollständigkeit halber das Thermometer in den Hintern. Genau wie ich dachte, normale Temperatur.
„Lungenentzündung?“, blies der Strampfl in einer Rauchwolke heraus.
„Weißfleischigkeit!“
„Sie können sein Fleisch doch gar nicht sehen?“ Offenbar fand er, ein wenig Skepsis konnte nicht schaden.
Jetzt musste ich doch etwas weiter ausholen: „Das ist auch nicht nötig. Weißfleischigkeit nennt man einen Selen- und Vitamin-E-Mangel. Die Muskeln können nicht richtig funktionieren. Die Zwerchfellmuskulatur ebenso wenig wie die Schlundmuskulatur. Kann es aufstehen?“
„Mit Mühe. Und nicht lange.“
„Na, da haben wir es ja. Aber keine Sorge, eine Spritze und in vierundzwanzig bis achtundvierzig Stunden ist alles in Ordnung.“
Während ich zum Wagen marschierte, um das Medikament zu holen, musterte ich im Vorübergehen die kleine Kuhherde.
Nachdem ich dem Kalb die Injektion verpasst hatte, fragte der Strampfl. „Was kostet das?“
Ich nannte ihm den Preis, worauf er nuschelte: „Auch schon einmal billiger gewesen“, worauf ich lachte: „Ja, vor acht Jahren, als ich das letzte Mal hier war. Damals war alles billiger!“
Der Strampfl förderte aus der Brusttasche einige zerknüllte Geldscheine zutage und wollte sie mir geben.
Angesichts seines Hautzustandes machte ich jedoch keinen Gebrauch davon und sagte: „Ich schicke Ihnen in den nächsten Tagen einen Erlagschein!“
„Wie Sie wollen“, zuckte er die Schultern und ließ den Mammon wieder verschwinden.
„Was tun Sie eigentlich gegen Ihren Ausschlag?“, wollte ich wissen.
„Schnaps und Lärchpech!“, nuschelte er und ließ mich im Ungewissen, was er davon innerlich anwendete.
„Nicht gut“, sagte ich.
„Wissen Sie denn, was das ist?“
„Ich habe mir vorher Ihre Kühe angeschaut. Die mittlere hat Euterpocken, an der haben Sie sich angesteckt.“
„Ich hab’ die Pocken?“, fragte er entgeistert und schaute entsetzt auf die kreisrunden Geschwüre.
„Nur die Kuhpocken“, beruhigte ich ihn.
Kuhpocken oder falsche Pocken, auch Pseudopocken genannt, werden durch ein Paraboxvirus verursacht, welches jedoch, im Gegensatz zu den oft tödlich verlaufenden echten Pocken, unangenehme, aber harmlose Hautveränderungen hervorruft, die binnen sechs bis acht Wochen ohne Narbenbildung wieder abheilen. Sie kommen vor allem auf den Zitzen von Kühen, Schafen sowie Ziegen vor und werden durch Kontakt auch auf den Menschen übertragen.
Der englische Arzt Edward Jenner hatte beobachtet, dass jemand, der die Kuhpocken bereits gehabt hatte, nicht mehr an den echten Pocken erkranken konnte. Es musste sich um eine Verwandtschaft handeln. Von Erregern wusste man damals noch nichts, aber so kam er auf die Idee, mit der harmlosen Variante eine künstliche Infektion als Schutz gegen die bösartige Form zu erzielen.
Die Impfung war geboren. Und da das Serum aus der Lymphe kranker Kühe stammte und die Kuh auf Latein, der damaligen Gelehrtensprache, vacca heißt, spricht man bis heute bei allen möglichen Impfungen von Vaccinationen. 1796 wandte Jenner zum ersten Mal diese neue Methode bei einem Knaben an.
Selbst im alten Studentenlied „Ich bin der Doktor Eisenbarth“ findet die Vaccination gegen Kuhpocken ihren Niederschlag:
Zu Ulm kurierte ich einen Mann,
wiwide witt, bumm bumm,
dass ihm das Blut vom Beine rann,
widewide witt, bumm bumm.
Er wollte gern gekuhpockt sein,
widewide witt juchheiraßa,
ich impft’ ’s ihm mit dem Bratspieß ein,
widewidewitt, bumm bumm!
Wegen der Ansteckung durch Melken nannte man die Hautveränderungen Melkerknoten. Heutzutage sind diese fast vollständig von der Bildfläche verschwunden, weil das Handmelken ebenfalls der Vergangenheit angehört.
Der Strampfl, natürlich, bildete eine Ausnahme. Er tat sich mit seinen drei Kühen dabei aber auch leicht. Vor zwanzig Jahren hatte ihm ein Nachbar eine alte mobile Melkmaschine geschenkt, weil er selbst auf eine damals moderne Rohrmelkanlage umgesattelt hatte. Das Trumm sah aus wie ein umgebauter Rasenmäher und machte auch so einen Krawall.
Ich bin mir sicher, der Strampfl hatte das Präsent kein einziges Mal benutzt. Er hatte es lieber, während des Melkens dem Fressen seiner Kühe, die sich an duftendem Heu gütlich taten, und dem Vogelgezwitscher im Apfelbaum vor dem Stallfenster zuzuhören.
Nachdem ich ihn aufgeklärt hatte, meinte er: „Und, haben Sie was dagegen?“
„Gegen das Virus gibt es nichts. Damit muss das Immunsystem selbst fertig werden. Aber ich habe was, mit dem die Heilung schneller geht.“
Ich übergab ihm mit spitzen Fingern eine Dose Zinkspray und eine Tube Propolis-Salbe.
„Zuerst einsprühen, damit die nässenden Stellen austrocknen, und nachher die Salbe auftragen.“
„Tausend Dank, Doktor“, sagte der Strampfl und eh ich mich versah, drückte er mir doch die Hand. „Aber kommen Sie erst in acht Jahren wieder!“
„Gern, dann wird es aber wieder teurer“, lautete meine trockene Antwort auf seine freundliche Einladung.
Ehe ich in das Auto stieg, rubbelte ich mir die Hände mit reichlich Desinfektionsmittel ab. Ich wusste, was ich tat. Weil, wenn jemand bezweifeln sollte, dass Kuhpocken nicht von Mensch zu Mensch übertragbar waren, ich den schlagenden Gegenbeweis hatte.
Der begann am Lahnerhof.
Zuvor hatte ich im Zuge einer spätabendlichen Visite in der Dämmerung abseits auf einem selten befahrenen Waldweg das Auto vom jungen Lahnerbauern registriert. Jeder im Ort wusste, dass der Lahner junior, trotz seines noch jungfräulichen Führerscheins, ein rasanter Fahrer war, der seinen tiefergelegten Golf in der kurzen Zeit schon mehrmals an ein Hindernis gelehnt hatte, das stabiler war als das Karosserieblech. Weil aber das Geld für die Reparaturen fehlte, ähnelte der Silbermetallic-Wagen mittlerweile einer zerknitterten Alu-Folie. Jetzt parkte der ramponierte Bolide an einer an sich sehr abgelegenen Stelle, aber den Tierarzt auf seinen Schleichwegen hatte das Pärchen nicht auf der Rechnung.
Gleichzeitig erkannte ich nämlich die Umrisse zweier Personen, die sich gemeinsam auf dem Fahrersitz befanden. Etwas unbequem, wie ich fand, aber für bestimmte Vorhaben unerlässlich und die tierärztliche Schweigepflicht galt für mich auch in Bezug auf zwischenmenschliche Beziehungen. Ich konnte nur hoffen, dass der Lahner dort nicht wieder einen unvorhersehbaren Unfall baute, diesmal mehr biologischer Natur.
Als ich nun auf dem Kohlhauserhof eine zahnende Kalbin von ihrem störenden Backenzahn befreit hatte, musste mir die siebzehnjährige Tochter des Hauses, die Hanni, assistieren.
Der Kohlhauser hatte sich nämlich bei der Holzarbeit eine Quetschung an beiden Vorderpfoten zugezogen und trug für einige Wochen Gips.
Die Handleiden schienen zur Zeit dort Einzug gehalten zu haben, weil auch die Hanni, ein hübsches brünettes Mädel, Handschuhe anhatte.
„Nanu“, flachste ich, „schon die Ballhandschuhe für das Jägerkränzchen übergestreift?“
„Nein“, sagte sie und wurde verlegen, „ich habe so einen scheußlichen Ausschlag bekommen.“ Sie zog die Handschuhe aus und präsentierte mir das typische Erscheinungsbild von Kuhpocken.
Das allerdings verwunderte mich ein wenig, war doch der Kohlhauser einer der ersten im Tal gewesen, der sich einen automatischen und computergesteuerten Melkstand zugelegt hatte.
„Wir haben eine Kuh, die so grausliche Pletzen (regionaler Ausdruck für fleckenhafte Hautveränderungen) auf den Tutten (regionaler Ausdruck, aber ohne Bedarf der näheren Erklärung) hat. Weil ich meine Pratzen nicht gebrauchen kann, habe ich Hanni angewiesen, die Zitzen zwei Mal täglich mit einer Heilsalbe einzuschmieren. Dabei muss sie sich infiziert haben. Es schaut aber so aus, als wenn der Schmarrn einfach nicht weggeht.“
Eine weitere Dose Zinkspray wechselte den Besitzer.
Erst auf dem Lahnerhof wurden mir die Zusammenhänge klar. Ich sollte dort im Auftrag der Amtstierärztin eine Blutprobe von einer Kalbin, die vor wenigen Tagen verworfen hatte, ziehen. Weil das Mistvieh gerne ausschlug, wählte ich statt der Schwanzvenenmethode lieber die traditionelle Variante aus der Halsvene. Dazu musste das Tier gut im Schwitzkasten gehalten werden und diese Aufgabe übernahm der muskulöse Jungbauer. Auf seinen sehnigen Armen und Händen befanden sich die eindeutigen Anzeichen von Melkerknoten.
„Jö, schau, Sie haben ja die Kuhpocken!“, rief ich aus.
„Unsere Kühe haben keine Kuhpocken“, erwiderte der alte Lahner scharf, während der junge nur verlegen grinste.
Ich zwinkerte ihm verschwörerisch zu.
Als ich nach Hause kam, gab ich Karin einen herzlichen Kuss, wie es vielleicht auch Sherlock Holmes bei Doktor Watson getan hätte, wenn ihm die Lösung des Rätsels gelungen wäre. Anschließend stürmte ich hinauf in mein Büro im zweiten Stock und vertiefte ich mich in mein altes Lehrbuch über Infektionskrankheiten bei Wiederkäuern. Dort stand im betreffenden Kapitel: Pseudopocken werden durch den Kontakt mit erkrankten Tieren übertragen, besonders betroffen sind Landwirte, Almhirten und Tierärzte.
Von Verliebten wusste der Verfasser offenbar nichts.
Auch Du, mein Sohn Brutus
Am frühen Morgen, ich hatte mir nach einer Nachtschicht bei einem Kolikpferd noch eine verlängerte Mütze Schlaf gegönnt, überraschte mich Karin, die schon aufgestanden war, um sich für die Schule fertig zu machen, mit der Nachricht: „Eine alte Freundin von Dir hat angerufen!“
„So?“, gähnte ich, „ich war der Meinung, nur junge Freundinnen zu haben.“
„Und ich habe gehofft, Du hättest gar keine!“
„Also, los, spuck’s schon aus. Wer war es?“ Es heißt zwar, Morgenstund hat Gold im Mund, aber Geplänkel zählt nicht zu den Edelmetallen.
„Die Gräfin Waldenfels!“
Das war tatsächlich eine Überraschung! Ich hatte schon eine Ewigkeit nichts mehr vom Waldenfelsgut gehört. Man wird sich vielleicht an mein erstes Buch erinnern, in dem die Geschichte mit Farah, der inkontinenten Rottweilerhündin, die noch dazu ein leicht giftiges Wesen besaß und die ich mit homöopathischen Tropfen von beiden Übeln befreien konnte. Und da das eine Medikament so eine günstige Wirkung auf ihr Verhalten ausgeübt hatte, hatte die Gräfin, die manchmal unter dem herrischen Charakter des nicht nur blau- sondern auch heißblütigen Göttergatten litt, jenem die Tropfen in den Kaffee geschmuggelt. Und siehe da, auch in diesem Fall bewirkte die vielgeschmähte Homöopathie eine deutliche Besserung der Situation.
Die Waldenfels stammten ursprünglich aus Ostpreußen. Nach der Flucht im Zweiten Weltkrieg erwarb der Graf hier den heruntergekommenen Gutshof, setzte ihn instand und begann, nach alter Familientradition, eine Trakehnerzucht erster Güte. Ich hatte mit den Pferden kaum etwas zu tun, dafür holte er einen Fachtierarzt aus dem Bayerischen Grenzgebiet. Als der eines Tages wegen einer Dopingaffäre auf der Rennbahn verhaftet wurde, hoffte ich, in die Bresche springen zu dürfen, aber Waldenfels setzte offenbar kein allzu großes Vertrauen in meine hippologischen Fähigkeiten, weil er kurz danach einen anderen Spezialisten fand.
Ich war daher einigermaßen gespannt, was die Gräfin von mir wollte. Um Farah und ihren Mann konnte es sich diesmal nicht handeln, die Hündin hatte schon längst das Zeitliche gesegnet und auch der Graf war vor etwas mehr als zwei Jahren gestorben. Die Pferde hatte man nach seinem Tod verkauft.
Als ich nun durch das imposante Tor mit den zwei Pferdeköpfen aus Untersberger Marmor einfuhr, herrschte am Hof nicht die übliche Betriebsamkeit, die ich von früher kannte. Auch das Dienstmädchen, welches mir auf mein Läuten öffnete, war ein anderes als bei meinem letzten Besuch.
„Die Frau Gräfin erwartet Sie!“ Sie führte mich nach links in den Salon.
Als ich die Gräfin auf dem Sofa sitzend sah, war ich innerlich erschüttert. Kein Zweifel, sie war alt geworden. Aber vermutlich dachte sie das auch von mir. Ihre feinen Gesichtszüge, die mich immer ein bisschen an Catherine Deneuve erinnert hatten, waren schärfer geworden und unzählige Fältchen hatten sich um Augen und Mund gegraben. Meinem tierärztlich geschulten Blick, beim Betreten eines Stalles auch auf Dinge ringsumher zu achten, entgingen auch nicht die leicht deformierten Finger. Offenbar litt sie an Gicht.
„Fein, dass Sie Zeit gefunden haben, Herr Doktor!“ Sie bedeutete mir, mich zu setzen. „Darf ich Ihnen etwas anbieten? Tee, Kaffee oder vielleicht einen Cognac?“
Ich verneinte.
„Aber Rauchen müssen Sie unbedingt! Ich liebe den Geruch von edlem Pfeifentabak. Der Graf hat es leider nie dazu gebracht, er ist bei seinen Zigarren hängengeblieben.“
Befehl ist Befehl. „Mit Verlaub.“ Ich zog die Pfeife aus der Tasche und begann, sie zu stopfen. Erfreulich, dass es noch Leute gab, die nicht jeden Tabakliebhaber gleich in die Kategorie „Massenmörder“ einordneten.
„Ja“, begann sie erneut, „es ist schon eine Weile her seit unserer letzten Begegnung.“