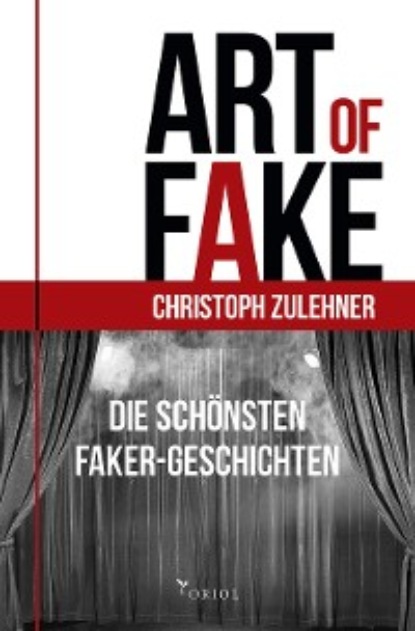- -
- 100%
- +
FROM RAGS TO RICHES TO RUINS
Erst habe er die Welt mit einem französischen Namen für seine Uhrenfirma genarrt, schrieb die überregionale Tageszeitung „Die Presse“ über Alfred Riedl, nun könne er es sich leisten, für 25 Mio. Euro eine Ruine zu renovieren. Die Ruine ist die Burg Taggenbrunn in Kärnten, unweit der Firmenzentrale von Jacques Lemans in Sankt Veit an der Glan. Alfred Riedl erwarb sie mitsamt umliegenden Weinbergen im Jahr 2011. Seitdem ist der bodenständige Unternehmer, der einst sein erstes Geld bei einem Energieversorger verdiente, zum Burgherrn avanciert. Im 14. und 15. Jahrhundert wurde einmal ganz Kärnten von Taggenbrunn aus regiert. Doch was heißt das schon im Vergleich zu Riedls internationalem Geschäftserfolg? Nach einer aktuellen Marktstudie ist Jacques Lemans die meistverkaufte Uhrenmarke in Österreich und Deutschland im Preissegment bis 200 Euro. Die Schweizer? Sollen sie doch weiter eine Swatch kaufen, wenn sie sich eine Patek Philippe oder eine Rolex nicht leisten können. Dem Burgherrn kann es wurscht sein. Er freut sich lieber darüber, dass sich die Zahl seiner Verkaufsstellen in Vietnam binnen kurzer Zeit von 30 auf 100 mehr als verdreifacht hat. 1,2 Millionen Uhren pro Jahr setzt Jacques Lemans heute weltweit ab.
Alfred Riedl ist mir rundum sympathisch. Nicht obwohl, sondern weil er sich als großer Faker gezeigt hat. In meinen Augen ist der Fake eine unerlässliche Kulturtechnik und ich bewundere all jene Menschen aufrichtig, die sie exzellent beherrschen. Der Fake ist eine positive Strategie der Selbstbehauptung und eine Eintrittskarte ins Establishment. Alfred Riedl hat diese Eintrittskarte gelöst. Dabei ist er durch und durch ehrlicher Kaufmann geblieben, so wie es sich für einen Faker im Business gehört. Mehr noch, in mehr als vier Jahrzehnten Unternehmertum habe er noch nie einen Kredit benötigt, betont Alfred Riedl. Das unterscheidet ihn von Blendern wie Donald Trump, der sich immer wieder durch fadenscheinige Insolvenzen seiner Schulden entledigte. Ein Faker betrügt nicht, sondern er gibt ein Versprechen, das er dann auch einlöst. Wären Alfred Riedls Uhren keine Qualitätsprodukte, dann hätte Jacques Lemans wohl kaum diesen lang anhaltenden internationalen Erfolg. Ein guter Faker weiß, was er sich und dem Markt schuldet. Er liefert.
Die kleine Schummelei mit dem französischen Namen ist in Alfred Riedls Imperium heute längst kein Thema mehr. Der Name Kevin Costner ist dafür ein umso größeres. In dem Film „Black or White“ aus dem Jahr 2014 schaute Hauptdarsteller Costner immer wieder auffällig auf die Jacques Lemans an seinem Handgelenk. Sie ist Teil einer „Kevin-Costner-Kollektion“, die der Hollywoodstar angeblich mitgestaltet hat. Doch es ist längst nicht bei einem Werbevertag zwischen Riedl und Costner geblieben. Anders als einst Steve McQueen oder heute George Clooney wurde Kevin Costner nämlich sogar zum Geschäftspartner seines Uhrenausstatters. Nach Angaben des Kärntner Herstellers hat sich Costner mit 15 Prozent an der US-Vertriebsfirma von Jacques Lemans beteiligt. Wenn die Marketingkampagne mit Kevin Costner für den einstigen Faker Alfred Riedl so etwas wie ein Ritterschlag war, dann kommt dieser geschäftliche Einstieg eines Hollywoodstars der Kaiserkrönung gleich.


2 | DER BALLSPORTLER
Sie ist Bestandteil so ziemlich jeden Sportfilms, den Hollywood je gedreht hat: die „Locker Room Scene“. Mindestens eine dieser Szenen im Umkleideraum gehört einfach dazu, sobald es in einem amerikanischen Streifen um Sport geht. Ganz gleich, ob um Profisport oder Collegesport. Das Klischee ist dermaßen etabliert, dass es auf YouTube mittlerweile sogar Playlisten der 10 besten oder witzigsten „Locker Room Scenes“ gibt. Den besonderen Reiz dieser Art von Szene versteht man als Europäer wahrscheinlich nur, wenn man sich Amerikas puritanische Doppelmoral vor Augen hält: Einerseits gilt kinematografische Nacktheit jenseits des Atlantiks als Teufelszeug. Deshalb achtet Hollywood strengstens darauf, dass die Kamera den entblößten männlichen Körper in einer „Locker Room Scene“ niemals zur Gänze zeigt. Entweder endet also der Bildausschnitt in Höhe des Bauchnabels oder man sieht ein um die Hüften geschwungenes Handtuch. Andererseits gehören verbale Anzüglichkeiten und zweideutige Bemerkungen so fest zu einer Szene im Umkleideraum wie Pompons zu tanzenden Cheerleadern. Manchmal ist das lustig. Meistens ist es – zumindest für Nichtpuritaner aus der Alten Welt – nur platt und peinlich.
Eine der schönsten – und gleichzeitig folgenreichsten – „Locker Room Scenes“ aller Zeiten schrieb allerdings nicht Hollywood, sondern das Leben. Diese reale Begebenheit ist frei von jeder Schlüpfrigkeit. Dafür zeigt sie einen geradezu meisterhaften Fake. Schauplatz ist ein Umkleideraum der Football-Mannschaft Minnesota Vikings in der zweiten Hälfte der Achtzigerjahre. Die Minnesota Vikings aus Minneapolis gehören seit 1961 ununterbrochen zur amerikanischen National Football League (NFL) und damit zur höchsten Spielklasse im American Football. Unzählige junge Männer zwischen New York und San Francisco träumen bis heute davon, in dieser oder einer anderen NFL-Mannschaft spielen zu dürfen. Doch nur wenige von ihnen haben die Chance auf eine Berufung in die Teams der ersten Liga. Junge Spieler aus den Mannschaften der Colleges werden nämlich von Scouts für die NFL-Teams ausgewählt und dann berufen.
Auch John, ein schwarzer Teenager aus dem ländlichen Texas, träumte bisher vergeblich von einer solchen Berufung, einem „Draft“. Immerhin hat er es jetzt schon einmal ins Frühjahrs-Trainingslager der Minnesota Vikings und in den dortigen Umkleideraum geschafft. Die kurzen, meist nur dreitägigen Trainingslager im Frühjahr, in der NFL „Mini-Camps“ genannt, dienen hauptsächlich dazu, neu berufene Spieler in die jeweilige Mannschaft zu integrieren. Ab und zu sehen sich die Trainer bei dieser Gelegenheit auch junge Talente an, bei denen sie noch nicht sicher sind, ob es für einen „Draft“ reicht. So ist es auch bei John.
Der schüchterne, nicht besonders groß gewachsene, aber muskulöse Jugendliche steht also im Umkleideraum seines persönlichen Dream Teams, der Minnesota Vikings. Nichts erinnert an die „Locker Room Scenes“ aus den Hollywoodfilmen: keine Mannschaftskameraden mit Handtüchern um den Hüften, keine Schwaden von Wasserdampf aus den Duschen, keine schlüpfrigen Witze. John ist allein im Umkleideraum. Als er sich komplett ausgezogen hat, greift er in seine Sporttasche. Er holt eine fast drei Kilogramm schwere, verchromte Eisenkette und ein Vorhängeschloss hervor. Beides hat er am Tag zuvor bei einem örtlichen Eisenwarenhändler erstanden. John legt sich die schwere Kette um die Hüften und zieht sie so fest wie möglich zu. Dann fixiert er die Kette mit dem Vorhängeschloss. Anschließend zieht er seine Unterhose und seine Trikothose darüber. Ein banger Kontrollblick vor dem Spiegel: Sieht man etwas? Nein, man sieht nichts. John kann sich auf den Weg zur Waage machen.
GEWOGEN UND FÜR ZU LEICHT BEFUNDEN
John Randle – denn von niemand Geringerem berichte ich hier – war in den Neunzigerjahren einer der Superstars der National Football League. Als Jugendlicher musste er sich immer dasselbe anhören: „Für einen Football-Verteidiger bist du zu klein und zu leicht“, meinten die Trainer. „Vergiss es, Junge!“ Nur den guten Beziehungen seines älteren Bruders Ervin, der es bereits zum NFL-Profi gebracht hatte, verdankte es John, dass sich die Spitzenvereine überhaupt mit ihm beschäftigten. Doch das Urteil lautete zunächst immer gleich: zu leichtgewichtig für einen Verteidiger auf der angestrebten Position. Weil Johns großer Bruder aber unbeirrbar an das Talent des jüngeren Bruders glaubte, nutzte er stets aufs Neue seine Kontakte innerhalb der NFL. So kam John Randle schließlich in Kontakt mit Floyd Peters, der zwischen 1986 und 1990 Co-Trainer und „Defensiv-Koordinator“ der Minnesota Vikings war. Die Vikings standen damals in dem Ruf, die schwächste Defensive der NFL zu besitzen. Sie brauchten dringend neue Verteidiger. Peters, ein Football-Urgestein, blieb trotzdem wählerisch. Was nützten ihm auch irgendwelche Verteidiger? Er brauchte die besten, damit eine sichere Defensive die Basis für den erneuten Erfolg der Mannschaft sein konnte.
Als John Randle zum ersten Mal nach Minneapolis reiste und Floyd Peters vorgestellt wurde, wog er 245 amerikanische Pfund. Das sind immerhin 111 Kilogramm, ein stolzes Gewicht für einen Jugendlichen. Zumal, wenn er, wie in diesem Fall, kaum ein Gramm Fett mit sich herumschleppt und es die Muckis sind, welche die Waage nach unten drücken. Doch Floyd Peters hatte für den dunkelhäutigen Jugendlichen nur ein mitleidiges Lächeln übrig. 245 Pfund? Ein Witz! American Football ist schließlich nicht so eine Warmduscher-Sportart wie Fußball. Hier laufen Kleiderschränke von Männern frontal aufeinander zu und versuchen, den Gegner einfach umzurennen. Und das ist vollkommen regelkonform!
„Komm in einem Monat wieder“, sagte Peters. „Wenn du dann 250 Pfund wiegst, bekommst du eine Chance, dich zu bewähren.“
Vier Wochen später war der junge John Randle zurück in Minneapolis und den Tränen nahe. Trotz aller Anstrengungen, noch mehr Muskelmasse aufzubauen, wog er unverändert 245 Pfund. Da kam er am Tag vor dem entscheidenden Training an einem Eisenwarengeschäft vorbei und hatte die Idee mit der Kette.
Zurück zur „Locker Room Scene“: John hat den Bereich mit den Spinden verlassen und steht nun auf der Waage. Er atmet flach. Seine Nerven sind aufs Äußerste angespannt, kleine Schweißperlen treten ihm auf die Stirn. Der für das Wiegen zuständige Assistent des Trainerstabs kennt so etwas. Etliche junge Männer bekommen hier nur eine einzige Chance – und sind vorher fast immer so nervös, dass sie sich fast in die Hosen machen. Dass John ein Faker ist, der gerade panische Angst vor seiner Entlarvung hat, ahnt der Assistenztrainer nicht. Der amerikanische Puritanismus spielt John jetzt übrigens in die Karten: Denn man wiegt sich nicht etwa textilfrei, um das exakte Körpergewicht zu ermitteln. Nein, die Hosen bleiben an, damit niemand sündigen Gedanken verfällt. Unter der locker sitzenden Trikothose übersieht der Assistenztrainer die schwere Kette um Johns Hüften.
Nach dem Wiegen geht John zurück zu seinem Spind, nimmt die Kette wieder ab – gefühlt sicher um weit mehr als drei Kilo erleichtert – und zieht sein Trikot komplett an. Dann geht er hinaus auf den Rasen. Floyd Peters hat ihn sofort im Auge.
„Wie viel wiegt er?“, ruft Peters grantig in Richtung des Assistenztrainers, der John gerade gewogen hat.
Der Assistent lakonisch: „251.“
Floyd Peters geht zu dem jungen John Randle und schaut ihm in die Augen. Der Blick des Defensiv-Trainers ist immer noch voller Misstrauen.
„Okay“, grummelt Peters schließlich, alles andere als begeistert. „Du bekommst eine Chance, dich zu bewähren.“
Noch bevor John grinsen kann, fügt der Trainer hinzu: „Los, ab zum Warmlaufen!“
DIE KORREKTUR DES SCHICKSALS
Im Französischen gibt es die schöne Redewendung corriger la fortune. Sie lässt sich mit der deutschen Entsprechung „dem Glück auf die Sprünge helfen“ nur unzureichend übersetzen. Denn im Deutschen fehlt das Element der „Korrektur“ – und das ist in meinen Augen das entscheidende. Corriger la fortune taucht als Wendung zum ersten Mal in einer Satire des französischen Schriftstellers Nicolas Boileau aus dem Jahr 1665 auf. Es geht darin um einen heruntergekommenen Adeligen, der heimlich die Porträts seiner Ahnen verhökert, damit man ihm den finanziellen Niedergang nicht anmerkt. Berühmt gemacht hat den Ausdruck dann Gotthold Ephraim Lessing in seinem Lustspiel „Minna von Barnhelm“. Auch hier geht es um eine finanziell abgebrannte Existenz, die ihr scheinbar schon besiegeltes Schicksal mit Minnas Hilfe noch einmal zu „korrigieren“ versucht. Für die kleine Täuschung, die John Randle in seiner Jugend begangen hat, um Defensivspieler in der National Football League werden zu können, finde ich den Ausdruck „das Schicksal korrigieren“ sogar noch treffender als angesichts eines drohenden finanziellen Ruins. Solch eine kleine „Korrektur“ bei den Voraussetzungen für eine Karriere vorzunehmen, die einem geradezu schicksalhaft vorbestimmt erscheint, ist auch das prototypische Verhalten eines Fakers.
Der jugendliche John Randle wusste, dass er das Zeug zu einem Spitzenverteidiger hatte. Mehr noch: dass er nur auf einer ganz bestimmten Position – „Defensive Tackle“ genannt – sein größtes Leistungspotenzial abrufen konnte. Ein ungeschriebenes Gesetz des American Football wollte es aber, dass diese Position ausschließlich mit hünenhaften Muskelpaketen besetzt wurde. John Randle war zwar kräftig, aber eher klein und brachte entsprechend weniger Gewicht auf die Waage. Eine andere Position kam für den jungen Mann aus Texas jedoch nicht infrage. Wie alle meisterhaften Faker war er zutiefst von seinem Potenzial überzeugt. Er wusste auch genau, wo er es am besten einbringen konnte. So war der Jugendliche zu seinem Fake geradezu gezwungen. Der Fake eröffnete ihm einen Weg, eine aus seiner Perspektive unsinnige Regel zu umgehen, damit Wirklichkeit werden konnte, was seine Bestimmung schien. An dieser Stelle wird noch einmal deutlich, was den Faker vom Betrüger und vom Hochstapler unterscheidet: Auf den ersten Blick wirkt die Sache mit der Kette wie ein Betrug. Doch auf den zweiten Blick zeigt sich: Der Faker räumt lediglich ein Hindernis aus dem Weg, das ihn davon abhält, sein Können unter Beweis zu stellen. Im Gegensatz zum Betrüger und zum Hochstapler strebt der Faker etwas an, das ihm moralisch zusteht.
Wie alle Faker gab auch der jugendliche John Randle ein Versprechen an sich selbst und an den Markt ab. Nachdem er sich seine Chance erschummelt hatte, musste er liefern, und zwar schnell. Wörtlich sagte sein Trainer Floyd Peters zu ihm: „We’ll give you a shot.“ Diese amerikanische Redewendung bedeutet nicht, dass man es geschafft hat. Sondern dass man eine – kleine – Chance bekommt, sich zu bewähren. Man hat „einen Schuss frei“. Was tat Randle, um diese Chance zu nutzen und sein Versprechen möglichst bald einlösen zu können? Er suchte sich als Erstes einen Mentor. Vor Selbstsicherheit strotzend klopfte der Jugendliche an die Tür von John Teerlinck, einem weiteren Co-Trainer der Minnesota Vikings. Randle stellte sich vor den erfahrenen Coach und sagte: „Ich will ein richtig guter Spieler werden. Können Sie mir dabei helfen, ein richtig guter Spieler zu werden?“ Beeindruckt von so viel Ambition und Selbstvertrauen bei einem eher klein gewachsenen Jugendlichen schlug John Teerlinck ein. Er wurde und blieb Randles Mentor. Randle lernte schnell. Schon nach kurzer Zeit zweifelte bei den Minnesota Vikings niemand mehr daran, dass dieses kleine Kraftpaket auf der Position des „Defensive Tackle“ genau richtig war.
DER UNERFÜLLTE TRAUM VON DER MÜLLABFUHR
Der Traumberuf des jungen John war ursprünglich Müllmann. Das ist kein Scherz, sondern im Gegenteil bitterer Ernst. John Randles Eltern aus dem Flecken Mumford in Texas waren so arm, dass dem zweiten von drei Kindern ein Job bei der Müllabfuhr wie die Verheißung einer gesicherten Existenz vorkam. John war schon als Teenager körperlich kräftig und überdurchschnittlich belastbar. Somit fühlte er sich der harten Arbeit auf den im Sommer glutheißen texanischen Straßen gewachsen. Er glaubte auch, als Müllmann einen positiven Beitrag für die Gemeinschaft leisten zu können – das entsprach dem guten Charakter des Jungen. Außerdem hätte er jeden Tag schon am frühen Nachmittag frei gehabt und anschließend Sport machen können. Doch als John die Highschool vorzeitig verlassen und sich bei der Müllabfuhr bewerben wollte, sprach seine Mutter – der Vater war meist abwesend – ein Machtwort: „Du bleibst auf der Schule. Und du bleibst in der Football-Mannschaft.“ Nachdem John Randle 2010 in die „Hall of Fame“ der National Football League aufgenommen worden war, dankte er in seiner Rede der Mutter für dieses Machtwort.
Der Staat Texas meinte es mit seinen dunkelhäutigen Mitbürgern noch nie besonders gut. Zwar wurde 1964, drei Jahre vor John Randles Geburt, die Rassentrennung im amerikanischen Süden offiziell abgeschafft. Doch von Chancengleichheit für die schwarze Bevölkerungsgruppe konnte deshalb noch lange keine Rede sein. Und das gilt wahrscheinlich bis heute. Mutter Randle wusste, dass es für ihre Jungen vor allem zwei Chancen gab: Bildung und Sport. Beides hängt in den USA eng miteinander zusammen. Talentierte junge Sportler erhalten Stipendien für den Besuch eines Colleges, wenn sich deren Eltern die – zumeist horrenden – Studiengebühren nicht leisten können. Die Sportmannschaften sind Aushängeschilder und Statussymbole der Hochschulen. Colleges sorgen auf diese Weise dafür, dass ihnen kein begabter junger Spieler entgeht. Die Mannschaften der Profiligen, sei es Football oder Baseball, rekrutieren ihren Nachwuchs dann wiederum aus den Teams der Colleges.
So bekam auch der junge John Randle, aufgewachsen in einer Holzhütte ohne WC und im Winter ohne Heizung, schließlich ein Stipendium der staatlichen Texas A&I University. Vorher hatte sein älterer Bruder Ervin bereits ein Stipendium der Baylor University in Waco erhalten. Für Ervin war es die Eintrittskarte in den Profisport gewesen, übrigens ganz ohne Fake. Ervin Randle spielte von 1985 bis 1992 als „Linebacker“ für die NFL-Mannschaften Tampa Bay Buccaneers und Kansas City Chiefs. Er bestritt 105 Spiele, erreichte aber nie die spätere Berühmtheit seines jüngeren Bruders. Dass es gerade American Football war, der den beiden dunkelhäutigen Brüdern einen Weg aus bitterster Armut ebnete, birgt insofern eine gewisse Ironie, als in dieser Sportart noch wenige Jahrzehnte zuvor ein unverhohlener Rassismus herrschte: Anfang der 1930er-Jahre hatten die mächtigen Eigentümer der Erstliga-Teams das berüchtigte „Gentlemen’s Agreement“ geschlossen. Damit wurde Schwarzen unter der Hand die Aufnahme in die Mannschaften verwehrt. So fand sich – ausgerechnet – zwischen 1933 und 1945 kein einziger Schwarzer in der höchsten Spielklasse des American Football. Zwar wurde das „Gentlemen’s Agreement“ nach dem Zweiten Weltkrieg gelockert und spielte nach Gründung der modernen NFL im Jahr 1970 keine Rolle mehr. Doch wer glaubt, der Rassismus sei über Nacht verschwunden, der kennt Amerika schlecht. Es ist also nur wenig Spekulation im Spiel, wenn man davon ausgeht, dass John Randle in der NFL nicht gerade der rote Teppich ausgerollt wurde. Als Schwarzer aus ärmsten Verhältnissen, ehemaliger Student eines staatlichen Colleges, zudem für einen Football-Spieler eigentlich zu klein, traf er in der Kabine und auf dem Spielfeld auf hellhäutige Hünen aus reichen Elternhäusern, die von den privaten Elite-Unis kamen. Wenn Randle also vielleicht der Rolle eines Außenseiters kaum entkommen konnte, so fand er immerhin seinen eigenen Weg, damit umzugehen.
„DER VERRÜCKTESTE SPIELER IN DER GESCHICHTE DER NFL“
Bis heute haften dem Hall-of-Fame-Spieler John Randle zwei Etiketten an. In beiden Fällen handelt es sich um Superlative. Auf dem ersten Etikett steht: „Bestbezahlter Defensivspieler aller Zeiten.“ Auf dem zweiten: „Verrücktester Spieler in der Geschichte der NFL.“ Das erste Etikett will schon etwas heißen in der umsatzstärksten und zahlungskräftigsten Sportliga der Welt. Das zweite lohnt einen genaueren Blick: Wie konnte der gutmütige, stets freundliche, ursprünglich eher schüchterne Junge aus Texas auf dem Rasen zum „Verrückten“ werden? Mannschaftskameraden, Gegner, Schiedsrichter, Zuschauer und Kommentatoren konnten bei seinen Auftritten immer wieder nur den Kopf schütteln. Wie kam das? Möglicherweise war John Randle wirklich durchgeknallt. Oder dieses Auftreten war nur ein Trick, ähnlich wie einst die Kette auf der Waage. Vielleicht hatte das irritierende Benehmen auf dem Spielfeld, für das John Randle so berühmt wurde, ja am Ende sogar etwas mit der Einlösung des Versprechens eines Fakers zu tun.
Unbestreitbar ist, dass es in der NFL vor Randle und auch nach ihm keinen anderen Spieler gab, der auf dem Rasen dermaßen die Sau raus-gelassen hätte. In den Nahaufnahmen seiner Aktionen, die im amerikanischen Fernsehen gezeigt wurden, hört man fast öfter einen „Beep“ als seine Stimme. Mit solchen „Beeps“ löscht das Fernsehen im puritanischen Amerika bekanntlich „Four-Letter-Words“ von der Tonspur. Randle schrie auf dem Rasen wohl öfter „Fuck you!“ (in europäischen Büchern dürfen wir so etwas ja Gott sei Dank schreiben), als seine Mannschaft Bälle eroberte. Auch vor Schiedsrichtern zeigte er wenig Respekt. Einmal drohte ein Schiedsrichter Randle: „Ich schreibe Sie gleich in mein Notizbuch.“ (Das ungefähre Pendant zur gelben Karte im Fußball.) Darauf Randle: „Und ich schreibe Sie auf meine Weihnachtsliste – wie finden Sie das?“ Als so richtig „crazy“ empfanden die Zuschauer und Mitspieler aber erst Randles nonverbale Äußerungen: Er imitierte epileptische Anfälle auf dem Rasen, gurgelte auf der Bank laut mit Wasser, verdrehte die Augen, grunzte, schnaubte, spuckte, lallte wie besessen und führte alle Varianten von irren Tänzen auf. Mitspieler, Gegner und Schiedsrichter schauten dabei meist nur fassungslos zu. Hinzu kam sein Spielstil, der von Experten einhellig als „wild“ charakterisiert wird. Randle tobte auf dem Spielfeld wie ein aus dem Käfig gelassenes Raubtier.
„Er war nicht verrückt“, ist sich Randles Mentor John Teerlinck sicher. „Der Wahnsinn hatte Methode.“ Randles gespielte Verrücktheit war eine Strategie der Selbstbehauptung. Durch einen Fake hatte er sich Zutritt zu einer Mannschaft verschafft, in der er zunächst nicht erwünscht war. Den Makel, für seine Position eigentlich zu klein zu sein, konnte er zwar nicht beseitigen, aber kompensieren. Randle entschied sich, maximal zu irritieren, um sich durchsetzen zu können. Er sagte dazu selbst: „Ich sah mich als den kleinen Hund in der Gruppe.“ Kleine Hunde müssen lauter bellen als große. Mit seinem losen Mundwerk schüchterte er seine Gegner ein und verschaffte sich Respekt in den eigenen Reihen. Nicht zuletzt mit dieser Strategie löste er sein Faker-Versprechen ein. Hinzu kam selbstverständlich eine überragende sportliche Leistung. Ausgerechnet der „kleine“ Randle räumte Gegenspieler ab, die als unbezwingbare Berserker galten. Möglicherweise kam ihm dabei zugute, dass die Gegner den „kleinen Verrückten“ regelmäßig unterschätzten. Berühmt wurde Randle aber nicht allein wegen seiner Verrücktheiten, sondern auch wegen seiner fantastischen Spieltechnik. Eine von ihm entwickelte schnelle Körperdrehung, als „The Spin“ legendär geworden, vergleicht Randles Mentor Teerlinck mit einem Tornado.
Im Leistungssport wird einem nichts geschenkt, so heißt es. John Randle wurde bereits während seiner Kindheit und Jugend nichts geschenkt. Doch er war zutiefst von sich selbst und seinem Potenzial überzeugt. Erst dieses Selbstbewusstsein ermöglicht dem Faker den Fake. Andernfalls wäre seine Schummelei ein Betrug, der schnell auffliegt und offenbart, dass da einer in einer höheren Liga nichts zu suchen hat. Wer sein Schicksal korrigieren will, der muss sich der korrigierten Version innerlich gewachsen fühlen. Bei John Randle war das ohne jeden Zweifel der Fall. Nach seinem Karriereende und der Aufnahme in die Hall of Fame des American Football lebt er heute mit seiner Familie in einem kleinen Ort mit 5.000 Einwohnern. In Medina, Minnesota, vor den Toren von Minneapolis, erinnert ihn jedoch nichts an das ärmliche Mumford, Texas, in dem er aufgewachsen ist. Das durchschnittliche Haushaltseinkommen beträgt hier 97.000 US-Dollar. Randles Eigenheim ist zwar nicht vergleichbar mit den Stuckpalästen der Hollywoodstars, doch mehr als komfortabel. Von Randles schwieriger Jugend und dem einstigen Zwang zum Fake ist nichts geblieben. Das heißt, fast nichts: Am rechten Handgelenk trägt Randle heute eine grobgliedrige Kette, die fast so aussieht wie jene, die er sich einst mit einem Vorhängeschloss um die Hüften legte, um mehr als 250 Pfund auf die Waage zu bringen.