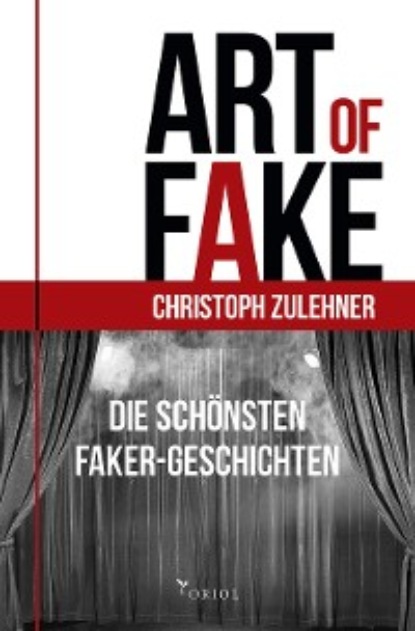- -
- 100%
- +
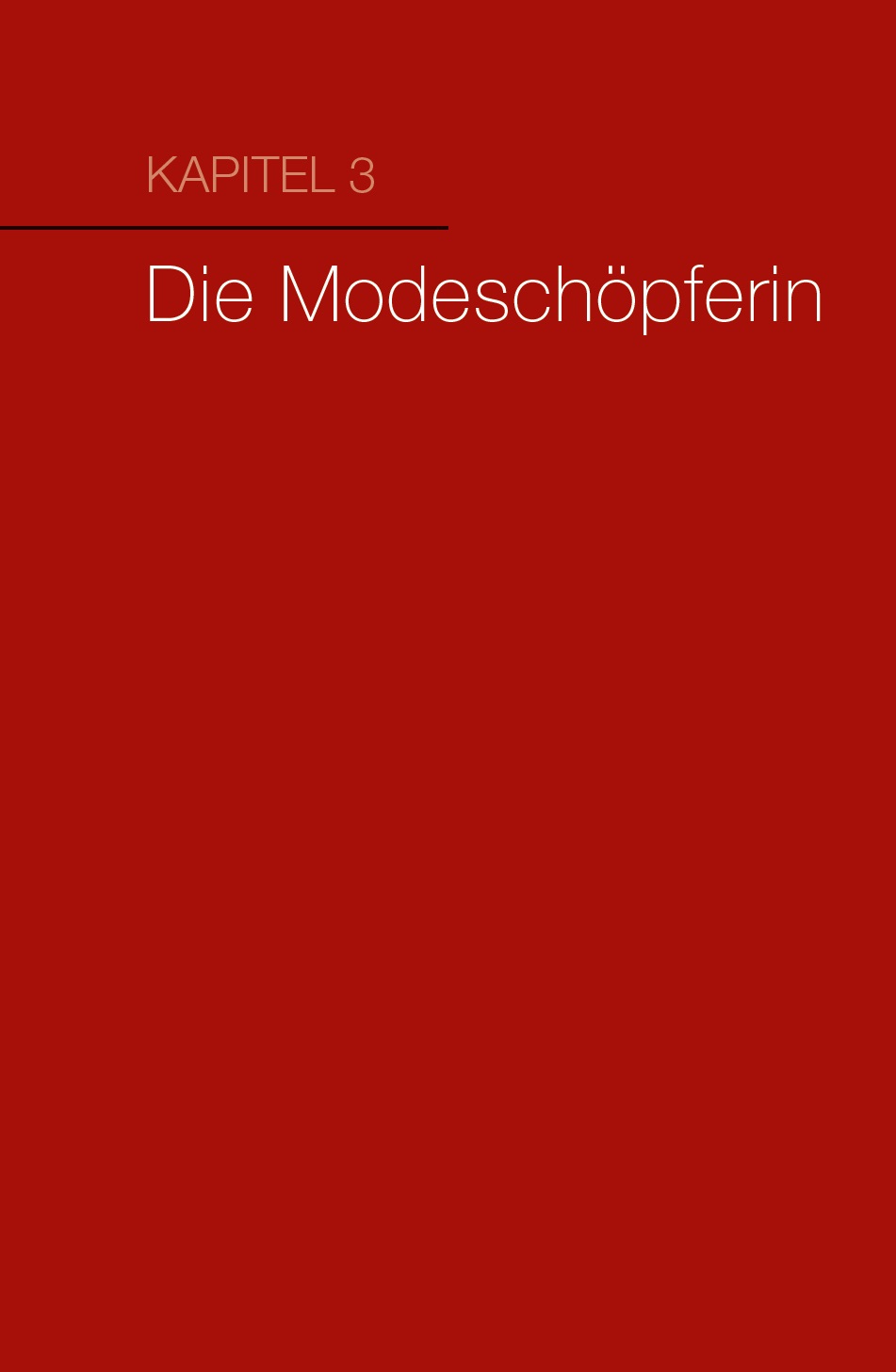

3 | DIE MODESCHÖPFERIN
Paris in den Zwanzigerjahren des letzten Jahrhunderts. Zwischen den beiden Weltkriegen war die französische Metropole die unangefochtene Kulturhauptstadt der Welt. Bildende Kunst, Literatur und Theater, Musik und Tanz, Architektur, Mode und Design – das alles stand in höchster Blüte. Eine Explosion der Kreativität, gleichermaßen begierig konsumiert wie mäzenatisch gefördert von einer Bourgeoisie, die sich auf ausschweifenden Partys allabendlich selbst feierte. „Les Années Folles“ nannte sich diese Zeit bald selbst, die verrückt-frivolen Jahre. Es herrschte ein Verlangen nach Freiheit und Lebendigkeit, ein Streben nach Kultiviertheit und intellektuellem Austausch und eine geradezu unverschämte Lust auf Luxus. „Le soleil de l’art alors brillait seulement sur Paris“, schrieb Marc Chagall: Nirgendwo scheint die Sonne der Kunst heller als über Paris. Amerikanische Expatriierte bildeten hier eine eigene Szene, zu der die Literaten F. Scott Fitzgerald, Gertrude Stein, Henry Miller und Ernest Hemingway zählten. Der Soundtrack dazu: „Ein Amerikaner in Paris“ von George Gershwin. Josephine Baker wurde für ihren Tanz frenetisch gefeiert. Modigliani und Chagall schufen einige ihrer berühmtesten Gemälde. Selbstverständlich residierten in Paris auch die bedeutendsten Kunsthändler der Welt.
Die Olympischen Spiele von 1924 brachten der Stadt die Aufmerksamkeit breiter Schichten. Kubismus, Dadaismus und Surrealismus waren dagegen Produkte einer flirrenden, skandalträchtigen Gegenkultur. Man Ray, Marcel Duchamp oder Salvador Dalí verstörten das Bürgertum nicht allein mit ihrer Kunst, sondern auch mit ihrem exzentrischen Lebensstil. Nicht zuletzt festigte Paris in diesem Jahrzehnt seinen Status als Modestadt Nummer eins. Gabrielle „Coco“ Chanel dominierte die Laufstege zunächst unangefochten. Sie stand für schlichte Eleganz, kombiniert mit hoher Handwerkskunst. 1921 brachte sie das Parfüm Chanel Nº 5 auf den Markt, ein ebenso revolutionärer wie luxuriöser Duft, die olfaktorische Signatur des anbrechenden Jahrzehnts und ein Produkt wie für die Ewigkeit.
Als die 32-jährige Elsa Schiaparelli 1922 nach Paris kam, um sich dort niederzulassen, war sie ein Niemand. Doch die geschiedene und nun alleinerziehende Mutter einer Tochter wollte hier und nirgends sonst Furore machen. Sie sah sich als Künstlerpersönlichkeit, obwohl sie keine Kunsthochschule von innen gesehen hatte. Sie sollte sich anschicken, mit ihrer Mode keiner geringeren als Coco Chanel Konkurrenz zu machen, obwohl sie nie eine Schneiderlehre absolviert hatte. Elsa Schiaparelli entwickelte eine Vision, von der sie hundertprozentig überzeugt war: Sie wollte die Ästhetik der künstlerischen Avantgarde in die Welt der Mode überführen. Der alles beherrschende Stil des Hauses Chanel galt ihr als spießig und langweilig. Die Italienerin träumte von einer Mode, die so irritierend, so bunt, provokativ und gleichzeitig verspielt war wie die Kunstaktionen der Surrealisten. Die Provokation war gleichzeitig ihre vielleicht einzige Chance auf Sichtbarkeit. Trotz – oder gerade wegen – nur 1,50 Meter Körpergröße musste sie sich selbstbewusst als neue Größe der Modewelt präsentieren: Erst Schein, dann Sein. Doch woher kam diese Frau überhaupt?
GEFAKTE OHNMACHT VOR DEM ALTAR
Elsa Schiaparelli hatte ein Elternhaus, um das sie viele beneiden durften: Die Mutter entstammte altem neapolitanischen Adel, der Vater war ein angesehener und wohlhabender Professor für Orientalistik, der Onkel ein bekannter Astronom. Man lebte in einem römischen Palazzo. Der Bildungsbürgertochter mit Geld im Rücken hätten sich Türen geöffnet, die für Arbeiterkinder noch auf Jahrzehnte fest verschlossen blieben. Doch sie hatte schon als Kind nichts als Verachtung für ihr konservativ-katholisches Elternhaus übrig. Wo sie nur konnte, brüskierte sie ihre Eltern. Mit acht Jahren, bei ihrer Erstkommunion, trat sie vor den Priester und stöhnte theatralisch: „Ich habe Unzucht getrieben!“ Anschließend fakte sie eine Ohnmacht und sank graziös zu Boden. Sogar ihr Vorname war ihr zu spießig, weshalb sie sich lieber „Schiap“ nannte. Den Eltern reichte es, als sie bei ihrer vorpubertären Tochter hoch-erotische Gedichte fanden, die sie auch noch selbst verfasst hatte. Elsa kam in ein strenges Schweizer Internat. Sie trat so lange in den Hungerstreik, bis sie zu ihren Eltern zurückgeschickt wurde. Dort sprang sie mit einem Regenschirm als Fallschirm aus dem Fenster, übrigens ein gängiges Motiv zeitgenössischer Karikaturen. Damit brachte sie sich beinahe um, denn ihre Fantasie herrschte keineswegs über die Materie. Endlich volljährig zog Schiaparelli nach London und entging so der Ehe mit einem reichen Russen, den ihre Eltern für sie erwählt hatten. Sie arbeitete als Kindermädchen in vornehmen Haushalten und hielt sich damit über Wasser. Eines Abends besuchte sie den Vortrag eines Hochstaplers und Selbstdarstellers, der als Willem de Wendt auftrat, bei anderer Gelegenheit aber auch die Pseudonyme Willie Wendt oder Wilhelm de Kerlor verwendete, wenn er sich nicht gerade als den „weltberühmten Dr. W. de Kerlor“ ankündigte. Die 23-Jährige war schock-verliebt und verlobte sich bereits am nächsten Tag. Kurze Zeit später fand die Hochzeit statt. Schiaparelli unterstützte ihren Ehemann, der als Prophet und Wahrsager auftrat, bis die Behörden ihn wegen illegaler Geschäftspraktiken anklagten. Das Paar floh zunächst an die Côte d’Azur und im Frühjahr 1916 schließlich nach New York. Zwischenzeitlich hatte es Elsa Schiaparelli hinbekommen, dass ihre Eltern ihr regelmäßig finanziell unter die Arme griffen. Ob aus Liebe, aus Mitleid oder um Schlimmeres zu verhindern, ist nicht bekannt.
In New York eröffnete William de Kerlor – oder wie auch immer sein richtiger Name lautete – ein „Büro“ für Parapsychologie und übersinnliche Beratung. Prompt wurde er vom FBI beobachtet. Unmittelbar nach der Geburt der gemeinsamen Tochter Maria Luisa ließ de Kerlor seine Frau sitzen und brannte mit einer Tänzerin durch. Die gedemütigte Schiaparelli freundete sich mit Gabrielle Picabia an, der Frau des Dadaisten und Surrealisten Francis Picabia. So fand sie nicht nur eine emotionale Stütze, sondern auch Zugang zu Kreisen der künstlerischen Avantgarde. Sie lernte Man Ray, Marcel Duchamps und Alfred Stieglitz kennen. Nach ihrer Scheidung und einer kurzen, unglücklichen Affäre übersiedelte sie schließlich 1922 nach Paris.
Mit dem Geld ihrer Mutter bezog Elsa Schiaparelli eine großzügige Wohnung in einem angesagten Viertel, inklusive Diener, Koch und Hausmädchen. Als geschiedene Gattin eines Hochstaplers wusste sie eben, wie man Menschen beeindruckt – auch wenn nichts dahinter ist. Noch nichts dahinter ist, muss in ihrem Fall ergänzt werden. Denn noch war sie auf der Suche nach etwas, womit sie berühmt werden konnte. Sie war offensichtlich überzeugt davon, bald fündig zu werden. Kurze Zeit half sie Man Ray bei der Herausgabe einer erfolglosen Kunstzeitschrift. Aber die bildende Kunst – nein, die war es einfach nicht. Als sie den Modeschöpfer Paul Poiret kennenlernte, passierte es dann: Ihre Leidenschaft für die Mode entflammte – und es war alles andere als ein Strohfeuer. Mit Mitte 30 wusste Schiaparelli nun endlich, was sie werden wollte: Modeschöpferin. Dieser Plan war ungefähr so erfolgversprechend, wie mit einem Regenschirm als Fallschirm der Schwerkraft trotzen zu wollen. Doch immerhin wurde Paul Poiret für die nächsten Jahre ihr Mentor.
DER SCHWARZE PULLOVER MIT DER WEISSEN SCHLEIFE
Irgendwann hatte Elsa Schiaparelli eine kleine Kollektion. Doch wen interessierte das? Frauen, die Kleider nähten oder Pullover strickten und ihre Freundinnen damit beglückten, gab es viele. Keine davon war berühmt. Modeschöpfer? Das war, wer Filmdiven und Fürstinnen mit seinen Roben ausstattete und seine aktuelle Kollektion in der Zeitschrift „Vogue“ abgebildet sah. Elsa Schiaparellis Bekanntenkreis mag illustrer gewesen sein als der einer strickenden Oma. Schließlich bewegte sie sich in der Pariser Avantgarde. Doch für einen Durchbruch als Modeschöpferin brauchte es mehr als eine Gabrielle Picabia in einem von Sciaparelli gestrickten Schal. Die „Vogue“ entschied, wer dazugehörte und wer nicht. Schiaparelli zeigte sich in ihren Kreationen regelmäßig am Rande von Modenschauen. Doch niemand tat ihr dort den Gefallen, sie zu entdecken. In ihrer großbürgerlichen Wohnung hätte sie nur zu gern die Damen der Gesellschaft empfangen. Doch keine erschien. Da schmiedete sie im November 1927 einen verwegenen Plan. Sie beabsichtigte, dort einen krachenden Auftritt hinzulegen, wo die Meinungsmacher der Modewelt samt einiger der besten Kundinnen der großen Modehäuser versammelt waren: beim legendären Diner des Chefredakteurs der „Vogue“. Wie sie an die Einladung gekommen ist oder ob sie überhaupt eine hatte, ist nicht überliefert.
Elsa Schiaparelli kam jedenfalls absichtlich zu spät. Die Herrschaften saßen bereits an der festlich gedeckten Tafel und speisten. Plötzlich flog die Tür auf. Mit entschuldigender Miene blickte ein Diener noch kurz in Richtung des Gastgebers. Da betrat Elsa Schiaparelli auch schon den Raum. Nein, sie betrat eine Bühne. Doch nicht sie war die Hauptdarstellerin, sondern ihr Pullover. Es war ein schwarzer Pullover mit einer eingestrickten weißen Schleife. So einen Pullover hatte Paris noch nicht gesehen: Er war frech und doch elegant. Ein Blickfang und gleichzeitig ein Augenschmeichler. Vor allem aber ließ er einen Stil erkennen, der sich von der gepflegten Langeweile der Coco Chanel mehr als deutlich unterschied. Ich gebe zu: Bei den Details dieser Szene spekuliere ich ein wenig. Ich war natürlich nicht dabei und es gibt auch keine Bild- oder Tondokumente. Wenn wir uns allerdings vor Augen führen, dass allein dieser Auftritt für die Schiaparelli den Durchbruch zur zweiten maßgeblichen Größe der damaligen Modewelt bedeutete, dann kann es nur ein gigantischer Fake gewesen sein. Elsa Schiaparelli muss mit einem Selbstbewusstsein in die Dinnerparty geplatzt sein, als sei sie bereits ein Star der Schneiderkunst.
Anders sind die Folgen dieses Abends jedenfalls kaum erklärbar. Die anwesenden Damen waren nämlich derart enthusiasmiert, dass fast alle so schnell wie möglich einen dieser Pullover haben wollten. In den nächsten Tagen telefonierten sie aufgeregt mit ihren Freundinnen und Bekannten, um von dem Pullover zu berichten. Es war die amerikanische Schriftstellerin und Drehbuchautorin Anita Loos, die schließlich Hollywoods Filmdiven zu Schiaparelli schickte. Loos war der Szene expatriierter amerikanischer Schriftsteller eng verbunden und pendelte regelmäßig zwischen Los Angeles und Paris. Auf ihre Empfehlung ließen sich unter anderem Greta Garbo, Joan Crawford, Gloria Swanson und Mae West von Schiaparelli einkleiden. Selbstverständlich befeuerte auch die „Vogue“ den Hype. Elsa Schiaparellis geschäftlicher Erfolg war sensationell. Nur drei Wochen nach ihrem Auftritt bei der Dinnerparty konnte sie ein eigenes Atelier eröffnen – in bester Lage und mit riesigen, opulent ausstaffierten Räumen. Um 1932 besaß das Haus Schiaparelli neben diesem Flaggschiff bereits zehn weitere Ateliers. Eine Dependance befand sich in London, jener Stadt also, aus der Schiaparelli einst mit ihrem Mann fliehen musste, um einer Verurteilung wegen illegaler Geschäfte zu entgehen.
EIN ROSA SCHOCK FÜRS LEBEN
Die Kunst der Pariser Avantgarde, insbesondere der Surrealismus, brachte Elsa Schiaparelli auf die verrücktesten Ideen für ihre Mode. Als besonders fruchtbar erwies sich dabei ihre Freundschaft zu Salvador Dalí. Im Jahr 1936 schuf Dalí für einen englischen Kunstsammler sein berühmtes „Hummertelefon“. Es besteht aus einem funktionsfähigen Telefon mit Wählscheibe aus dem zeittypischen schwarzen Bakelit, wobei der Hörer die naturgetreue Form und Farbe eines Hummers besitzt. Schiaparelli war so begeistert von dem Objekt, dass sie gemeinsam mit Dalí das „Hummerkleid“ entwarf. Es war ein im Grunde klassisch-elegantes Kleid mit nur einem einzigen bewussten Stilbruch, nämlich einem riesigen Hummer als Dekor auf der Vorderseite. Dalís Vorschlag, bei der Präsentation des Kleids echte Mayonnaise darauf zu verteilen, lehnte Schiaparelli allerdings ab. Das Kleid war auch so schon provokativ genug, schließlich befinden wir uns Jahrzehnte vor dem Siegeszug schrill-bunter T-Shirts und anderer bedruckter Klamotten mit allen möglichen und unmöglichen Motiven. Wer trug ein solches surrealistisches Kleid? Beispielsweise Wallis Simpson kurz vor ihrer Hochzeit mit dem Duke of Windsor, zu dem Zeitpunkt britischer Thronfolger. (Er verzichtete später lieber auf die Königskrone.) Ein Foto der angehenden Duchess of Windsor in diesem Kleid, veröffentlicht in der amerikanischen „Vogue“, löste in England einen ordentlichen Skandal aus.
Elsa Schiaparelli konnten Skandale nur recht sein. Der Motor ihres Geschäftserfolgs waren Methoden, die erst Jahrzehnte später – genauer gesagt ab den Sechziger- und Siebzigerjahren des letzten Jahrhunderts – zu festen Bestandteilen der Modeszene werden sollten: bewusste Inszenierung von Stilbrüchen, demonstrative Abkehr von Traditionen (oder im Gegenteil ironisches Spiel damit) und nicht zuletzt erbitterter Kampf um Aufmerksamkeit. Letzteres inklusive Provokation und Skandal als Teil des Kalküls. Zu Schiaparellis Signatur wurden jedoch weder Dalís Hummermotive noch die nicht minder irritierenden „Skelettkleider“ und „Skelettpullover“, die ihre Trägerinnen wie wandelnde Röntgenbilder aussehen ließen. Es wurden auch nicht die aberwitzigen „Spiralbrillen“, die Man Ray für Schiaparellis Modenschauen schuf. Nein, emblematisch für das Haus Schiaparelli wurde eine einzige Farbe: „Shocking Pink“. Dieses kreischende Rosa, hart an der Grenze zum Rot, beschrieb Schiaparelli selbst einmal als „so lebensspendend, als ob alles Licht und alle Vögel und alle Fische der Welt sich darin vereinigt hätten.“
Der kritische Betrachter könnte es auch so ausdrücken: Diese Farbe tut weh. Doch so wollte es Elsa Schiaparelli. Genau das war ihr Erfolgsrezept: Exzess und Provokation bis zur Schmerzgrenze. „Sie ohrfeigte Paris, sie peitschte, sie folterte es – und Paris liebte sie dafür“, schrieb Yves Saint Laurent 1986 in seinem Vorwort zu einer Biografie über Schiaparelli. Die naheliegende Frage, wo bei Schiaparelli die Leidenschaft für die Kunst aufhörte und wo das Kalkül begann – oder umgekehrt – muss wohl unbeantwortet bleiben. Ohne jeden Zweifel war sie eine geniale Geschäftsfrau. Es beginnt bereits bei der Marktlücke, die sie für sich erkannte: Die „Années Folles“ mit ihrer subversiven Gegenkultur des Dadaismus und Surrealismus fanden in der Mode zunächst überhaupt keinen Widerhall, was rückblickend durchaus erstaunlich ist. Stattdessen galt das minimalistische „kleine Schwarze“ der Coco Chanel als Inbegriff des modischen Stils dieser Zeit. Wenn es Schiaparelli nicht gewesen wäre, die der Mode den surrealen Zeitgeist jener Jahre eingehaucht hätte, dann wäre wahrscheinlich jemand anderes gekommen.
Doch eine Marktlücke zu sehen und zu besetzen ist nur das eine. Das andere ist konsequente Markenbildung. Hier agierte Schiaparelli wie aus dem Lehrbuch des „Branding“, lange vor der Erfindung dieses Begriffs. In der Markenführung war sie ihrer Zeit weit voraus. So erkannte sie glasklar die Bedeutung einer Farbe als Markensignatur. „Shocking Pink“ war alles andere als ein Zufall – Schiaparelli war gezielt auf der Suche nach einer solchen „Signature Colour“ gewesen und hatte vorher unter anderem mit einem intensiven Blauton experimentiert. Noch moderner war die Art, wie sie die Markenidentität des Hauses Schiaparelli auf ein breites Portefeuille von Produkten übertrug. Bestes Beispiel ist ein Parfum mit dem Namen „Shocking“, welches das Haus Schiaparelli 1937 auf den Markt brachte. Der Karton war – selbstverständlich – in „Shocking Pink“ gehalten. Der Flakon hatte die Form eines weiblichen Torsos. Eine Sensation! Als Jean-Paul Gaultier in den 1990er-Jahren diese Art von Flakon für seine Parfüms kopierte, konnte er sich dies nur erlauben, weil Schiaparelli da schon vollständig in Vergessenheit geraten war.
ERFOLGREICHER FAKE HEISST NICHT ERFOLG AUF DAUER
Die hochbetagte Elsa Schiaparelli soll jeden Abend in ihrem Pariser Appartement voll geschminkt und im Tigerpyjama vor dem Fernseher gesessen haben. Doch bei ihrem Ableben im November 1973 kannte schon fast niemand mehr den Namen der einst so berühmten Italienerin. Im Gegensatz zu Chanel, dem Markennamen ihrer früheren Erzrivalin. Ganz zu schweigen von den Modeschöpfern, die seit dem Zweiten Weltkrieg mit ihrer „Haute Couture“ (wie die tonangebende Schneiderkunst nun hieß) Furore gemacht hatten: Christian Dior, Yves Saint Laurent und Pierre Cardin vor allem – interessanterweise ausschließlich Männer, so wie auch Stars der nächsten Generation: Armani, Versace, Lagerfeld. Dabei hatten einst zwei Frauen die Welt der Mode für die oberen Zehntausend allein beherrscht: eben Coco Chanel und Elsa Schiaparelli. Sicher, der Zweite Weltkrieg und die deutsche Besatzung weiter Teile Frankreichs, einschließlich Paris, beendeten die „Années Folles“ endgültig. Doch der Krieg, nicht ohne Grund „der große Gleichmacher“ genannt, warf immerhin alle gleich weit zurück. Und wurde abgelöst von einer Nachkriegszeit, in der dann alle wieder mehr oder weniger bei null anfangen mussten.
Kurz nachdem Paris am 14. Juni 1940 gefallen und von der Wehrmacht besetzt worden war, reiste Schiaparelli nach New York und verbrachte dort – abgesehen von ein paar Monaten an der Seine im Jahr 1941 – die Zeit bis Kriegsende. Als sie zurückkehrte, hatte Christian Dior bereits seinen „New Look“ auf den Laufsteg gebracht, der sich von allem abgrenzte, was die Mode der Vorkriegszeit ausgemacht hatte. Im Jahr 1954 feierte Coco Chanel die Wiedereröffnung ihres Modehauses. Chanel sollte es gelingen, das Etikett des Gestrigen abzustreifen und ihre Mode als klassisch und zeitlos zu präsentieren. Elsa Schiaparelli fand keine stimmige Marktpositionierung mehr. Im Dezember desselben Jahres musste sie die Tore ihres Hauses endgültig schließen. Zu seinen besten Zeiten hatte es allein in Paris mehr als 4.000 Mitarbeiter beschäftigt. Nun war Schluss.
Über die Ursachen für dieses Aus lässt sich nur spekulieren. Zwei Gedanken drängen sich mir jedoch geradezu auf. Der erste: Ein gelungener Fake ist noch lange keine Garantie für dauerhaften Erfolg. Und der zweite: Wer seine Persönlichkeit zur Marke macht, der muss irgendwann lernen, über seinen Schatten zu springen. Elsa Schiaparelli hatte sich mit geschickter Selbstinszenierung und kalkulierter Provokation selbst in den Olymp der Mode katapultiert. Dabei hatte sie durchaus etwas zu bieten. Über ihre Bedeutung in der Geschichte der Mode gibt es keine zwei Meinungen. Mittlerweile haben einige der berühmtesten Museen der Welt ihrem Schaffen umfangreiche Retrospektiven gewidmet.
Doch Schiaparelli hat selbst einmal gesagt: „Sobald ein Kleid geboren ist, ist es auch schon Teil der Vergangenheit.“ Mode ist per Definition ephemeral – sie entsteht für den Augenblick und ist im nächsten Moment vergangen. Das heißt für Modeschöpfer: Es muss immer weitergehen, der Fluss der Ideen darf nie abreißen. Und bei allen von genialen Individuen gegründeten Marken in sämtlichen Branchen entsteht Konstanz eigentlich nur, wenn man irgendwann ein Team bildet. Um den Erfolg zu sichern, muss man bereit sein, ihn zu teilen; man muss delegieren, Dinge abgeben, viele andere einbinden. Gut möglich, dass einer Exzentrikerin und Egozentrikerin wie Elsa Schiaparelli dieser Schritt nie gelungen ist.
So machte es sich schließlich eine viel jüngere Generation zur Aufgabe, die Marke Schiaparelli am Leben zu erhalten. Im Jahr 2006 erwarb der italienische Unternehmer Diego Della Valle die Rechte. Sechs Jahre später begann Della Valle, der bereits die Marken Tod’s, Hogan und Fay aufgebaut hatte, mit dem Relaunch. 2015 wurde Bertrand Guyon zum Design Director ernannt, ein Mann Anfang 50 mit Halbglatze, gepflegtem Vollbart und zurückhaltendem Auftreten. Er arbeitet im selben Haus, in dem sich einst das Modehaus Schiaparelli befand. Und zwar in einem Studio, in dem „Shocking Pink“ und ähnlich indiskrete Farben um die Wette leuchten wie auf einem Rummelplatz. Seine Modenschauen inszeniert er gern in den prunkvollen Gängen der Opéra Garnier, die dafür in grellrosa Licht getaucht werden. Ob all dieses Rosarot wirklich reicht, um die Legende aufleben zu lassen, bleibt abzuwarten. Schockiert von der Signaturfarbe der Schiaparelli dürfte heute jedenfalls niemand mehr sein.
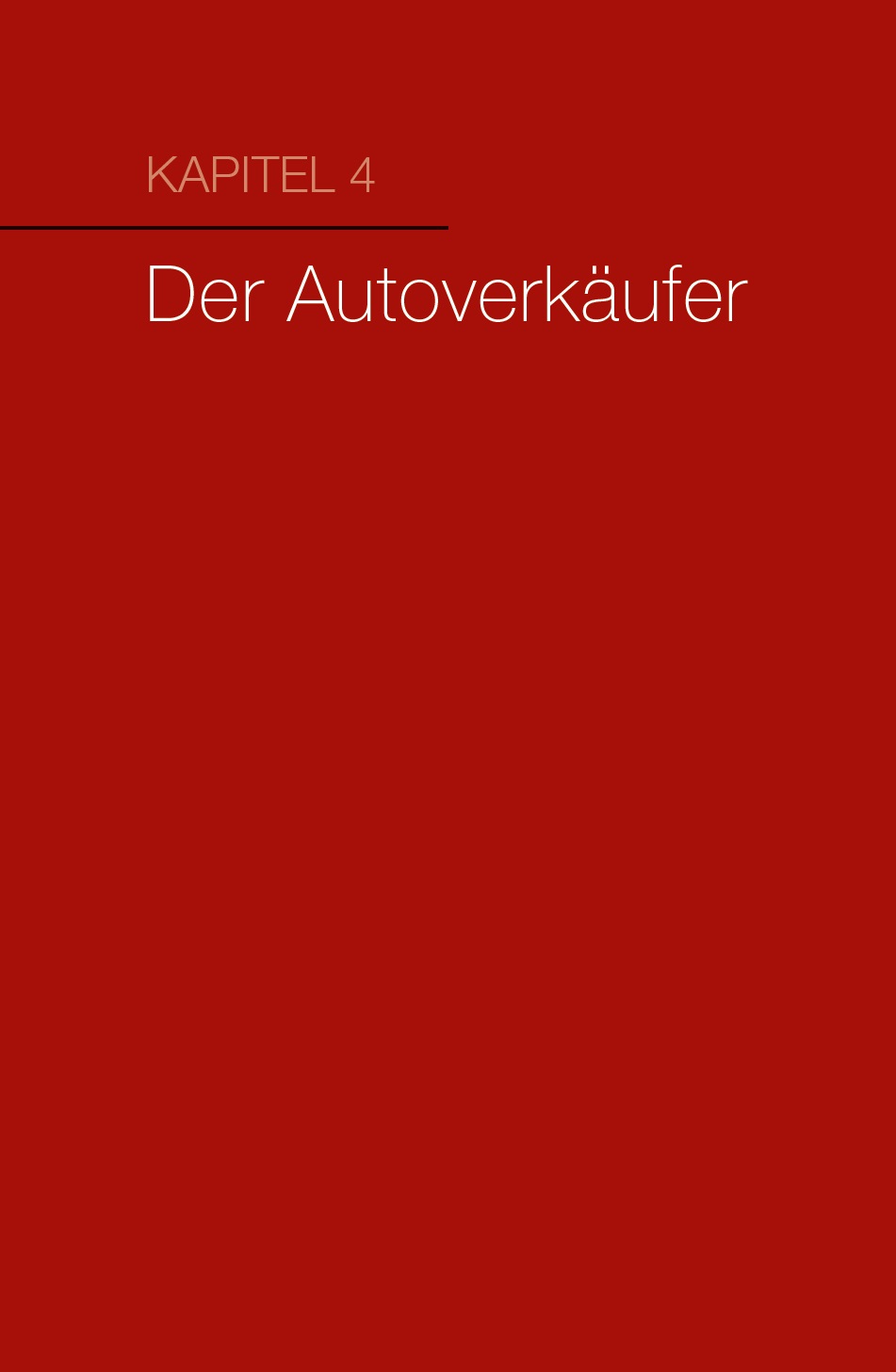

4 | DER AUTOVERKÄUFER
Wie viele Existenzgründer scheute auch ich zu Beginn meiner Selbstständigkeit das Risiko. Schließlich verfolgt Gründer eine Horrorstatistik in den ohnehin schlechten Schlaf, nach der zwei Drittel der Neugründungen nach drei Jahren wieder vom Markt verschwunden sein sollen. Ich lebte also bescheiden und hielt meine Kosten so gering wie möglich. Ein eigenes Büro sparte ich mir und arbeitete lieber von zu Hause aus. Mein erster Geschäftswagen war ein Kia: nicht schön, nicht repräsentativ, nicht einmal komfortabel auf langen Strecken, dafür aber günstig sowohl in der Anschaffung als auch im Unterhalt. Außerdem seitens des Herstellers mit ebenso umfassenden wie beruhigenden Garantieversprechen gesegnet. Deutsche Hersteller hatten solche Garantien nicht nötig, da ihnen die geneigte Kundschaft die Autos ohnehin aus den Händen riss. Die Fahrer eines Audi, BMW, Mercedes oder Volkswagen nahmen – und nehmen bis heute – sogar halbjährige Lieferfristen stoisch und ohne zu murren in Kauf.
Beim Koreaner kaufte man dagegen direkt vom Hof des Händlers. Dorthin hatten einen neben den erwähnten Garantien meist noch satte Rabatte oder nahezu zinsfreie Finanzierungsangebote gelockt. In der Ausstattung unterschieden sich die Modelle auf dem Hof ohnehin kaum. Die Lackfarben waren alle ähnlich fad. Kurzum: Wer mit Autos emotional eher wenig anfangen konnte und günstig mobil sein wollte, ohne ein großes Risiko einzugehen, der war hier genau richtig. Bei mir war das jedoch anders. Ich bin eigentlich ein ziemlicher Autofan, der zudem deutsche Ingenieurskunst in höchstem Maße zu schätzen weiß. Der „Reiskocher“ war eher eine Notlösung. Bei Kundenbesuchen wollte ich denn auch am liebsten nicht beim Ein- oder Aussteigen gesehen werden. Krankenhäuser als meine primären Beratungskunden waren insofern günstig, als ich mein Auto dort unauffällig auf den meist gut gefüllten Patienten- und Besucherparkplätzen abstellen konnte.
Mit meiner Selbstständigkeit war ich von Anbeginn erfolgreich. Doch dauerte es eine Weile, bis ich das selbst wirklich glauben konnte. Und es verstrich dann nochmals einige Zeit, bis ich Vertrauen in den dauerhaften Erfolg hatte und entsprechende Entscheidungen traf. Endlich war es dann aber so weit: Ich sah mich als erfolgreichen Selbstständigen und wollte das auch nach außen darstellen. Sie mögen mich nun als konventionell und angepasst schelten oder mir altmodisches Prestigedenken vorwerfen, doch zum Unternehmertum gehörte für mich unbedingt ein deutsches Qualitätsfahrzeug als Geschäftswagen. Also plante ich einen Besuch in einem Autohaus für Volkswagen und Audi in meiner Heimatstadt. Für Selbstständige sind solche Termine außer der Reihe meist schwierig im Kalender unterzubringen. Während einer Woche in den Sommerferien benötigten meine Projekte dann ausnahmsweise einmal etwas weniger Aufmerksamkeit. Also betrat ich eines Tages um die Mittagszeit – nicht frei von Stolz und mit einer gewissen Vorfreude, jedoch ohne vorab vereinbarten Termin – besagtes Autohaus.
Ein Auto ist für die meisten Konsumenten der teuerste Gebrauchsgegenstand, den sie anschaffen. Bedient zu werden, ist dennoch kaum irgendwo im Handel so sehr Glücksache wie bei einem Autohändler. Schauen Sie sich nur einmal die Kundenbewertungen auf Google zu beliebigen Autohändlern in Ihrer Umgebung an. Da wimmelt es nur so von Ein-Sterne-Rezensionen mit Kommentaren wie: „Wir wollten einen Neuwagen bestellen, aber niemand hat uns beachtet. Deshalb sind wir wieder gegangen.“ Wenn Sie eine Parfümerie betreten, werden Sie vom Verkaufspersonal geradezu bestürmt. Wenn Sie dagegen in ein Autohaus kommen, können Sie nie sicher sein, ob jemand Notiz von Ihnen nimmt. Dabei sind 100 Euro für ein Parfüm ja nichts gegen die 100.000 Euro für ein Auto, denen Sie sich heute schon in der oberen Mittelklasse zügig nähern, sofern Sie bei Motorisierung und Ausstattung aus dem Vollen schöpfen. So gesehen hatte ich mir das richtige Autohaus ausgesucht: Keine halbe Minute betrachtete ich interessiert eines der ausgestellten Fahrzeuge, da machte sich bereits ein junger Mann auf den Weg zu mir.