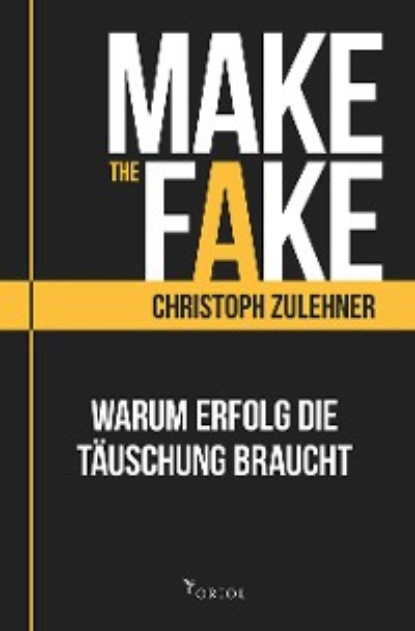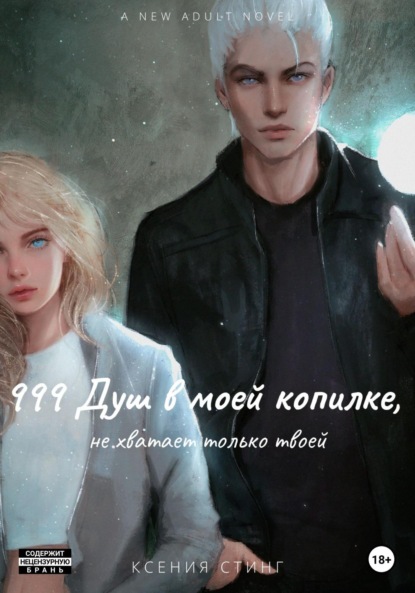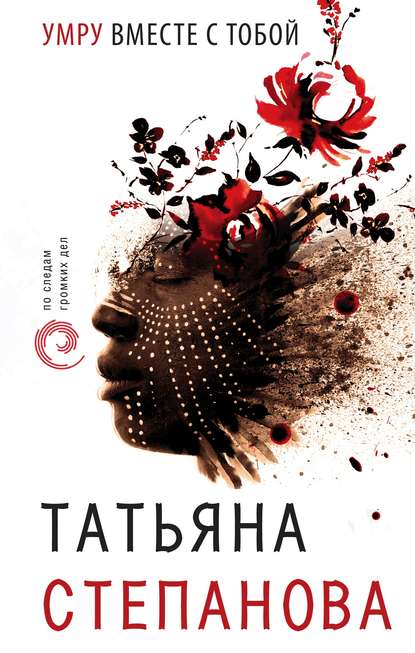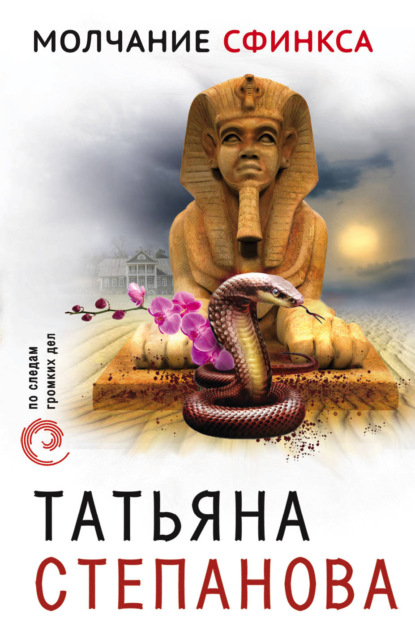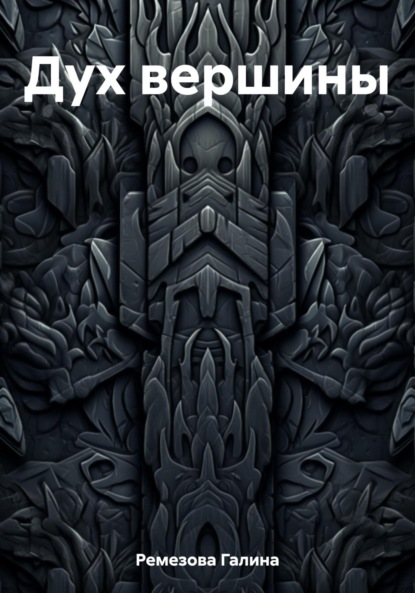- -
- 100%
- +
Also schlüpfte ich in die Rolle des Lehrers und agierte nach dem Motto: If you want to reach it, you´ve got to teach it. Die dafür vorgesehene Uniform – weiße Hose, weißes Hemd, weißer Mantel – gab mir das Gefühl, eine Ritterrüstung zu tragen, so sicher und geschützt fühlte ich mich darin. Mit dem weißen Mantel zog ich mein Selbstvertrauen an. Er war wie eine Maske für mich, hinter der ich mich leichter zu dem entwickeln konnte, der ich sein wollte. Mein damaliges Ziel – ein guter Lehrer an der Krankenpflegeschule zu werden – blieb hinter dieser Maske verborgen. Meine Botschaft an meine Schüler war nicht: Seht her, ich werde irgendwann einmal ein guter Lehrer sein. Sondern meine Botschaft lautete: Seht her, ich bin ein guter Lehrer. Ich habe das drauf, was ihr lernen wollt. Mein weißer Mantel ließ mich fast vergessen, wie leuchtend grün ich hinter den Ohren noch war.
WER KEIN EXPERTE IST, BEKOMMT KEINEN FUSS MEHR AUF DEN BODEN

Der Fake an sich ist keine neue Erfindung. Seit jeher geben Menschen vor etwas zu sein, wovon nicht sicher ist, ob sie es einlösen können. Die Inszenierung hat nicht Shakespeare erfunden, sondern ein Mensch, der in seiner Umgebung eine bestimmte Rolle einzunehmen hatte. Auch umgekehrt war es schon immer so: Menschen haben anderen Menschen aufgrund dieser Inszenierung Vertrauen geschenkt. Die Kulturtechnik Fake besteht aus dem Wechselspiel von Zutrauen und Vertrauen. „Der wird das schon richtig machen, immerhin ist er der Arzt!“ „Ihr vertrauen wir, sie ist die Staranwältin!“ „Auf ihn verlassen wir uns, er ist der Kapitän!“ „Sie ist die beste Projektmanagerin, die es für dieses Vorhaben gibt!“
Zu diesem Schein gehören übrigens nicht nur die entsprechende Kleidung und vielfältige Statussymbole, sondern auch ganz bestimmte Rituale. Wer beispielsweise in einer Arztpraxis lange im Wartezimmer gewartet hat, schließlich ins Arztzimmer gebeten wird und noch einmal warten muss, bis der Arzt dann endlich auch erscheint, der fühlt: Ich bin hier nicht der Maler, sondern die Leinwand. Gleich ist es so weit, der Herr Doktor kommt. Er schenkt mir seine wertvolle Zeit. Nur er kann mir helfen!
Zum Fake gehören immer beide Seiten: einer, der dank seiner Uniform und seines Auftretens den Anschein erweckt, als könne er das, was er tut. Und einer, der dem Gegenüber mit dem richtigen Auftreten, dem richtigen Habitus, den richtigen Ritualen zutraut, das gut zu können, wofür er ihn braucht, ihn engagiert, sich ihm anvertraut. Verantwortungsgefühl auf der einen Seite, Vertrauen auf der anderen: Das ist der gesellschaftliche Nährboden für den Fake.
Unsere Arbeitswelt spezialisiert und subspezialisiert sich immer stärker. In meinem Bereich, dem Gesundheitswesen, ist das ganz offensichtlich. Vor wenigen Jahren gab es noch Allgemeinchirurgen oder Allgemeininternisten. Heute gibt es nur noch Kniechirurgen, Handchirurgen, Wirbelsäulenchirurgen, Rheumatologen, Kardiologen oder Nephrologen. Und das ist auch kein Wunder: Unser Wissen verdoppelt sich alle vier bis fünf Jahre. Nicht nur das der Mediziner, sondern auch das aller anderen Fachrichtungen. Als arbeitender Mensch haben Sie genau zwei Möglichkeiten: Entweder Sie verdoppeln Ihr Fachwissen ebenfalls alle vier bis fünf Jahre – zeigen Sie mir den, der das schafft, und ich gebe Ihnen einen aus! – oder Sie spezialisieren sich.
Je mehr wir uns also in Richtung einer Dienstleistungsgesellschaft entwickeln, die von Wissen lebt, umso mehr sind wir gezwungen, zu Spezialisten für unsere Fachgebiete zu werden. Und diese Spezialisierung mündet letztendlich in die Expertise.
Wer sich spezialisiert, kommt früher oder später zwangsläufig an den Punkt, an dem er die Fahne hochzieht, auf der steht: „Ich bin Experte!“ Diese Expertenbeflaggung ist nicht nur als Signal für Arbeitgeber oder Kunden wichtig. Sondern auch als Signal an Kooperationspartner. Denn Spezialisierung geht automatisch mit Kooperation einher. Je allgemeiner ich tätig bin, je mehr Fähigkeiten ich selbst bis zu einem gewissen Grad abdecken kann, weil mein Business nicht so sehr in die Tiefe geht, desto weniger muss ich mit anderen kooperieren. Je spezialisierter ich allerdings arbeite, desto mehr muss ich kooperieren, mich mit anderen koordinieren – und akzeptieren, dass ich mich in Ko-Kompetenz mit anderen befinde.
Das heißt wiederum: Ich muss mich aus der Deckung trauen. Ich muss die Fahne hochziehen und mich als Experte oder Spezialist für dieses oder jenes Fachgebiet sichtbar machen. Und ich muss Kulturtechniken entwickeln, um mich als Spezialist oder Experte zu präsentieren und in diesem Feld zu bewegen – damit andere auf mich aufmerksam werden und auch wissen, wofür ich Experte bin. Selbstvermarktung ist die Devise. Und sobald ich das tue, beginnt der Fake.
Der Fake ist so etwas wie die Vertriebstechnik des Experten. Er dient dazu, die im Entstehen befindliche Expertise an einer Person zu „befestigen“. Wer sich auf dem Arbeitsmarkt behaupten will, der kann gar nicht anders, als zu einem gewissen Zeitpunkt ein Faker zu werden. Der eine früher, der andere später. Es gibt keine Alternative zum Fake. Jedenfalls ist mir keine bekannt. Der Fake macht Karrieren. Er ist keine hinreichende, aber eine notwendige Bedingung des Erfolgs. Er ersetzt nicht die Qualifikation – das wäre Hochstapelei. Doch er schafft die Voraussetzungen dafür, dass die Qualifikation überhaupt zum Tragen kommt. Das gilt übrigens branchenunabhängig. Ganz egal, wo Sie hinschauen, ob in der IT, in der Medizin, bei Steuerberatern oder auch den Rechtsanwälten: All diese Berufsbezeichnungen gibt es in ihrer ursprünglichen Form kaum noch. Dafür gibt es heute: Verkehrsrechtsexperten, Strafrechtsexperten, Scheidungsexperten und Zivilrechtsexperten. Nicht anders in den nichtakademischen Berufen: KFZ-Mechaniker? Das ist so letztes Jahrtausend! Heute gibt es Automobil-Mechatroniker für Personenkraftwagentechnik, Nutzfahrzeugtechnik, Motorradtechnik, System- und Hochvolttechnik oder Karosserietechnik.
Ganz gleich, in welcher Branche Sie sich umschauen: Experten, soweit das Auge reicht.
Besonders ausgeprägt ist der Expertenwahn in der Berater- und Coaching-Branche. Weil es heute nun mal nicht ohne geht, durchlaufen alle Berater und Coaches Positionierungsworkshops, entwickeln ihre Ich-Marke und werden dann Experte für Kundenbegeisterung, Experte für Körpersprache, Experte für Selbstoptimierung, Experte für krause Ideen oder Experte für den Weg zurück. Geben Sie bei Google einfach mal „Experte für“ als fest vorgegebene Wortfolge ein – Sie werden staunen, was Ihnen die Suchmaschine alles als Ergänzung anbietet. Ich versichere Ihnen: Die Beispiele, die ich Ihnen hier schon genannt habe, gehören noch zu den geläufigeren Varianten!
Der Zwang, als Experte auftreten zu müssen, hat einer anderen Spezies fast schon die Existenzberechtigung geraubt: Ist Ihnen schon mal aufgefallen, dass man sich als Generalist zusehends verdächtig macht? Wer heutzutage von sich behauptet: „Ich bin in vielen Bereichen einsetzbar und habe breites Wissen in mehreren Fachgebieten“, der erntet bestenfalls ein Kopfschütteln. Einer, der alles kann? Das ist doch unseriös! Jemand, der sich dagegen hinstellt und behauptet „Ich bin Experte für Spielsucht“, dem glaubt man sofort. Kaum fällt das Wort „Experte“, bleiben alle Hinterfragungsmechanismen in den Köpfen der Menschen untätig.
Schalten Sie einfach eine beliebige Talkshow ein: Stets tauchen passend zur Nachrichtenlage wie aus dem Nichts Experten für Nahostkonflikte, Flüchtlingsströme und Klimakatastrophen auf, die dann innerhalb einer Talkshow noch mehrmals umbenannt werden. Wer in der Vorstellungsrunde noch Theologe genannt wurde, wird im weiteren Verlauf der Sendung erst zum Theologie-Historiker, dann zum Kirchenhistoriker und schließlich auch noch zum Bestseller-Autor.
Und spätestens mit dieser planmäßigen Anmaßung ist die Grenze vom Fake zur Hochstapelei überschritten. Ich empfinde das als Geschmacklosigkeit, die mit der Kulturtechnik des Fakens nichts mehr zu tun hat. Ein Mensch, der bewusst mit diesem Thema umgeht und den Fake als etwas sieht, das ihm hilft, sein Potenzial zu entfalten, würde gegen diese Untugend vielmehr Sturm laufen. Er würde sich dagegen wehren, von einer Fernsehredaktion fünf verschiedene Rollen innerhalb einer Sendung zugeschrieben zu bekommen – nur weil vielleicht irgendeine Regel besagt, dass eine Expertenbezeichnung nur jeweils einmal eingeblendet werden darf und je nach Kontext anzupassen ist. Ein aufrichtiger Faker bleibt bei seiner Expertise. Er hat ja keinen Minderwertigkeitskomplex auszugleichen, sondern einen Ruf als Experte zu verteidigen.
Die Folge der zugespitzten Spezialisierung am Arbeitsmarkt, die durch die Medien und die sozialen Medien noch beschleunigt wird: Wer heute kein Experte für irgendwas ist, bekommt keinen Fuß mehr auf den Boden. Und wer Experte sein will, muss sich auf das Spiel mit dem Fake einlassen. Sicher, Sie können sich dem entziehen. Doch dann berauben Sie sich vieler Karriereoptionen.
LÜGENSUCHT IM DIENSTE DER ICH-ERHÖHUNG

Einer der bemerkenswertesten Unterschiede zwischen einem Hochstapler und einem Faker liegt für mich darin, dass ein Hochstapler niemals von sich selbst überrascht sein kann.
Der Hochstapler täuscht ja keine Expertise vor, um sich selbst weiterzuentwickeln, sondern um seinem Narzissmus zu frönen. Er muss seinen Drang befriedigen, andere Menschen zu kontrollieren. Er will seine Größenfantasien ausagieren.
Der Faker hingegen zeigt ein echtes Bemühen, hinter seiner Maske inhaltlich dem zu entsprechen, was die Maske tatsächlich vorgibt. Das führt natürlich auch immer wieder dazu, dass er sich selbst beflügelt, selbst motiviert – und am Ende selbst darüber staunt, was er zu leisten imstande ist.
Der Hochstapler kann sich am Ende nur sagen: „Wie großartig bin ich, dass sie mir alle glauben!“ Der Faker hingegen kann sich ehrlich freuen, dass er – entgegen seinen Befürchtungen – tatsächlich zu dem in der Lage ist, was er erreichen will.
Glauben Sie mir: Niemand hätte überraschter darüber sein können als ich selbst, als es mir gelungen war, während meines ersten Nachtdienstes meine kollabierte Patientin am Leben zu erhalten. Und meine Freude war unbändig! Es ist die Dynamik von Zweifel und Erfolgserlebnissen, die den Weg des Fakers so spannend macht.
Der Hochstapler Gerd Postel hingegen zog seine Befriedigung daraus, dass er, der gelernte Postbote, Dutzende Doktoren und Professoren in Bewerbungsverfahren auszustechen vermochte und den begehrten Posten des Oberarztes ergattern konnte. Der Titel seines Bewerbungsvortrags lautete übrigens: „Die pseudologia phantastica – die Lügensucht im Dienste der Ich-Erhöhung – aus der psychoanalytischen Diagnostik am literarischen Beispiel der Figur des Felix Krull“.
Der Hochstapler referiert über den Hochstapler, um zum Zug zu kommen. Ein gewisses Stilbewusstsein ist dem Mann nicht abzusprechen.
Genauso wenig wie dem Schriftsteller Neil Gaiman, der sich am Beginn seiner Laufbahn als weltberühmter und vielfach preisgekürter Autor hart an der Grenze zwischen Fake und Hochstapelei bewegte. In einer Rede vor Absolventen der University of the Arts Philadelphia berichtete Gaiman, wie er an seine ersten Aufträge kam:
„Ich tat etwas, das heute leicht zu prüfen ist und mich in Schwierigkeiten bringen würde, doch damals erschien es mir als vernünftige Karrierestrategie: Wenn ich von Redakteuren gefragt wurde, für wen ich gearbeitet hatte, log ich. Ich zählte eine Handvoll Magazine auf, die naheliegend klangen, und klang dabei selbstbewusst und bekam Aufträge. Anschließend machte ich es zu einer Frage der Ehre, tatsächlich für jedes dieser Magazine etwas zu schreiben, die ich aufgelistet hatte, um diesen ersten Job zu bekommen. Ich hatte also nicht wirklich gelogen, ich war nur chronologisch verwirrt gewesen.“
Er ist geständig. Es sei ihm vergeben. Er wusste es nicht besser. Bitte verstehen Sie die Tatsache, dass ich es hier erwähne, nicht als Karrieretipp – sondern als Beweis dafür, dass selbst die ganz Großen in ihrem Geschäft nicht ohne eine Strategie groß geworden sind. Neil Gaiman hat sich der Mittel des Hochstaplers bedient, aber seine Intention war die des Fakers: Er wollte etwas ausstrahlen, um es dann tatsächlich werden zu können.
Sie brauchen solche Tricks nicht. Sie haben dieses Buch.
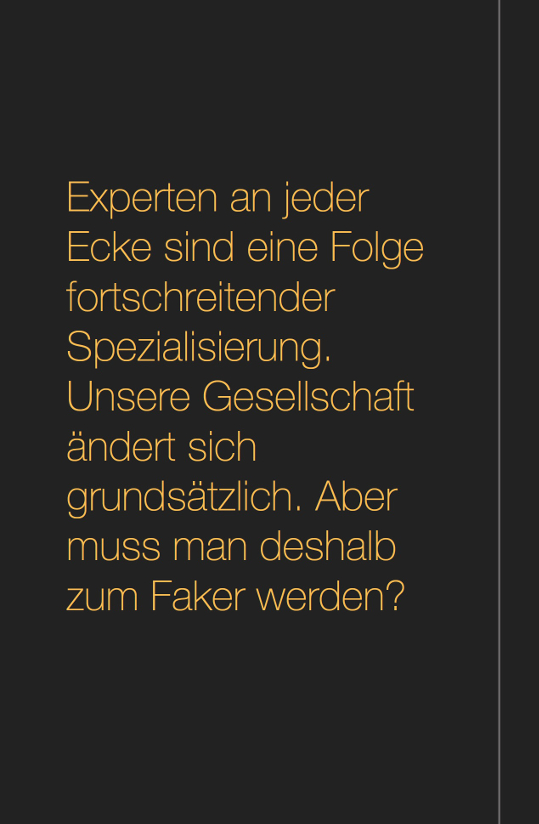
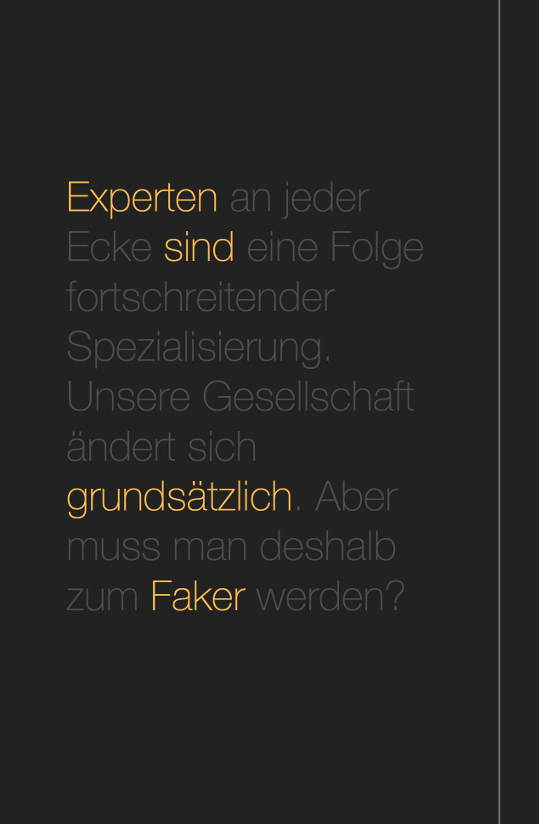

BERATER BERATEN BERATER: EINE WELT VOLLER EXPERTEN
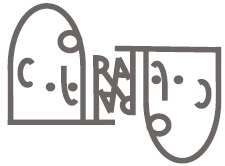
Stanford University 1998. Zwei Studenten gründen ein Unternehmen. Ihr Produkt: eine Software, mit der sich Geld zwischen den ersten Smartphones überweisen lässt. Sie sind damit so erfolgreich, dass sich ihr Unternehmen zu einem Spezialisten für Online-Bezahlsysteme entwickelt. Es fusioniert mit einem weiteren Anbieter für Payment-Lösungen. In den Jahren des Aufbaus wächst ein Netzwerk aus kreativen und intelligenten Menschen, die sich aus Vorlesungen und Wohngemeinschaften kennen und nun zusammen arbeiten. Sie entwickeln gemeinsam eine ganz eigene Art der Gemeinschaft, des Miteinanders, der Verschworenheit. Sie sind Investoren des neugegründeten Unternehmens, Executive Vice President, Designer, Ingenieur, Chief Operating Officer, Marketingdirektor, Finanzchef und Vice President Engineering. Nur vier Jahre später bringen die Gründer das Unternehmen an die Börse – und Ebay kauft es für 1,5 Milliarden Dollar. Seine Gründer und die Mitarbeiter der Anfangszeit sind nun reich – und steigen nach und nach aus dem Geschäft aus. Sie gründen andere Unternehmen wie LinkedIn, Youtube, Eventbrite, Yelp, Tesla Motors. Sie bleiben sich innerhalb ihres Netzwerks verbunden, sitzen in den jeweiligen Verwaltungs- und Aufsichtsräten, bringen sich als Investoren ein. Sie sind so erfolgreich, dass sie ihre Start-ups für Milliardenbeträge an die Tech-Giganten des Silicon Valley verkaufen können: Microsoft, Google, Facebook – nur um sich weiteren neuen Ideen, Projekten, Firmen zu widmen, die sie zum Teil gemeinsam gründen, fördern, nach oben bringen.
Sie ahnen wahrscheinlich schon längst, welches Netzwerk ich hier beschreibe – es ist die „Paypal-Mafia“. Entstanden aus der Keimzelle der Paypal-Gründer Peter Thiel, Max Levchin, Elon Musk und wichtigen Mitarbeitern der Anfangsjahre bei Paypal, wird dieses Netzwerk gerne als Parallel-Universum und Gelddruckmaschine bezeichnet. Sicherlich gehören ihm die klügsten Denker und erfolgreichsten Unternehmer des Silicon Valley an: Jeder für sich ist genial, alleine waren sie nichts, zusammen sind sie alles. Ein Netzwerk aus Experten, die sich gegenseitig beflügeln, unterstützen und fördern. An der ersten Hollywood-Produktion, die uns die Figuren, die Geschichten und die Glorie, aber auch die Intrigen und Grabenkämpfe hinter den Kulissen zeigt, wird bestimmt schon geschrieben – aber bis dahin nehme ich die Paypal-Mafia gerne als Beispiel für ein Experten-Netzwerk der Superlative!
FROM PICKS TO BRICKS TO CLICKS
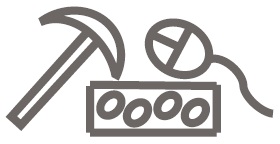
Der Erfolg der Experten-Netzwerke – er wäre nicht denkbar ohne den Faktor Wissen. Er ist der wichtigste Produktionsfaktor unserer Arbeitswelt, und für die Zukunft wird der „Wissensarbeit“ sogar ein weiterer steiler Aufstieg vorausgesagt. Das war nicht immer so. From picks to bricks to clicks – unser Zusammenleben hat sich von der Agrargesellschaft über die Industriegesellschaft bis zur Wissensgesellschaft entwickelt. In der Agrargesellschaft bildeten Werkzeuge die Grundlage allen Tuns (picks). In der Industriegesellschaft waren es die Fabriken und Industriebauten aus Backstein (bricks). Und in der heutigen digitalen Welt wird alles per Mausklick gesteuert (clicks). Waren in der Agrargesellschaft der Grund und Boden sowie die harte körperliche Arbeit der Menschen die entscheidenden Produktionsfaktoren, so wurden es in der Industriegesellschaft das Kapital, die Maschinen und die hohe Anzahl von Menschen. Heute ist es das Wissen. Es ist der wichtigste Produktionsfaktor der digitalisierten Welt. Um 1850 arbeiteten 70 Prozent der Menschen in der Landwirtschaft, 20 Prozent in der Industrie und 10 Prozent im Bereich der Dienstleistungen – so eine Statistik des französischen Ökonomen Jean Fourastié. Er prognostizierte für das Jahr 2050, dass sich dieses Verhältnis umgekehrt haben würde: 70 Prozent der Menschen sollten dann im Dienstleistungsbereich arbeiten, 20 Prozent in der Industrie und 10 Prozent in der Landwirtschaft. Bereits heute sieht die Situation deutlich anders aus als vorhergesagt: 75 Prozent der Menschen arbeiten in der Dienstleistung, nur noch 1,8 Prozent in der Landwirtschaft. Irgendwo dazwischen liegt der Anteil der Menschen, die in der Industrie arbeiten. Die Prognose von Fourastié wurde also mehrere Dekaden früher erfüllt.
Die Entwicklung unserer Gesellschaft von der Agrar- zur Dienstleistungsgesellschaft hat ganz unterschiedliche Konsequenzen nach sich gezogen. So hat sich unser Wissen exponentiell vermehrt – und es geht immer so weiter. Derzeit verdoppelt es sich ungefähr alle drei bis sieben Jahre. Dafür gibt es mehrere Indikatoren. 1963 quantifizierte der Professor für Wissenschaftsgeschichte und Mitbegründer der Szientometrie, Derek John de Solla Price, das Wissen unserer Gesellschaft anhand der Anzahl der wissenschaftlichen Originalpublikationen. Damals verdoppelte sich das Wissen noch alle 15 Jahre. Mittlerweile sind etliche andere Indikatoren gebräuchlich, um das Wissen der Menschheit zu ‚vermessen‘: die Anzahl der Patente und Erfindungen, der Informationsgehalt des Internets, die Kapazität von Speichermedien, die Anzahl der Beschäftigten mit wissenschaftlich-technologischer Ausbildung und viele mehr.
Alles zusammengenommen lässt sich klar feststellen: Wissen ist in der modernen westlichen Welt der Produktionsfaktor Nummer eins. Doch so sehr wir uns auch bemühen und so leicht uns Algorithmen das Vermessen von Klicks vermeintlich machen: Was wir heute als „Wissen“ bezeichnen, ist wesentlich schwerer zu quantifizieren und vor allem viel schwerer in seiner Substanz zu bewerten als Ziegel und Werkzeuge. Und vor allem: Das sogenannte „kollektive Wissen“ hat als wissenschaftliche Größe immer einen gewissen Beigeschmack. Denn kein Mensch kann sein eigenes Wissen exponentiell vervielfältigen, geschweige denn alles wissen. Solange wir nicht alle eine LAN-Klinke im Hinterkopf haben wie Neo in „Matrix“, ist vorhandenes Wissen noch längst nicht gleichwertig mit individuell verfügbarem Wissen.
Bleibt die Frage: Wie viel ist unser Wissen tatsächlich wert, und: Wie schlau sind wir, als Einzelner, denn eigentlich wirklich?
KEINER KANN ALLES WISSEN

Aus der Übermacht des Wissens als Produktionsfaktor der modernen Welt ergeben sich verschiedene Informationsasymmetrien. Zunächst in der Beziehung zwischen Leistungsanbietern und ihren Kunden: Anbieter und Dienstleister wissen deutlich mehr als die Kunden. Sie sind die Experten, egal, ob es sich um Versicherungsverträge, Finanzprodukte oder andere wissensbasierte Produkte oder komplexe Themen handelt. Der Dienstleister ist der Spezialist. Das bedeutet zunächst: Eine Geschäftsbeziehung kommt nur zustande, wenn die Kunden den Anbietern vertrauen – und sich in ein Abhängigkeitsverhältnis begeben. Durch die Wissensexplosion betrifft diese Asymmetrie des Wissens aber nicht mehr nur die Beziehung zwischen Anbietern und Kunden, sondern auch die Beziehungen zwischen Anbietern und Anbietern. Denn mit dem Wissen haben sich auch die Anwendungsgebiete des Wissens vervielfacht – und die Notwendigkeit, je nach Tätigkeit und gesellschaftlicher Position auf viel mehr Wissen zuzugreifen. Ein Beispiel: Früher musste ein Handwerker in seinem Fach gut sein – der Rest war Mundpropaganda und Bedarf. Heute muss sich ein Handwerker auch in vielfältigen wirtschaftlichen Belangen auskennen und sich gegen gestiegene (internationale) Konkurrenz positionieren. Außerdem muss er verkäuferisches Talent haben, um sich im Wettbewerb durchzusetzen. Am besten betreibt er sogar einen themenverwandten Online-Shop oder bietet mindestens einen elektronischen Terminbuchungsservice an. Selbst Markenkommunikation ist ihm im Idealfall nicht fremd. Und Social-Media-Experte sollte er natürlich auch sein, sowieso, ist ja klar.
Wer ist in so vielen Gebieten Experte? Welcher Handwerker ist nebenbei Verkaufs-, Marketing- und Social-Media-Profi? Genau: So ungefähr keiner. Der Markt verlangt das aber, wenn er auf seinem Gebiet was gelten will. Folge: Der Handwerker muss irgendwie das Wissen anderer anzapfen. Und so geht es beileibe nicht nur unserem Handwerker, sondern – uns allen. Mehr oder weniger. Die Wissensgesellschaft macht vor allem eines sehr deutlich: die individuellen Wissensmängel. Was wir als Einzelne wissen, bemisst sich am Ende ja nicht an der Menge von Informationen in unserem Kopf – sondern im Verhältnis zu allem Wissen, das wir kollektiv als Menschheit angehäuft haben. Ob der Einzelne in dieser Gleichung heute wirklich besser dasteht als vor 100 Jahren?
Das Dilemma des Handwerkers trifft jeden, der wirtschaftet. Die Komplexität des B2B-Wissensmarkts wächst und wächst deshalb. Je größer das Unternehmen, desto größer die Notwendigkeit des Wissenstransfers von Anbieter zu Anbieter. So haben Projektorganisationen in großen Unternehmen eigene Anwälte, die sich auf die spezifischen Belange der jeweiligen Industrie spezialisiert haben. Die Anwälte aus der „normalen“ Rechtsabteilung des Unternehmens können das dafür notwendige Wissen oft nicht mehr bieten – sie sind nicht „spezialisiert“ genug. (Wären sie es, würden sie ihre Kompetenz höchstwahrscheinlich als selbstständige Spezial-Anwälte teuer verkaufen …) IT-Abteilungen brauchen Experten für Data Mining, die wissen, wie man aus den gesammelten Daten verwertbare Informationen macht. Manager brauchen Experten, die ihnen sagen, ob die Strategie, die sie sich ausgedacht haben, auch technisch möglich und rechtlich erlaubt ist.
In meinem eigenen Fachgebiet, dem Gesundheitswesen, sind die „Onko-Boards“ ein typisches Beispiel. Diese Onko-Boards gibt es in den meisten Kliniken, in denen Krebspatienten behandelt werden. Bei diesen Meetings treffen sich beispielsweise Chirurg, Onkologe, Strahlentherapeut, Psychoonkologe und weitere Experten und beraten gemeinsam, wie ein bestimmter Patient zu behandeln ist. Fachübergreifend. Denn komplexe Themen lassen sich heute nur noch lösen, wenn sich verschiedene Experten untereinander abstimmen. Experten haben zwar ein enormes Wissen in ihrem Segment – aber weil sich Wissen so stark vermehrt hat und sich immer weiter vermehrt, können sie nicht mehr im Detail wissen, was in den Segmenten der anderen Experten gerade tagesaktuell stattfindet. Ein Chirurg beispielsweise kennt die neuesten OP-Methoden. Er weiß aber nicht im Detail, was sich im Bereich der Chemotherapien tut. Er hat auch keine Kapazitäten mehr, um sich in diesem Gebiet – und all den Hunderten anderen medizinischen Spezialgebieten – auf dem jeweils neuesten Stand zu halten. Das heißt: Je mehr er sich in sein Gebiet vertieft, desto mehr muss er darauf verzichten, Know-how in anderen Bereichen aufzubauen. Damit beispielsweise eine Klinik Patienten erfolgreich behandeln kann, sind ihre Experten darauf angewiesen, ihr Wissen untereinander zu teilen und gemeinsam über die Behandlung des Patienten zu entscheiden. Je komplexer das Krankheitsbild, desto mehr. In dieser Hinsicht sind sie voneinander abhängig.
Bei den Onko-Boards und jedem anderen professionellen Wissenstransfer geht es um das Teilen von Wissen – aber es geht hier auch um Vertrauen. Ein Experte muss darauf vertrauen, dass die anderen Experten sich ebenfalls mit einbringen, um ein Problem möglichst gut zu lösen. Und er muss auch darauf vertrauen, dass alle anderen, die sich Experten nennen, auch wirklich auf dem neuesten Stand des Wissens in ihrem Teilgebiet sind. Überprüfen kann er das nämlich nicht. Dazu müsste er Experte auf deren Gebiet sein.