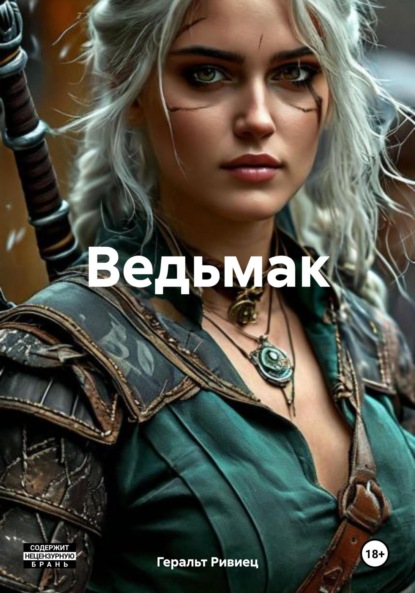- -
- 100%
- +
Als er in eine Nebenstraße abbog, traf er auf Se. Se war ihr Pseudonym für die internationale Presse, seit sie die Führung im Ärztekomitee übernommen hatte. Sie war alleinstehend und hatte keine eigene Familie. Sie war jung, klein und etwas dicklich. Es sah lustig aus, als die beiden, er der Hüne und sie die kleine Runde, nebeneinander herliefen. Sie war mit kurzen Beinen geboren worden, die zueinander standen wie ein X. Doch das machte ihr nichts aus. Denn sie verzauberte die Menschen mit ihrem gewinnenden Lächeln und ihrem lauten fröhlichen Lachen. Rocco mochte sie. Sie war straight und zupackend und eine wertvolle Kollegin.
Weil sie den gleichen Weg hatten, hatten sie beschlossen, gemeinsam zur Demonstration zu gehen. Aber Rocco war am verabredeten Punkt nicht rechtzeitig erschienen, daher freute er sich, auf dem Rückweg auf sie zu treffen. »Meine Jüngste hat Fieber«, sagte er etwas tonlos als späte Erklärung. Se nickte nur. Sie beide hatten die Vorfälle während der Demo mitgenommen. Ses kurzes lockiges Haar stand zu allen Seiten ab, sie hatte Spuren von Dreck im Gesicht und Rocco hatte einen aufgeschürften Arm, weil er von einer fliehenden Menschenmasse ein paar Meter mitgerissen und gegen eine Wand gepresst worden war. Dieser Tag war kein Erfolg für ihre Bewegung im Sudan.
Schweigend schlurften die beiden Aktivisten über die staubigen Straßen. Rocco sah Se an. Sie ahnte, welche Frage er stellen wollte, und sie schüttelte nur ihren Kopf. Sie hatte das Katz-und-Maus-Spiel nicht geplant und wie es hatte passieren können, erfuhr auch sie nicht. Es war beeindruckend gewesen, doch das Ende war so schockierend, dass sie beide keine Lust hatten zu sprechen, Spekulationen auszutauschen, Meinungen einzuholen oder das Desaster schönzureden. Weswegen Schweigen eine gute Einigung war.
Sie bogen in die Straße ein, in der Rocco mit seiner Familie wohnte. Es war kein kleines Haus, auch das Grundstück war recht groß. Eine hohe Mauer schützte die Liegenschaft und die Familie, die darin wohnte, vor Dieben, Entführern, Mördern. Die Mauer krönten Stacheldraht und Kameras. Er lächelte. Wieder einmal geschafft, zurück in seiner Zuflucht.
Noch zehn Meter bis zu Hause. Er nahm Se in seine Arme, drückte sie. Sie wohnte ein paar Straßenzüge weiter entfernt. Ein kurzer Weg. Er konnte sie ungefährdet gehen lassen. Rocco wandte sich ab und seinem Heim zu. Er freute sich auf seine Frau und seine beiden Kinder, dann trat er auf die Eingangstür zu und auf etwas, das aussah wie eine plattgetretene Dose Cola, aber von silbriger Farbe. Die Straße war sandig, nur deshalb fiel es ihm auf, es fühlte sich nicht mehr sandig unter seinem rechten Fuß an, da war etwas Festes.
Rocco sah nach unten auf seine Schuhe. Das Ding war nicht länglich, es war rund, kreisrund, es glänzte und er war darauf getreten. Er wusste, was das bedeutete. »Se, lauf!«, schrie er und in diesem Moment, er hatte den Fuß leicht anheben wollen, explodierte die Tretmine.
Se war schon einige Meter vorausgelaufen, als er rief, warf sie sich auf den Boden. Sie bekam nichts ab, doch Rocco spürte einen plötzlichen Ruck durch seinen Körper fahren. Eben noch hatte er die Freude, es weitgehend unverletzt von der Demonstration nach Hause geschafft zu haben, verspürt sowie die Vorfreude darauf, seine Frau, seine Kinder im Arm zu halten und ihnen von den schrecklichen Geschehnissen zu erzählen. Er spürte den Schmerz nicht, als er von den Füßen gerissen und durch die Luft geschleudert wurde. Er landete einige Meter entfernt, noch bevor er realisierte, dass er nicht mehr stand. Der Schreck ließ ihn nur starr werden und mit Mühe richtete er seinen Blick an sich nach unten auf sein Bein, er sah ungläubig seinen Unterschenkel an seinem Knie baumeln, als gehörte er nicht zu ihm. Dass sich ein Stück seines Körpers ohne seinen Willen pendelnd bewegte, hielt ihm all die Fassungslosigkeit vor Augen, die mit der Starre seines Körpers gut harmonierte, denn er war zu einem tragischen Denkmal seiner selbst geworden.
Als nächstes schweifte sein Blick nach oben und er spürte einen beißenden Schmerz im rechten Arm. Durch den leicht zerfetzten Ärmel hindurch konnte er ihn nicht sehen, denn sonst hätte er bemerkt, dass nur die Röhre des Ärmels seinen zerstückelten Arm noch zusammenhielt.
Und dann kam er. Unter der darauf folgenden Welle des Schmerzes wurde er begraben wie ein untergehender Surfer.
Was dann folgte, erlebte er wie in einem Zeitraffer. Se lief zurück, erkannte sofort, was passiert war, und stoppte die Blutung des Beins notdürftig, indem sie sich ihre Jeans von ihren massigen Oberschenkeln quälte und mit einem Hosenbein seinen Oberschenkel abband, während sie Roccos Frau instruierte, die wegen des Knalls herausgehastet war, den Stumpf seines Arms mit seinem abgerissenen Hemdsärmel abzubinden. Seine beiden kleinen Kinder starrten ihren Papa mit weit aufgerissenen Augen von der Tür in der Grundstücksmauer an, als hätte er sich heute ein besonders bizarres Abenteuer für sie einfallen lassen.
Se rief die Ambulanz, die erstaunlich schnell kam. Andererseits war es nicht so erstaunlich, waren doch keine Rettungswagen bei der Großdemonstration gesehen worden. Die Krankenhäuser waren nicht überlastet, denn auf der Demo hatte man einfach sterben lassen.
Doch auch Rocco starb, kaum war er im Krankenhaus angekommen. Der Blutverlust war zu groß. Er war kurz bei Bewusstsein, während er panisch keuchend nach Sauerstoff schnappte, der ihm durch den Blutverlust im Körper fehlte. Se schrie die Kollegen in der Notaufnahme an und lief los auf der Suche nach Blutkonserven. Irgendjemand drückte ihm eine Atemmaske aufs Gesicht und presste Hände auf seine zuckenden Gliedmaßen. Er sah, wie seine Frau zur Seite gedrängt wurde, mit tränenüberströmtem Gesicht die Arme nach ihm ausstreckte, und er zog mit der unverletzten Hand die Maske herunter, lächelte sie an und flüsterte: »Ich liebe dich! Sag unseren Kindern, dass ich sie immer geliebt habe! Ich glaube, ich werde wieder …« Er brachte seinen Satz nicht zu Ende, denn sein Kopf fiel schlaff zur Seite, als ob er in dem fensterlosen Raum der Notaufnahme nach draußen in einen Himmel schaute.
Se stieß einen Schrei aus, als sie mit zwei Blutkonserven zurückkam, und boxte alle zur Seite, um eine Herzmassage zu beginnen. Die Kollegen ließen sie machen. Sie wussten, dass es sinnlos war. Rocco hatte sich verabschiedet. Nun kämpfte der Rocky des sudanesischen Volkes nicht mehr.
Gianna traf eine schmerzliche, aber gute Entscheidung. Rocco wurde zwei Tage später in einem anonymen Grab der Regierung beigesetzt, um Geld zu sparen, das sie dringend für ihre Kinder und sich benötigen würde. Sie war da und ihre Kinder nicht, als der Radlader die Leichen der Demonstranten und die ihres Mannes zusammenschob und in das Grab in fünf Metern Tiefe beförderte. Die Toten klatschten in der Grube wie nasse Säcke aufeinander. Das Geräusch war widerlich.
Die Hitze an diesem Tag war unerträglich und die feuchte Luft auch. Es stank. Die Leichen stanken – ein eklig süßlicher Geruch, der sich in die Schleimhäute einbrannte.
Se stand neben ihr, hielt ihre Hand und wusste nicht, ob das Attentat nicht eigentlich ihr gegolten hatte. Aber war das nicht egal in diesem Moment? Se spürte eine unabweisbare Sicherheit, während sie dem ›Begräbnis‹ zusah, dass al-Baschirs Zeit abgelaufen war, und ihre irgendwie auch. Als ob ihr Schicksal mit dem al-Baschirs zusammenhing. Vielleicht hatte Se gar nicht bemerkt, wie sehr sie ihr Leben dem Kampf gegen den Diktator verschrieben hatte. Als al-Baschir stürzte, übernahm der Cholesterinspiegel die Macht über ihren Körper und beförderte sie in ihre eigene kleine Hölle.
Aus eins mach zwei
Als sie wieder aufwachte, erschien der neue Tag unbenutzt in der Morgendämmerung. Sie spürte, genug geschlafen zu haben, ausgeruht zu sein, und blickte sich um. Ein Tag am ganz frühen Morgen auf dem Dach des Reichstages, vier Uhr oder fünf, aber keinesfalls sechs. Der Himmel war noch dunkelgrau, aber es war warm. So warm, wie sie die Luft in Berlin so früh am Tag nicht kannte. Sie vermutete bereits fünfundzwanzig Grad. Sie sah sich den Himmel genauer an. Sie kannte diese Art von Himmel, den sie sich tagelang angesehen hatte im Winter in diesem Raum mit dem Bett aus dickem Metallrohr, beleuchtet von Kälte. Solche Himmel wussten sich nicht zu entscheiden, was aus dem kommenden Tag werden sollte; schienen nicht zu wissen, ob die Sonne scheinen oder das wenig entscheidungsfreudige Grau sich zu Schwarz verändern und danach Regengüsse fallen lassen würde. Jenny war es immer gleich, wie sich der Himmel entscheiden würde. Sie liebte den Sommer, obwohl sie nur zweiundzwanzig davon erlebt hatte, aber nass zu werden machte ihr nichts aus.
Tückisch fand Jenny das Grau im Winter, wenn sie so darüber nachdachte. Denn dann fielen Schnee oder Regen. Den Schnee im Winter hatte sie immer gemocht, aber den Regen bei fünf Grad, der jede Haut durchnässte, nicht. Der graue Himmel im Winter war nicht kalkulierbar. Zum Fürchten konnte so ein Winter sein. Sie war in einem solchen nasskalten Winter gestorben.
Auf einmal fiel es ihr wie Schuppen von den Augen, dass sie nicht auf dem Dach des Reichstages geboren worden war, auch wenn es sich im Moment so anfühlte. Sie sah an sich hinunter. Ihre pinkfarbene Jeans, ihr weißes Top. Es gab ein Leben, bevor sie auf dem Dach des Reichstages gelandet war. Wer eigentlich war sie? Sie musste sich erinnern, unbedingt, sie wusste, dass das alles in ihrem Kopf gespeichert war. Es würde sie viel Mühe kosten, etwas scheinbar tief Vergrabenes an das Tageslicht ihres Bewusstseins zu befördern, das nicht grundlos in den Untiefen ihres Seins versteckt schien. Da war sie sich sicher. Denn warum war sie zurückgekommen in diese Welt, obwohl sie doch schon tot war? Dass sie eigentlich schon tot war, bewies ihr häufig wiederkehrender Traum. Der Findling. Ob sie den Traum schon gehabt hatte, als sie noch lebte? Aber sie lebte ja. Oder? Ach, es war alles wirklich sehr verwirrend!
In dieser Lage würde sie keine Antworten finden, sie musste einen anderen Weg suchen, am besten vom Dach des Reichstages herunter. Jenny lief eilig zu der Tür, die sie aber genauso verschlossen vorfand wie zuvor in der Nacht.
Sie trottete zurück zur steinernen Balustrade. Eine der Türen würde sich bald öffnen für die Besucher, da war sie sich sicher. So lange konnte sie warten und hockte sich hin. Sie hatte immer noch keinen Durst und keinen Hunger. Seltsam war das. Aber sie hatte Lust darauf, etwas zu schmecken. Das war nicht ganz, aber fast so wie Hunger.
Sie blickte auf die Straße und auf den Vorhof des Reichstages. Es gab da etwas in ihrer Wahrnehmung, das sie von ihrer Lust auf Geschmack völlig abbrachte. Die wenigen Menschen, die sie beobachtete, waren so weit da unten. Eigentlich war es unmöglich, ihre Stimmen zu hören. Aber sie hörte Stimmen von Menschen, die vereinzelt unterwegs waren. Meist waren es Jogger oder Gassigeher, die vielleicht irgendwo in der Nähe wohnten. Was sich die Herrchen, Frauchen und Jogger zu erzählen hatten, war um diese Uhrzeit weniger interessant, meinte sie. Aber ihre Sehnsucht nach Menschen trieb sie, zu verstehen, was diese Leute da unten sagten. Sie spürte ihren Hunger auf Menschen. Jenny konzentrierte sich auf die, die sie erkannte.
Interessiert beobachtete sie, wie der Verkehr zunahm. Von oben betrachtet sah der Straßenverkehr aus wie immer. Und wenn sie sich einen Jogger genauer ansah, hörte sie, was er nur für sich in Gedanken formulierte – es mussten seine Gedanken sein, denn es ergab überhaupt keinen Sinn und es gab ja keine Gesprächspartner. Völlig irre war das, fand sie. Konnte sie wirklich hören, was jemand anderes dachte? Oder sprach der Jogger vielleicht doch, während er lief? Doch die meisten Jogger waren zu schnell unterwegs, rangen um Atem und hatten nicht genug davon, um auch noch sprechen zu können. Sie konzentrierte sich auf andere Jogger und auf Gassigeher, und stellte fest, dass sie auch deren Gedanken hören konnte. Ja, das musste etwas Telepathisches sein oder so, denn für wirkliches Hören war sie doch viel zu weit weg!
Nach einer Weile sah sich Jenny gelangweilt auf dem Flachdach um. Es würde noch ein paar Stunden dauern, bis sich eine Tür öffnete, die ihr einen Weg nach unten ermöglichte. So lange musste sie einfach nur aushalten.
Inzwischen war es hell geworden, richtig hell und die Sonne schien. Jenny hielt ihr Gesicht in die Sonne, die sie schon zu früher Stunde intensiv wärmte, obwohl sie das Gefühl hatte, dass es zu viel von dieser Sonne gab. Gelegentlich sah sie sich um. Öffnete eine der Türen doch früher, als sie vermutete?
Jenny wandte sich um zur anderen Seite der Balustrade und verharrte mit einem staunend offenen Mund und kleinen Wellen auf der hochgezogenen Stirn. Sie hatte einen Mann entdeckt, der ungefähr fünfzig Meter von ihr entfernt vor der Balustrade des Reichstages saß. Da in der Nähe hatte auch sie ein paar Stunden zuvor gesessen, kurz vor einem Absturz war sie gewesen, bevor sie sich hinter das Geländer gerettet hatte.
Wie war er hier hergekommen? Die Türen zum Dach waren verschlossen. Und sie hätte ihn gesehen, sehen müssen, wenn er wie auch immer auf das Dach geklettert wäre. Doch warum sollte jemand auf das Dach des Reichstages klettern? Vielleicht wollte er sich umbringen und nun saß er da, unschlüssig, ob er es wirklich tun sollte.
Jenny rannte los, um den Mann zu retten. Rutschte er nur dreißig Zentimeter nach vorn, und dreißig Zentimeter waren nicht viel, würde er nach vorn kopfüber fallen und dann wäre er tot. Noch während ihres Sprints, ihre Augen immer aufmerksam auf den Abgrund jenseits der Fassade gerichtet, erkannte sie, wie groß der Mann war. Seine Haut war so schwarz, dass er sich wie ein dunkler Fels vom Blau des Himmels abhob und die Sonne seinen Körper fast glänzen ließ. Er saß einfach da und seine Beine baumelten spielerisch in der Luft.
Jenny erreichte ihn, er hatte sie nicht gesehen, sein Kopf bewegte sich nicht, er hätte ihre Schritte hören müssen, aber er sah starr in die Sonne. Sein Oberkörper schien aufgefaltet wie ein Sonnensegel, das Strahlung und Wärme tankte. Schon ein paar Meter vor ihm erkannte sie seine geschlossenen Augen.
Er bemerkte sie erst, als sie ihn schon erreicht hatte. Sie zog an seinen Schultern, versuchte, ihn auf das Dach zu zerren, da blickten sie riesige weiße Augäpfel aus einem pechschwarzen Gesicht an. Er widersetzte sich ihrem Zug – er hatte Bärenkräfte, die ihn immer weiter zum Rand des Dachs und nach unten ins Verderben zogen.
Jenny rief: »Stopp!« In diesem Moment neigte sich sein noch immer in die Sonne gerichteter Kopf nach unten, er musste die Tiefe des bevorstehenden Falls erkannt haben, denn er klammerte plötzlich seine Hände an ihre Arme. Er winkelte die Beine an und zog sich an ihren Armen festhaltend auf das Dach, bis seine Füße Halt fanden.
Sie wunderte sich über ihre Kräfte. Hatte sie die Zeit, von der sie nicht wusste, wie lang sie eigentlich gewesen war, in einer Muckibude verbracht und nicht in einem Sarg? Dass ihr das Gehirn diese ironischen Gedanken zuspielte, verschaffte ihr Erleichterung, in ihrer Situation der völligen Ungewissheit.
Als er endlich auf dem Dach lag und sie erleichtert ausatmete, betrachtete sie ihn, etwas nach hinten versetzt neben ihm liegend. Er war noch größer, als sie sich ihn vorgestellt hatte, und deswegen musste er auch schwer sein. Sein Gesicht war tiefschwarz, so ein Schwarz hatte sie an einem Menschen bislang nie gesehen. Doch eigentlich war er leicht gewesen, als sie an ihm gezogen hatte. Sonst hätte sie es nie geschafft, ihn vom Abgrund wegzuzerren.
»Danke«, sagte er mit einer tiefen Stimme, die seinem Dank wahre Glaubwürdigkeit verlieh.
»Ist mir eine Ehre«, entgegnete Jenny und hätte sich im gleichen Moment selbst eine herunterhauen können, weil sie so geschwollen sprach. Sie sprach sonst nicht so. Sie redete direkt ohne Umschweife, manches Mal ein bisschen Slang von der Straße.
Doch das war dem Schwarzen gar nicht aufgefallen. Er sah sich an, als ob er sich unglaublich fühlte. Es schien, dass er nicht wagte, sich selbst anzufassen. Mit einem ungläubigen Blick berührte sein Zeigefinger seinen Arm. Er lächelte. Aber sein Lächeln war unsicher, fast verzagt.
Jenny hockte neben ihm. Ihre Hand strich ihm über seine vom Schweiß feuchte Wange.
Er war wie sie. Aber wie war sie?
Er lächelte sie an. Nicht nur, weil sie ihn gerettet hatte. Sondern auch, weil er sofort verstanden hatte, dass sie war wie er, irgendwie gleich, zumindest ähnlich. Aber wieso sprach er eine Sprache, die nicht Arabisch und nicht Englisch war? Und wo eigentlich war er hier überhaupt? Er hatte sich aufgesetzt und seine Arme umfassten seine Schienbeine, was ihm ein ursprüngliches Gefühl von Sicherheit gab.
Jenny musterte ihn von oben bis unten. Er sah aus, als ob er eine lange Reise hinter sich hätte. Strapazen seiner Reise waren eingemeißelt in seiner hohen Stirn und in seinen Wangen, tiefe Falten der Entbehrung, die nicht zu seinem Alter passen wollten. Denn er war sicherlich nicht so viel älter als sie, höchstens fünfzehn Jahre. Aber sein Gesicht sah aus, als wäre er gerade aus einer Achterbahn gefallen, fassungslos, unverletzt geblieben zu sein, und nicht in der Lage, zu erklären, wieso er nach einem solchen Sturz wie selbstverständlich dasaß. Aber er war gar nicht hinuntergestürzt. Sie hatte ihn ja gerettet.
Er trug eine verdreckte Hose und ein Shirt, dessen ursprüngliche Farbe nicht zu erkennen war. Das Shirt klebte vor Dreck und – Jenny sah genau hin – Blut, altes geronnenes Blut. Vor Entsetzen rückte sie ein Stück weg von ihm, was nicht nur an seinem Anblick lag. Denn er stank zudem fürchterlich, geradezu widerwärtig, war das Wort, das Jenny richtig erschien. Er stank beißend süßlich, als ob er postwendend einem Grab entstiegen wäre.
War er Jesus? Jesus war ein Palästinenser, meinte Jenny, denn er war in Palästina geboren, erinnerte sie sich, obwohl sie viel mehr von Jesus nicht wusste. Außer, dass Jesus in Krippen inmitten irgendwelcher Nutztiere lag oder an Kreuzen hing, und die Schuld der Welt auf sich geladen hatte – was kein Kreuz aus normalem Holz aushalten dürfte, wie sie schon immer gefunden hatte. Sie wusste, sie war lakonisch. Aber so war die Wirklichkeit.
Ahnte er, was sie dachte, oder konnte er ihre Gedanken dechiffrieren? »Massengrab«, sagte er nur mit einem Wort, lächelte dabei unschuldig entschuldigend, und: »Weiß nicht, wie lange.«
In diesem Moment drehte sich ein Schlüssel im Schloss einer der Zugänge zum Dach. Ein Mann in einer grauen Uniform mit einem gelben Bären am Oberarm schaute sich auf dem Flachdach des Reichstages um und war augenscheinlich zufrieden. Niemand Unbefugtes war hier zu sehen. Kein Fotograf, der Bilder von der Stadt machte, kein anderer nächtlicher Eindringling. Erleichtert schloss er die Tür, ohne den Schlüssel wieder umzudrehen und abzusperren. Er hatte sie nicht gesehen. Für ihn gab es sie scheinbar nicht. Er hätte sie sehen müssen. Eigentlich hätte er sie sehen müssen. Sie saßen doch da! War der Mann etwa blind? ›Ein Blinder als Wachmann, eine merkwürdige Besetzung‹, dachte Jenny. Da wurde ihr plötzlich klar, dass der Kontrolleur sie nicht sehen konnte, weil sie für ihn unsichtbar sein mussten. Für ihn saß niemand auf dem Flachdach des Reichstages. Jenny wurde mulmig. Sie wusste, sie war gestorben. Tot war sie, obwohl sie hier und jetzt lebte und nicht zu sehen war. Sie sah den Mann neben ihr an. Ging es ihm genauso? War auch er gestorben und lebte überraschend weiter, ohne dass man ihn sehen konnte? Wenn er aus einem Massengrab stammte, war das der naheliegende Schluss … Sie musste mehr über ihn erfahren, um über sich selbst klarer zu werden.
»Wie heißt du?«, fragte sie ihn. Er lächelte sie freundlich an, aber er antwortete nicht auf ihre Frage. Er zog stattdessen das T-Shirt über seinen Kopf und betrachtete seinen muskulösen Oberkörper. Sein rechter Arm musste mehrfach gebrochen sein. Das zeigten die Spuren auf seiner Haut, die nicht wirklich Narben waren, mehr so etwas wie Nahtstellen ohne Fäden, einfach zusammengefügt. So provisorisch seine dunkle Haut an diesen hellen Stellen auch aussah, er hatte einen absolut funktionsfähigen rechten Arm. Ungläubig zog er seine Jeans über seine trainierten Unterschenkel nach oben, dann zog er sie kurz von oben herunter. Jenny sah an ihm vorbei, weil sie einen derart entblößten Mann erst selten gesehen hatte. Sie verspürte Scham, aber sie wusste nicht, ob sie rot wurde. Jenny befühlte ihr heißes Gesicht.
»Rocco«, sagte er und zog sich wieder ordentlich an, »ich bin aus dem Sudan.« Jenny bemerkte, wie schwer es ihm fiel, diese für ihn wohl fremde Sprache zum Ausdruck zu bringen, obwohl er sie perfekt sprach. Der andere Klang dieser Sprache verfing nicht mit seinen Gedanken. »Ich weiß nicht, warum ich hier bin. Ich weiß auch nicht, wo ich bin.«
»Berlin«, war Jennys knappe Auskunft.
»Das ist in Deutschland?«, fragte er zögerlich, jedes Wort gedehnt.
»Ja, Deutschland.«
»Du kommst von hier?«
»Ja.« Jenny schwieg für einen Moment, sie wollte nicht erzählen, dass sie eigentlich gestorben war, denn vielleicht stimmte das nicht und sie hatte überlebt, wie auch immer, ein großer Irrtum war das. Sie war Jenny, die Person, die sie immer war, nur eben jetzt auf dem Dach des Reichtags. Das war ihre Hoffnung.
»Ich war tot, begraben in einem Massengrab in der Nähe von Khartoum«, vervollständigte Rocco seine Auskunft, die er ihr vorhin mit nur einem Wort an den Kopf geworfen hatte. So viele Fragen an ihn sausten ihr durch den Kopf, so viele Fragen, die er vielleicht auch ihr stellen wollte. Doch die Fragen überschlugen sich in ihren Gedanken, ließen keine Formulierung zu – vor allem angesichts der einen Tatsache, die sie als Fakt erst einmal verarbeiten musste. Jennys trügerische Hoffnung, möglicherweise wieder am Leben zu sein, hatte sich in der Selbstverständlichkeit des Faktischen aufgelöst. Sie war gestorben, so wie er gestorben war. Doch, es war wahr, sie lebten beide, oder waren zumindest da.
Erst waren es einzelne Touristen, die am frühen Morgen durch die Türen des Eingangs auf das Flachdach liefen. Doch schon bald bevölkerten viel mehr Menschen die Attraktion mit dem fantastischen Blick über die Stadt. Die Besucher auf dem Flachdach waren nicht nur amerikanische Touristen. Es gab viele von ihnen. Aber auch viele Europäer strömten herein, aus den Niederlanden, aus Großbritannien, aus Dänemark, Norwegen und Schweden. Inder waren unter den Besuchern und Araber, aus welchem Land sie auch immer kamen. Sie waren Menschen aus den USA, aus Malaysia, den Malediven, aus Vietnam, Thailand, Kambodscha und es gab viele aus Russland unter ihnen. Die Besucher kamen aus einer erstaunlich großen Zahl von Ländern. Viele Sprachen erkannte Jenny nicht einmal, obwohl sie verstehen konnte, was die Menschen redeten.
Die Touristen sahen sie nicht. Sie gingen sogar durch sie hindurch, dort, wo sie standen, Rocco und Jenny, um einen Blick von oben auf die Hauptstadt zu erhaschen. Jenny wich immer wieder zurück, um Platz zu machen, wenn ein Tourist auf sie zuging. Aber der Nächste ging an dieser Stelle durch sie hindurch. Sie sah zu Rocco hinüber, der sich die Hände vor die Augen hielt, weil er offenbar nicht sehen wollte, wie er überrannt wurde. Jenny blieb regungslos dort, wo sie stand, und ließ die Touristen durch sich passieren. Sie spürte es ja nicht, auch wenn der Gedanke eigenartig war. In diesem Moment stand ein Mensch aus England vor ihr, lächelte, erkannte ein Ziel für die Kamera seines Smartphones und ging schnurstracks durch sie hindurch, um wenige Sekunden danach hinter ihr zu stehen, von der Balustrade des Dachs fotografierend. Das passierte nicht nur ein Mal. Es passierte andauernd, denn Jenny war fast eingekesselt von neugierigen Touristen.
In diesem Moment war es ihr klar geworden. Ihr Mund stand weit offen, so unfassbar war ihre Erkenntnis, dass sie fast selbst nicht daran glauben konnte. Aber so wurden sie beschrieben, die Wesen, die es nur nach Hörensagen gab.
Zunächst war Jenny auf die Idee gekommen, ein Geist geworden zu sein. Aber Geister hatten keinen Bezug zu einem Körper. Sie erinnerte nicht mehr, woher sie das wusste. Aber sie war sich sicher. Sie wollte kein Geist sein, zu dicht lag der Geist beim Dämon. Sie empfand sich überhaupt nicht als Dämon. Wenn sie eine andere Form angenommen hatte, dann musste sie ein Engel geworden sein. Engel hatten eine gewisse Körperlichkeit, so wie sie. Wenn es Engel auf der Welt gab, hatten sie keinesfalls Flügel, fand sie, während sie sicherheitshalber verstohlen ihren Rücken abtastete und Roccos betrachtete. Denn sie waren bei den Menschen, um sie zu beschützen und ihnen zu helfen. Allein dafür brauchte kein Engel Flügel.