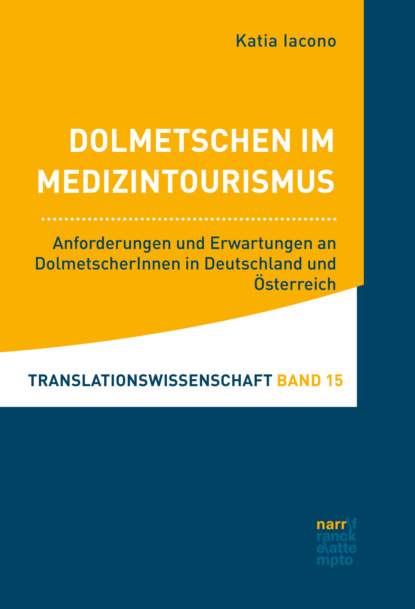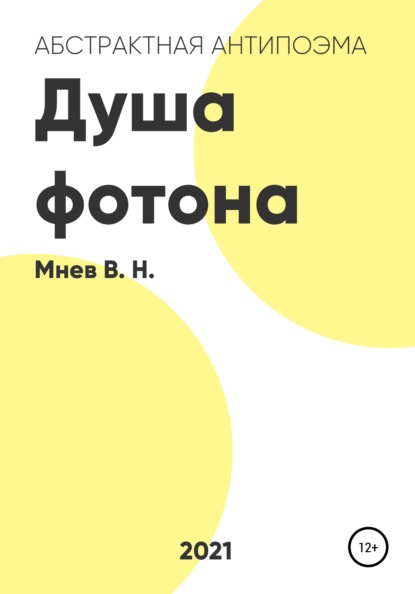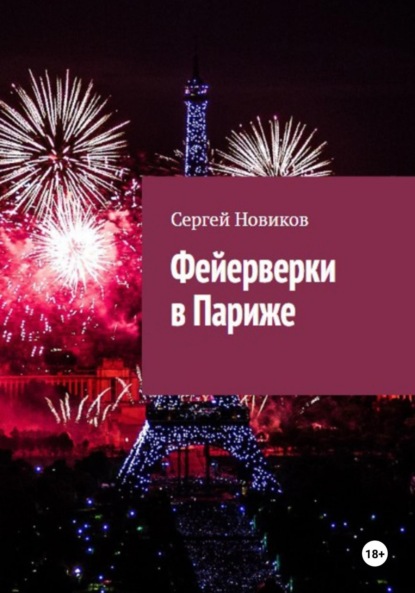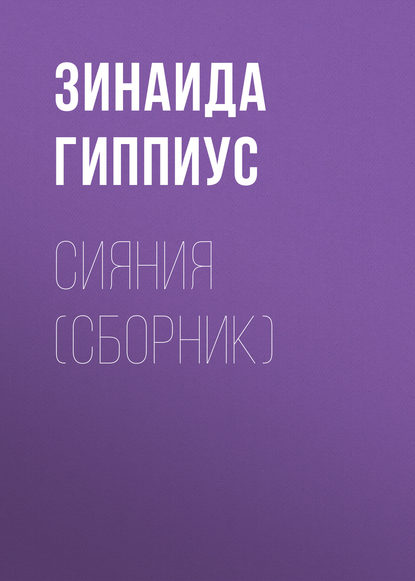Dolmetschen in der Psychotherapie
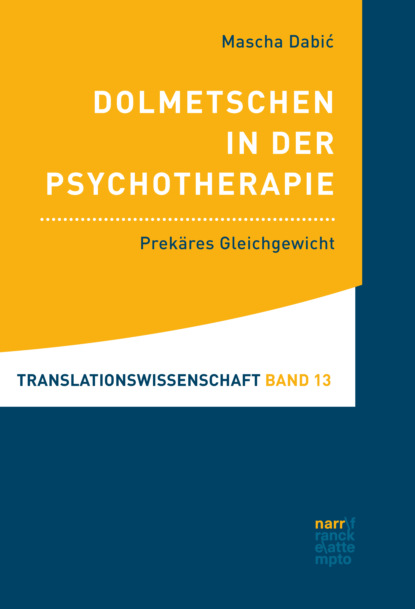
- -
- 100%
- +
Eine besondere Bedeutung beansprucht der Fall, daß eine größere Anzahl von Menschen gemeinsam den Versuch unternimmt, sich Glücksversicherung und Leidensschutz durch wahnhafte Umbildung der Wirklichkeit zu schaffen. Als solchen Massenwahn müssen wir auch die Religionen der Menschheit kennzeichnen. Den Wahn erkennt natürlich niemals, wer ihn selbst noch teilt. (Freud 2007: 48)
Wer dann in späterer Lebenszeit seine Bemühungen um das Glück vereitelt sieht, findet noch Trost im Lustgewinn der chronischen Intoxikation, oder er unternimmt den verzweifelten Auflehnungsversuch der Psychose.
Die Religion beeinträchtigt dieses Spiel der Auswahl und Anpassung, indem sie ihren Weg zum Glückserwerb und Leidensschutz allen in gleicher Weise aufdrängt. Ihre Technik besteht darin, den Wert des Lebens herabzudrücken und das Bild der realen Welt wahnhaft zu entstellen, was die Einschüchterung der Intelligenz zur Voraussetzung hat. Um diesen Preis, durch gewaltsame Fixierung eines psychischen Infantilismus und Einbeziehung in einen Massenwahn gelingt es der Religion, vielen Menschen die individuelle Neurose zu ersparen. (Freud 2007: 51)
Es ließe sich einwenden, dass solche grundsätzlichen Überlegungen, noch dazu aus dem Jahr 1930, wenig bis keine Relevanz für die heutige Arbeit von DolmetscherInnen in der Psychotherapie haben können. Bei näherer Betrachtung stellt sich jedoch heraus, dass die Religion, die im derzeitigen medialen und tagespolitischen Diskurs hauptsächlich im Zusammenhang mit dem Thema Terrorismus diskutiert wird (Stichwort: „Islamismus“), im psychotherapeutischen Kontext einen anderen Stellenwert genießt, nämlich als eine Ressource, die das Potenzial hat, „vielen Menschen die individuelle Neurose zu ersparen“ (s.o.). Es ist nicht unwichtig für DolmetscherInnen in der Psychotherapie, sich Gedanken über die Funktion der Religion unter dem Gesichtspunkt der individuellen Leidbewältigung zu machen, um von oberflächlichen und/oder politisierten Bewertungen der Religionszugehörigkeit bzw. der Religiosität von KlientInnen abzusehen bzw. solche eigenen Bewertungen kritisch zu hinterfragen. Je besser DolmetscherInnen den radikal individuellen Zugang zum seelischen Leid des Klienten in der Psychotherapie nachvollziehen können, desto leichter fällt es ihnen, im Einklang mit den Zielvorstellungen und Abläufen einer Psychotherapie zu agieren. Nicht zu unterschätzen sind nämlich die Auswirkungen eigener Widerstände und Ressentiments auf die Dolmetschleistung, daher stellt eine laufende Reflexion der eigenen Einstellungen (auch der politischen) für DolmetscherInnen in der Psychotherapie eine Notwendigkeit dar.
Weitere Themen, die Freud in dieser bahnbrechenden kulturtheoretischen Schrift diskutiert, sind die Unverzichtbarkeit und Unerfüllbarkeit des Lustprinzips, der Gegensatz von Kultur und individueller Freiheit, die Bildung größerer sozialer Gemeinschaften, in denen Arbeitsteilung und gegenseitige Abhängigkeit herrschen, sowie die Unterdrückung der Aggression, beziehungsweise die Verwendung unterdrückter Aggression zum Aufbau der Kultur durch die Umwandlung der Aggressionslust in Schuldbewusstsein. Das Zusammenspiel dieser und anderer, hier nicht genannter Komponenten sorgen für ein „Unbehagen in der Kultur“, mit dem das Individuum („eine Art Prothesengott“, Freud 2007: 57) den Preis für die Annehmlichkeiten des Lebens in einer „zivilisierten“ Gesellschaft bezahlt.
2.7.2 „Warum Krieg?“
In einer anderen Schrift, die im Kontext der transkulturellen Psychotherapie mit Kriegsüberlebenden ebenfalls nicht unerwähnt bleiben soll, beschäftigt sich Freud mit der Frage, warum die Menschheitsgeschichte von Kriegen geprägt ist. Bei dieser im Jahr 1932 erschienen Schrift mit dem Titel „Warum Krieg?“ handelt es sich um einen Brief, in dem Freud den Versuch unternimmt, Antworten auf eine Frage seines Zeitgenossen, des Physikers Albert Einstein zu finden: „Sie haben mich dann durch die Fragestellung überrascht, was man tun könne, um das Verhängnis des Krieges von den Menschen abzuwehren.“ (Freud 2007: 165). Freud stellt fest, dass Interessenskonflikte unter den Menschen prinzipiell durch die Anwendung von Gewalt entschieden werden, was im Übrigen auch für das Tierreich gilt, wobei bei den Menschen noch die Meinungskonflikte hinzukommen, die einen hohen Grad der Abstraktion erreichen können. Die Gewalt wird gebrochen, indem die Gemeinschaft durch einen Zusammenschluss das gemeinsame Recht etabliert, sodass nicht mehr die Gewalt eines einzelnen sich durchsetzt, sondern die der Gemeinschaft. Die Macht wird also an eine größere Einheit übertragen. Dennoch währt der Friede nie lange, und es werden Konflikte zwischen „Stadtgebieten, Landschaften, Stämmen, Völkern und Reichen“ fast immer „durch die Kraftprobe des Krieges entschieden“ (2007: 169), was zu Beraubung, voller Unterwerfung oder Eroberung des einen Teils führt.
Um dieses Phänomen zu erklären, führt Freud die Triebe des Menschen ins Treffen, die „nur von zweierlei Art sind, entweder solche, die erhalten und vereinigen wollen – wir heißen sie erotische, ganz im Sinne des Eros im Symposion Platos (…) – und andere, die zerstören und töten wollen; wir fassen diese als Aggressionstrieb oder Destruktionstrieb zusammen.“ (2007: 171). Freud enthält sich jedoch einer Wertung von Gut und Böse und postuliert: „Der eine dieser Triebe ist ebenso unerläßlich wie der andere, aus dem Zusammen- und Gegeneinanderwirken der beiden gehen die Erscheinungen des Lebens hervor.“ Utopischen Vorstellungen eines friedlichen, aggressionsfreien Zusammenlebens von Menschen, sei es in simplen Gesellschaftsformen als Naturvölker oder in ideologischen, beispielsweise bolschewistischen Zusammenhängen, erteilt Freud eine klare Absage und spricht in diesen Fällen von Illusionen. Es könne nicht darum gehen, die menschliche Aggressionsneigung völlig zu beseitigen, sondern man könne nur versuchen, sie so weit abzulenken, dass sie nicht ihren Ausdruck im Kriege finden müsse.
Freud formuliert an einigen Stellen prägnant seine Überlegungen zum Krieg, die an Aktualität nichts eingebüßt haben, und es erscheint sinnvoll, diese Abschnitte ebenfalls im Originalwortlaut wiederzugeben, angesichts des Umstands, dass in der vorliegenden Arbeit mit kriegstraumatisierten Menschen sowohl den PsychotherapeutInnen als auch den DolmetscherInnen eine Auseinandersetzung mit dem Phänomen des Krieges nicht erspart bleibt und Freuds einschlägige Überlegungen eine wertvolle Kontextualisierung bieten, zumal jegliches Arbeit mit Flüchtlingen eine grundsätzlich pazifistische Weltanschauung voraussetzt, oder jedenfalls eine Haltung, die sich der Kriegslogik, die manchen Menschen auf Grund ihrer Zugehörigkeit zu einer Gruppe das Existenzrecht abspricht, widersetzt.
Warum empören wir uns so sehr gegen den Krieg, Sie und ich und so viele andere, warum nehmen wir ihn nicht hin wie eine andere der vielen peinlichen Notlagen des Lebens? Er scheint doch naturgemäß, biologisch wohlbegründet, praktisch kaum vermeidbar. Entsetzen Sie sich nicht über meine Fragestellung. (…) Die Antwort wird lauten, weil jeder Mensch ein Recht auf sein eigenes Leben hat, weil der Krieg hoffnungsvolle Menschenleben vernichtet, den einzelnen Menschen in Lagen bringt, die ihn entwürdigen, ihn zwingt, andere zu morden, was er nicht will, kostbare materielle Werte, Ergebnis von Menschenarbeit, zerstört und anderes mehr. Auch daß der Krieg in seiner gegenwärtigen Gestaltung keine Gelegenheit mehr gibt, das alte heldische Ideal zu erfüllen, und daß ein zukünftiger Krieg infolge der Vervollkommnung der Zerstörungsmittel die Ausrottung eines oder vielleicht beider Gegner bedeuten würde. (Freud 2007: 175)
Die Erklärung, die Freud schließlich für die Empörung gegen den Krieg liefert, ist von verblüffender Schlichtheit: „Ich glaube, der Hauptgrund, weshalb wir uns gegen den Krieg empören, ist, daß wir nicht anders können. Wir sind Pazifisten, weil wir es aus organischen Gründen sein müssen.“ (2007: 176). Mit „organischen Gründen“ meint er den Umstand, dass der Prozess der Kulturentwicklung zu psychischen Veränderungen führt, indem eine fortschreitende Verschiebung der Triebziele und Einschränkungen der Triebregungen stattfinden. Es komme zu einer Erstarkung des Intellekts, die wiederum zu einer stärkeren Beherrschung des Trieblebens führt, sowie zu einer Verinnerlichung der Aggressionsneigung. Weiter führt Freud aus:
Den psychischen Einstellungen, die uns der Kulturprozeß aufnötigt, widerspricht nun der Krieg in der grellsten Weise, darum müssen wir uns gegen ihn empören, wir vertragen ihn einfach nicht mehr, es ist nicht bloß eine intellektuelle und affektive Ablehnung, es ist bei uns Pazifisten eine konstitutionelle Intoleranz, eine Idiosynkrasie gleichsam in äußerster Vergrößerung. (…)
Wie lange müssen wir nun warten, bis auch die anderen Pazifisten werden? Es ist nicht zu sagen, aber vielleicht ist es keine utopische Hoffnung, daß der Einfluß dieser beiden Momente, der kulturellen Einstellung und der berechtigten Angst vor den Wirkungen eines Zukunftskrieges, dem Kriegführen in absehbarer Zeit ein Ende setzen wird. Auf welchen Wegen oder Umwegen, können wir nicht erraten. Unterdes dürfen wir uns sagen: Alles, was die Kulturentwicklung fördert, arbeitet auch gegen den Krieg. (Freud 2007: 176f.)
Gegen den Krieg arbeiten, besser gesagt gegen die verheerenden psychischen, emotionalen und sozialen Folgen des Krieges arbeiten – das ist sicherlich mit ein Gesichtspunkt, unter dem die Arbeit von PsychotherapeutInnen und DolmetscherInnen im Rahmen der transkulturellen Psychotherapie mit Kriegs- und Folterüberlebenden zu betrachten ist.
2.8 Abschließende Bemerkungen
Die in diesem Kapitel angeführten Werke können lediglich eine Idee von der Vielfalt der Auseinandersetzung mit dem Thema Kultur im Kontext der Psychoanalyse und der unterschiedlichen psychotherapeutischen Richtungen vermitteln. Der psychoanalytische Blick auf die Verortung des Individuums in der Kultur (bzw. in den Kulturen) und auf die interkulturelle Kommunikation kann für die Translationswissenschaft eine Bereicherung darstellen, zum einen auf Grund der Miteinbeziehung gesellschaftlicher Mechanismen und zum anderen auf Grund der Fokussierung auf das Individuum und seine ökonomischen, sozialen, kulturellen, intellektuellen und emotionalen Bedürfnisse.
Die Lektüre einschlägiger theoretischer Abhandlungen und praktischer Erfahrungsberichte legt den Schluss nahe, dass es in der konkreten Arbeit mit Menschen aus anderen Ländern (und Kulturen) in erster Linie darauf ankommt, einen Zugang zum Eigenen (also auch zu den eigenen Vorurteilen) zu finden, um einen respektvollen Umgang mit dem „Fremden“ (welches durch die zunehmende Annäherung immer vertrauter und somit weniger fremd wird) zu ermöglichen. Für einen solchen Prozess sind Lernbereitschaft und Lernfähigkeit unabdingbar.
3 Trauma: individuelle und kollektive Auswirkungen
Das interkulturelle psychotherapeutische Setting, von dem in der vorliegenden Arbeit die Rede ist, bezieht sich auf die Behandlung kriegs- und foltertraumatisierter Menschen. Trauma als nachhaltig wirksame körperliche und/oder seelische Verletzung ist ein vielschichtiges Phänomen, das durch die sogenannte Flüchtlingskrise der letzten Jahre zunehmend an gesellschaftlicher Wahrnehmung und Brisanz gewinnt. Ich werde mich im Folgenden auf jene Aspekte beschränkten, die für DolmetscherInnen, die in der Psychotherapie mit kriegs- und foltertraumatisierten Menschen arbeiten, von Relevanz sein können.
Das folgende Zitat der Traumatherapeutin Michaela Huber soll ein Schlaglicht darauf werfen, was therapeutisches Arbeiten mit traumatisierten Menschen bewirken kann bzw. bewirken können soll:
Es gibt wohl keine intensivere Begegnung als die in der Therapie mit Menschen, die nach Erfahrungen, welche ihnen buchstäblich den Boden unter den Füßen weggezogen haben, wieder versuchen, ins Leben zurückzufinden. Oder, wie es bei vielen früh und langjährig traumatisierten Frauen und einigen Männern der Fall ist, mit denen ich meistens arbeite: Die überhaupt zum ersten Mal entdecken, wie äußere Sicherheit sich anfühlen, wie Lebensfreude schmecken kann. Sie dabei zu begleiten, sich zu der Persönlichkeit zu entwickeln, die erst einmal gewaltsam blockiert oder zersplittert wurde, und die dann gereift und mit der Fähigkeit, nach innen beschützend und nach außen wehrhaft zu sein, ihr eigenes Potenzial entfalten kann – das ist eine große Freude. So herausfordernd und oft anstrengend diese Arbeit ist, sie verändert beide Beteiligten, und wenn es gelingt, bereichert sie und ist jeder Mühe wert. (Huber 2005: 18)
Hier ist die Rede von den „beiden Beteiligten“, Huber meint also die klassische Dyade (TherapeutIn und KlientIn), dennoch ist in diesem Zitat vieles enthalten, was DolmetscherInnen verinnerlichen oder begreifen sollten, um die therapeutische Haltung gegenüber den z.T. schwer traumatisierten KlientInnen erkennen und so weit mittragen zu können, wie es nötig ist, um die therapeutische Kommunikation zu ermöglichen. Das therapeutische Setting hat unter anderem die Funktion, ein Gefühl der Sicherheit zu evozieren – DolmetscherInnen sind an der Herstellung einer solchen Atmosphäre maßgeblich beteiligt, sowohl im Rahmen einer einzelnen Stunde als auch in der Kontinuität, als langfristige, wenn auch prekär beschäftigte MitarbeiterInnen in Einrichtungen für Behandlung von Kriegs- und Folterüberlebenden.
3.1 Definition
Auch wenn die Begriffe Trauma und davon abgeleitete Adjektive („traumatisiert“, „traumatisch“) mitunter inflationär oder gedankenlos verwendet werden1 , so ist Trauma keineswegs ein neumodisches Phänomen, sondern reicht in die Antike zurück (Smolenski 2006: 7f.).
Smolenski bietet einen Überblick über die historische Entwicklung der Traumatherapie und erwähnt u.a. entsprechende Schilderungen bei Homer über Achilles, die auf eine psychotraumatische Symptomatik hinweisen. Im 20. Jahrhundert waren es insbesondere die beiden Weltkriege, die zu massenhaften Traumatisierungen führten. Nach dem 2. Weltkrieg war das Sprechen über die traumatischen Erlebnisse deutscher Soldaten und der Zivilbevölkerung jedoch zunächst noch tabuisiert, und erst als die zahlreich auftretenden posttraumatische Belastungsstörungen bei Rückkehrern aus dem Vietnam-Krieg auch medial Beachtung fanden, gab es neue Entwicklungsimpulse für die Traumabehandlung. Die Diagnose der Posttraumatischen Belastungsstörung fand 1980 Eingang in das „Diagnostic and statistical manual of mental disorders“, und 1992 wurde dieses Krankheitsbild in die ICD-10 („International classification of diseases, injuries and causes of death“) der Weltgesundheitsorganisation WHO aufgenommen (vgl. Smolenski 2006: 15).
Darin wird Trauma folgendermaßen definiert:
(…) ein belastendes Ereignis oder eine Situation kürzerer oder längerer Dauer, mit außergewöhnlicher Bedrohung oder katastrophenartigem Ausmaß, die bei fast jedem eine tiefe Verzweiflung hervorrufen würde (z. B. Naturkatastrophe oder menschlich verursachtes schweres Unheil – man-made disaster – Kampfeinsatz, schwerer Unfall, Beobachtung des gewaltsamen Todes Anderer oder Opfersein von Folter, Terrorismus, Vergewaltigung oder anderen Verbrechen). (ICD-Code, Stand 25.5.2017)
Die Rede ist also von einem Ereignis, bei dem die natürlichen Schutzmechanismen versagen, weil es keine Möglichkeit gibt, sich den äußeren (gewaltsamen) Einwirkungen zu entziehen. Der Mensch erlebt Hilflosigkeit und Ohnmacht, mitunter auch Scham, in einem extremen Ausmaß. Wie es in der Definition heißt, würden diese Ereignisse „bei fast jedem eine tiefe Verzweiflung hervorrufen“, was im Umkehrschluss bedeutet, dass die KlientInnen nicht im eigentlichen Sinne „krank“ sind, jedenfalls nicht notwendigerweise, sondern von krankmachenden Ereignissen und Erlebnissen so schwer gezeichnet sind, dass die Symptome über das Ereignis hinaus sich immer wieder bemerkbar machen können. Dabei ist von Menschen verursachtes Unheil psychisch schwerer zu bewältigen als Naturkatastrophen, weil sich im ersten Fall stets Fragen von Schuld, Unrecht, Gerechtigkeit oder Rache stellen, ebenso wie die tendenziell mit Selbstvorwürfen behaftete Frage, ob es möglich gewesen wäre, das traumatische Ereignis zu vermeiden (wenn man sich rechtzeitig zur Flucht entschlossen hätte, wenn man dies oder jenes getan oder unterlassen hätte).
Zobel empfiehlt bei der Diagnose einer posttraumatischen Belastungsstörung mit einem Zahlenstrahl zu arbeiten, also einer Skala, um das Ausmaß der Belastung besser einschätzen zu können, bzw. die Auswirkungen des Traumas im Hier und Jetzt. Um vage Aussagen zu vermeiden (wie „ein bisschen“, „kaum“ oder „sehr viel“), empfiehlt Zobel, die Frage folgendermaßen zu formulieren: „Wenn Sie heute an dieses Ereignis denken, wie belastend empfinden Sie es auf einer Skala von 0 bis 10, wobei 0 bedeutet ’keine Belastung, neutral‘ und 10 ‚die für Sie maximal vorstellbare Belastung‘?“ (2006: 33). Zobel betont, dass es aus der Sicht des Psychologen wichtig ist, nicht nur auf den Inhalt des erzählten Ereignisses zu achten, sondern auch darauf, wie erzählt wird: Kann der Patient den Ablauf schildern, ohne dass es zu Affekten kommt? Kann der Patient Anfang, Verlauf und Ende schlüssig berichten? Erscheint das Erlebnis und die Art, wie der Patient es schildert, kongruent? Gibt es Hinweise darauf, dass er Patient aufkommende Emotionen unterdrückt? (2006: 34). Es ist notwendig, dass DolmetscherInnen in der Psychotherapie diesen Anspruch an die Gesprächsqualität nachvollziehen können: Es zählt nicht nur das, was gesagt wird, sondern auch, wie es gesagt wird.
3.1.1 Trauma oder belastendes Lebensereignis?
Huber legt Wert auf eine Unterscheidung zwischen einem Trauma und einem belastenden Lebensereignis (2005: 37ff.): Auch wenn innere Konflikte großen Stress bedeuten können, ist ein Trauma davon zu unterscheiden, nämlich dahingehend, dass es sich bei traumatisierenden Erlebnisse um „tatsächliche, extrem stressreiche äußere Ereignisse“ handelt (Huber 2005: 38). Die Überflutung mit „aversiven Reizen“ überfordert sämtliche Bewältigungsmechanismen des Opfers und verändert das Leben für immer. „Von jetzt an wird es nie mehr so sein wie zuvor“ (2005: 41) – diesen Aspekt gilt es zu verstehen, um begreifen zu können, warum die Traumatisierung eine Zäsur im Leben des Opfers (bzw. des Überlebenden) darstellt und warum Traumatherapien oft mehrere Jahre in Anspruch nehmen und weshalb selbst nach Abschluss einer Therapie, die man als „gelungen“ bezeichnen kann, nicht davon auszugehen ist, dass die Wirkkräfte des Traumas für immer gebannt sind.
Ereignisse, die mit tödlichen Bedrohungen einhergehen, lösen einen von zwei Reflexen aus: fight or flight. Ob Menschen eher mit Fluchtversuchen oder Kampfbereitschaft reagieren, scheint situations- und personenspezifisch ausgeprägt zu sein. Huber äußert die Vermutung, dass Frauen tendenziell eher zur automatischen Fluchtreaktion neigen, während Männer eher auf aggressives Verhalten zurückgreifen (2005: 43).
Traumatisierend ist ein Ereignis dann, wenn die oben genannten Reaktionsmöglichkeiten Kampf oder Flucht1 nicht mehr gegeben sind und die überwältigende Einwirkung von außen hingenommen werden muss. Die Fachausdrücke dazu lauten freeze und fragment (ebda.): Freeze meint eine Lähmungsreaktion und eine Entfremdung vom Geschehen. Mit Fragment ist gemeint, dass die Erfahrung zersplittert wird und dass es keine zusammenhängende Erinnerung mehr an das äußere Ereignis gibt.
Ein solches Ereignis bzw. eine länger andauernde traumatisierende Situation oder eine Kette von Ereignissen und Situationen können zur Entwicklung einer Posttraumatischen Belastungsstörung führen.
3.2 Posttraumatische Belastungsstörung
3.2.1 Definition und Symptome
Für DolmetscherInnen, die mit kriegs- und fluchttraumatisierten1 Menschen arbeiten, ist es von Vorteil, sich zumindest in groben Zügen mit den psychotherapeutischen Konzepten im Hinblick auf die Posttraumatische Belastungsstörung vertraut zu machen, zum einen, um ein umfassenderes Verständnis von der Problematik der KlientInnen zu erlangen, und zum anderen, um die Fragen und Interventionen der PsychotherapeutIn besser nachvollziehen (und also präziser in der anderen Sprache wiedergeben) zu können.
Auf körperlicher Ebene macht sich eine Posttraumatische Belastungsstörung durch massive Schlafstörungen bemerkbar – daher drehen sich psychotherapeutische Gespräche häufig um dieses Thema, und es wird gemeinsam mit der KlientIn versucht, sämtliche Möglichkeiten auszuloten, die Schlafprobleme in den Griff zu bekommen und auf diese Weise dem Organismus zu der dringend notwendigen Regeneration zu verhelfen. Einige Symptome, die vermutlich auf eine manifeste Depression hindeuten, können für DolmetscherInnen von konkreter Relevanz sein, nämlich dann, wenn die KlientInnen so antriebs- und teilnahmslos sind, dass der depressive Gesamtzustand sich auf ihre Sprechfähigkeit auswirkt: Es kommt vor, dass KlientInnen auf Grund ihrer schlechten psychischen Verfassung sehr leise sprechen und dadurch kaum verständlich sind, wodurch die Gefahr steigt, dass es zu Missverständnissen kommt. In solchen Fällen ist es wichtig, die PsychotherapeutIn auf diese Problematik hinzuweisen, und nicht etwa zu versuchen, auf eigene Faust zu erraten, was gesagt wurde. Eine deutschsprachige PsychotherapeutIn ist möglicherweise nicht in der Lage selbst abzuschätzen, wie stark die Sprechfähigkeit der depressiven KlientIn in Mitleidenschaft gezogen wurde, und ist in diesem Fall auf die Expertise der DolmetscherIn angewiesen. Mehrmaliges Nachfragen mag aus der Sicht der DolmetscherIn unangenehm sein, ist jedoch dem Impuls, den Inhalt auf gut Glück zu erraten und zu ergänzen jedenfalls vorzuziehen.
Es ist die Aufgabe der PsychotherapeutIn, sich ein möglichst genaues Bild vom psychischen Zustand der KlientIn zu machen. Dazu gehört die oben erwähnte körperliche Ebene (Schlaf, Nahrungsaufnahme, Energiehaushalt, Gesundheitszustand), aber auch die Frage nach der Konzentrationsfähigkeit und dem Umgang mit belastenden Erinnerungen: Können diese kontrolliert werden, oder ist die KlientIn ihren Erinnerungen mitunter hilflos ausgeliefert? Um über alle diese Aspekte so umfassend wie möglich informiert zu sein, muss die PsychotherapeutIn in der Regel viele Fragen stellen, denn die KlientInnen sind sich ihres eigenen Zustands meistens gar nicht bewusst und reflektieren oft erst als Reaktion auf das Nachfragen der PsychotherapeutIn über ihre etwaigen Fehlleistungen im Alltag (z. B. an der falschen Station aussteigen in öffentlichen Verkehrsmitteln etc.) und ihren Umgang mit Erinnerungen.
Die Weltgesundheitsorganisation WHO beschreibt eine Posttraumatische Belastungsstörung folgendermaßen:
Typische Merkmale sind das wiederholte Erleben des Traumas in sich aufdrängenden Erinnerungen (Nachhallerinnerungen, Flashbacks), Träumen oder Albträumen, die vor dem Hintergrund eines andauernden Gefühls von Betäubtsein und emotionaler Stumpfheit auftreten. Ferner finden sich Gleichgültigkeit gegenüber anderen Menschen, Teilnahmslosigkeit der Umgebung gegenüber, Freudlosigkeit sowie Vermeidung von Aktivitäten und Situationen, die Erinnerungen an das Trauma wachrufen könnten. Meist tritt ein Zustand von vegetativer Übererregtheit mit Vigilanzsteigerung, einer übermäßigen Schreckhaftigkeit und Schlafstörung auf. Angst und Depression sind häufig mit den genannten Symptomen und Merkmalen assoziiert und Suizidgedanken sind nicht selten. Der Beginn folgt dem Trauma mit einer Latenz, die wenige Wochen bis Monate dauern kann. Der Verlauf ist wechselhaft, in der Mehrzahl der Fälle kann jedoch eine Heilung erwartet werden. In wenigen Fällen nimmt die Störung über viele Jahre einen chronischen Verlauf und geht dann in eine andauernde Persönlichkeitsänderung über. (ICD-Code, Stand 25.5.2017)
Bei Huber sind u.a. folgende posttraumatische Belastungsreaktionen angeführt: Angstzustände und Schreckhaftigkeit, Alpträume und Schlafstörungen, häufiges Wiedererleben von Teilen des Traumas, Vermeidung von Reizen, die mit dem Trauma zu tun haben, Gefühle von Empfindungslosigkeit, Einsamkeit, Entfremdung von Nahestehenden, Kontaktunwilligkeit, Beeinträchtigung der Wahrnehmung der Umwelt, des eigenen Körpers, der eigenen Gefühle, Konzentrations- und Leistungsstörungen (Huber 2005: 68). Eine kompakte Zusammenfassung des Erscheinungsbilds der posttraumatischen Belastungsstörung ist auch bei Vogelgesang zu finden (2006: 68ff.), ebenso bei Preitler (2006: 157ff.).