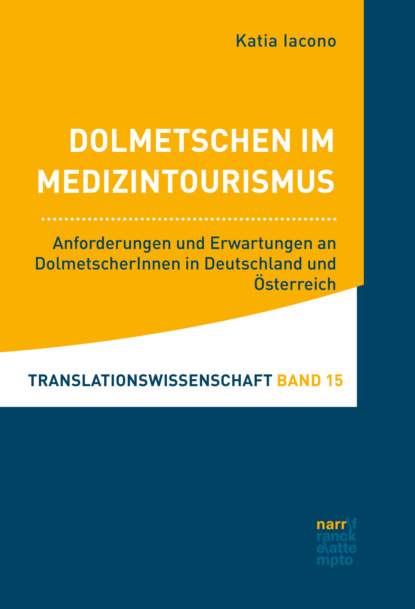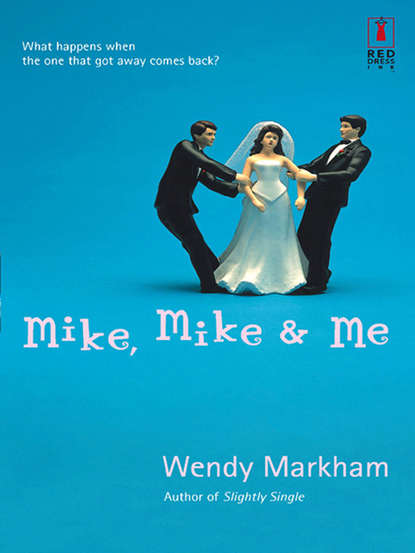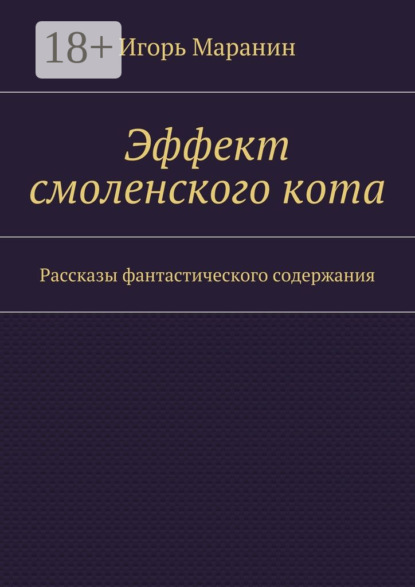Dolmetschen in der Psychotherapie
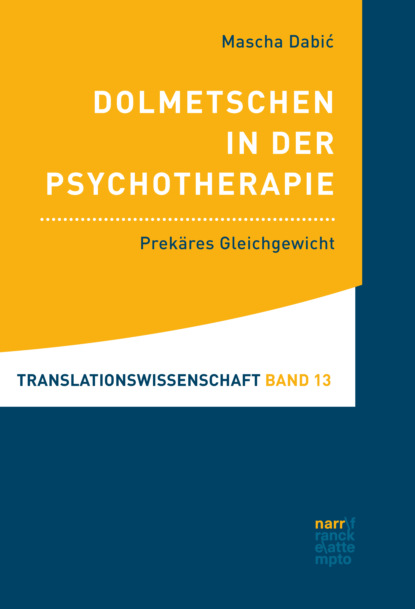
- -
- 100%
- +
Zu bedenken ist, dass Menschen lange Zeit nach dem Trauma gut funktionieren können, so als hätten sie das Trauma gut integriert; eine erneute Traumatisierung, ausgelöst durch einen Trigger2 (z. B. durch einen Jahrestag des traumatischen Ereignisses) kann zum Ausbruch der Posttraumatischen Belastungsstörung führen (Huber 2005: 70).
Die Ungewissheit eines langwierigen Asylverfahrens, das wie ein Damoklesschwert über den Asylwerbern schwebt und dem sie trotz rechtlichen Beistands im Grunde genommen hilflos ausgeliefert sind, kann wie eine erneute Traumatisierung wirken, ebenso ein Gefängnisaufenthalt im Rahmen der Schubhaft.
3.2.2 Folter und Trauma
„Folter bedeutet absoluten Kontrollverlust, daher ist es in der Arbeit mit diesen Menschen notwendig, ihnen möglichst viel Autonomie und Kontrollmöglichkeit einzuräumen“, stellt die in der Traumaarbeit erfahrene HEMAYAT1-Psychotherapeutin Preitler (2006: 165) fest und macht diese Kontrolle unter anderem an folgenden konkreten Faktoren fest: Da der Raum der Therapie oft der erste Ort für einen traumatisierten Menschen ist, in dem die Angst keinen Zutritt hat, braucht es Zeit, bis Vertrauen entstehen kann; daher soll den KlientInnen die Möglichkeit eingeräumt werden, den TherapeutInnen und auch den Dolmetscherinnen Fragen zu stellen, sie dürfen sich ihren Platz im Raum selbst aussuchen und gegebenenfalls auch die Lichtsituation im Raum kontrollieren, also beispielsweise die Vorhänge zuziehen. Für DolmetscherInnen kann es hilfreich sein, Bescheid zu wissen, warum KlientInnen solche Vorrechte eingeräumt werden und warum sie, die DolmetscherInnen, sich beispielsweise nicht einfach so, wie in einer anderen, alltäglicheren Situation ihren Sitzplatz selbst aussuchen dürfen.
Marcussen plädiert dafür, die Folter stets vor dem Hintergrund der gesellschaftlichen Verhältnisse und der globalen Widersprüche zu reflektieren: Welche Ziele verfolgten die Folterer? Welche Methoden wurden angewandt? (Marcussen 1990: 67ff.). Der durch die Folter zugefügte psychische Schmerz, die Ungewissheit, die Angst, die Demütigungen, die Drohungen und der Umstand, aller mitmenschlichen Kontaktmöglichkeiten beraubt zu sein, scheinen schlimmer als die offensichtlichen körperlichen Folgen zu sein (1990: 71).
Rauchfleisch bietet in seinem Beitrag einen Überblick über unmittelbare Reaktionen auf das Foltererlebnis, so wie auf die Kurzzeitfolgen und Spätfolgen (Rauchfleisch 1990). Wertvolle Praxiserfahrungen von erfahrenen ExpertInnen aus den Gebieten der Psychologie, Psychotherapie, Medizin und Sprachwissenschaften sind bei Siroos & Schenk (2010) nachzulesen.
Aus der Sicht der DolmetscherInnen ist im Zusammenhang mit dem Thema Folter wichtig nachvollziehen zu können, warum bei Folterüberlebenden ein besonders behutsames Vorgehen in der Therapie notwendig ist, warum es mitunter sehr viel Zeit und Geduld braucht, bis mit Folter im Zusammenhang stehende Inhalte zur Sprache gebracht werden können und also zum Gegenstand in der Therapie werden.
3.3 Arbeiten mit traumatisierten Menschen
3.3.1 Die therapeutische Beziehung und Therapieziele
Die knappe Beschreibung einer therapeutischen Beziehung bei Vogelgesang kann für DolmetscherInnen in diesem Kontext hilfreich sein:
Die Einhaltung der adäquaten Distanz prägt die therapeutische Beziehung entscheidend mit: Sie ist je nach den situativen Erfordernissen flexibel zu gestalten. Absolut zu meiden sind jedoch die folgenden beiden Extrempole: einerseits die Überidentifikation, die unter völliger Selbstaufgabe und evtl. sogar bei Überschreiten der professionellen Grenzen den Patienten um jeden Preis retten möchte, sowie andererseits die übergroße Distanzierung, die ein echte Beziehung erst gar nicht entstehen lässt. (2006: 71)
Es ist unabdingbar für DolmetscherInnen in diesem Kontext, die Charakteristik und Spezifik einer therapeutischen Beziehung nachvollziehen und mitgestalten zu können: Die Mitgestaltung kann sowohl durch aktive Teilnahme erfolgen, als auch durch bewusste Zurückhaltung und Unterlassungen. Das Ringen um die „adäquate Distanz“, die Vermeidung einer „Überidentifikation“ ebenso wie einer „übergroßen Distanzierung“ sind Anforderungen, die die DolmetscherInnen im gleichen Maße wie die PsychotherapeutInnen betreffen. Eine „Grenzen überschreitende Verschwesterung mit den Betroffenen“ sei nicht nur unprofessionell, sondern auch im höchsten Grade dysfunktional (S. 72).
Vogelgesang spricht außerdem davon, dass die Arbeit mit traumatisierten Menschen auch für die Therapeutin sehr belastend sein kann und sowohl von menschlicher als auch von professioneller Seite her besondere Anstrengungen verlangt, da die eigene Welt- und Selbstsicht entscheidend verändert werden kann und auch eigene traumatische Erfahrungen aktualisiert werden können. Eine gute Ausbildung, Supervision, eine Stärkung der eigenen Ressourcen sowie eine gute Kenntnis der eigenen Biographie im Bezug auf Traumata (Stichwort: Selbsterfahrung) können diesbezüglich Abhilfe schaffen. An dieser Stelle sei darauf hingewiesen, dass DolmetscherInnen in der Regel ohne eine solche Ausbildung, oft auch ohne Supervision und ohne entsprechende Selbsterfahrung die Narration der traumatisierten KlientIn aus erster Hand vernehmen. Daran anknüpfend ist unbedingt die Forderung nach Supervision für DolmetscherInnen in den entsprechenden Einrichtungen zu stellen, wenn auch dazu angemerkt sei, dass solche Angebote mitunter auch an der fehlenden Bereitschaft der DolmetscherInnen selbst scheitern bzw. ihr volles Potenzial nicht zur Entfaltung bringen können, da DolmetscherInnen prekär beschäftigt sind, ihnen also für solche Angebote häufig die Zeit oder der Wille fehlt; möglicherweise ist es auch die Furcht vor der Konfrontation mit eigenen problematischen Inhalten, die DolmetscherInnen davon abhält, Supervisionsstunden in Anspruch zu nehmen, auch dann, wenn diese von der Organisation im ausreichenden Ausmaß angeboten werden.
Zu Beginn dieses Kapitels (Punkt 3.) wurde bereits darauf hingewiesen, dass die DolmetscherInnen durch ihre Präsenz und ihre Mitarbeit daran beteiligt sind, den therapeutischen Rahmen als einen „sicheren“ Raum für die KlientInnen mitzugestalten. Da DolmetscherInnen in erster Linie für den sprachlichen Transfer in diesem Rahmen zuständig sind, ist ihre Rolle bei der Erreichung eines der impliziten Therapieziele nicht hoch genug einzuschätzen, nämlich bei der Herstellung einer „sprachlich codierten Erinnerung“ (Vogelgesang 2006: 70).
Im Hinblick auf das Ziel der Psychotherapie ist es notwendig, eine realistische Perspektive einzunehmen – dies ist auch für DolmetscherInnen wichtig nachzuvollziehen, um keine übersteigerten Erwartungen an die Therapien und den jeweils eigenen Beitrag daran zu knüpfen:
Heilung im Sinne von Wiedergutmachung ist nicht möglich. Was geschehen ist, kann nicht mehr rückgängig gemacht werden. Die toten Familienangehörigen und Freunde sind unwiederbringlich verloren, die körperlichen Verstümmelung (sic!) und Narben bleiben sichtbar. Das Grauen der Folter wurde ein überdimensionaler Bestandteil der Lebensgeschichte. Ziel der psychologischen und psychotherapeutischen Intervention kann es aber sein, die Zeitdimensionen wieder richtig zu stellen: Die Folter muss nicht mehr jede Nacht in Albträumen und tagsüber in ständig wiederkehrenden Erinnerungen wieder erlebt und erlitten werden. (Preitler 2006: 165)
Eine Therapie gilt dann als abgeschlossen, wenn es den KlientInnen gelungen ist, verlorene Menschen und Lebensbezüge zu betrauern, neue Beziehungen aufzubauen und Strategien für ein Leben im neuen Land praktisch umzusetzen. Allerdings können Retraumatisierungen immer wieder auftreten, sodass KlientInnen beim Abschied immer das Angebot erhalten, auch später noch Kontakt aufzunehmen, sollte eine Krisenintervention oder eine nochmalige Kurztherapie notwendig sein.
3.3.2 Dynamiken in den Einrichtungen für Kriegs- und Foltertraumatisierte
Der Arzt, Psychotherapeut und Mitbegründer und Leiter des Behandlungszentrums für Folteropfer in Berlin Christian Pross hat eine umfassende Analyse von Dynamiken und Belastungen, denen MitarbeiterInnen von Einrichtungen für kriegstraumatisierte Menschen ausgesetzt sind, vorgelegt (Pross 2009). Er untersuchte an Hand von Interviews Strukturen, kommunikative Muster, Handlungsabläufe, Lebenszyklen und Phänomene wie Burn-Out und Zerwürfnisse innerhalb des Teams und kam zu der Erkenntnis, dass in Arbeitsstellen, in denen traumatisierte Menschen behandelt werden, häufig destruktive Dynamiken auftreten, wie etwa Konflikte, Ausschließung einzelner MitarbeiterInnen oder Mobbing, hohe Fluktuation usw. Als Ursachen führt Pross unter anderem folgende Faktoren an: hoher Identifikationsdruck im Spannungsfeld der Extreme von Opfer und Täter, Einteilung der Welt in Gut und Böse, Überidentifikation mit den Opfern, Größenfantasien, Grenzüberschreitungen, mangelnde Distanz zu sich selbst, das Unvermögen, das eigene destruktive Handeln zu reflektieren, etc. (2009: 270). Konflikte und Kämpfe in Teams führen in die Reinszenierung des Traumas, und ohne Reflexion und (Selbst-)Korrektur agieren MitarbeiterInnen eigene Verletzungen aus bzw. wiederholen unbewusst die pathologischen Verhaltensmuster ihrer PatientInnen.
Da der Arbeitsauftrag der DolmetscherInnen in solchen Zentren sehr klar definiert ist, nämlich zu bestimmten, im Voraus ausgemachten Zeiten zu dolmetschen, sind DolmetscherInnen von solchen destruktiven Dynamiken tendenziell weniger betroffen. In der Regel sind DolmetscherInnen nicht angehalten, die Repräsentation der Einrichtung nach außen aktiv mitzugestalten, SponsorInnen zu gewinnen oder die Positionierung der Einrichtung innerhalb des Netzwerks staatlicher und nichtstaatlicher Akteure im Asylbereich zu verhandeln. Die Verantwortung der DolmetscherInnen gegenüber der Einrichtung beschränkt sich in der Regel auf die möglichst korrekt, zuverlässig und kontinuierlich ausgeübte Dolmetschtätigkeit; damit geht ein relativ beschränkter Gestaltungsraum einher, zugleich sind DolmetscherInnen den Konflikten innerhalb des Teams weniger ausgesetzt und müssen nicht inhaltlich Stellung beziehen.
Dennoch sind manche Aspekte, mit denen Pross sich differenziert auseinandersetzt, für DolmetscherInnen ebenfalls relevant und sollen daher im vorliegenden Kapitel Erwähnung finden.
3.3.2.1 Vom Idealismus bis zur Erschöpfung
Pross liefert eine ausführliche Beschreibung von Entstehungs- und Entwicklungsprozessen von Non-Profit-Organisationen und der sich daraus ergebenden Implikationen für die MitarbeiterInnen: Gemeinnützige Nichtregierungsorganisationen verfolgen in der Regel eine Aufgabe, die meist grenzenlos ist; die Erfüllung der gesteckten Ziele einer NGO würde zugleich die Existenz dieser Organisation obsolet machen (2009: 41ff.).
Bei der Gründung einer NGO herrschen meist noch direkte, informelle, familienartige Kommunikationsstrukturen, und die Aktivitäten sind von Idealismus, Optimismus und Pioniergeist getragen. Findet im weiteren Verlauf ein Wachstum der Organisation statt, bilden sich zwangsläufig (mehr oder weniger flache) hierarchische Strukturen, Abgrenzung von Kompetenzen und standardisierte Abläufe heraus, was der strategischen Planung und der Effizienz zuträglich ist, jedoch auf Kosten der anfänglichen idealistischen Stimmung gehen kann. Außerdem kann es zu einer Schieflage zwischen bezahlten und ehrenamtlichen MitarbeiterInnen kommen. Dazu kommt, dass die Bezahlung im NGO-Sektor verglichen mit anderen beruflichen Feldern ohnehin schlecht ist, was dazu führen kann, dass die schlecht bezahlten und die gar nicht bezahlten MitarbeiterInnen gewissermaßen um die „Opferrolle (…) konkurrieren“ (2009: 44). Wenn es zu Spannungen im Team kommt, kann die anfängliche Aufbruchstimmung rasch einer Ernüchterung weichen, was zu Erschöpfungssymptomen bei den MitarbeiterInnen führen kann, sowie zu einer hohen Fluktuation und Spaltungen.
Schließlich können bei den MitarbeiterInnen u.a. folgende Stress- und Überlastungssymptome auftreten: Überarbeitung und Workaholismus, da das Schützen der eigenen Ressourcen und Grenzen angesichts des Elends der Flüchtlinge als „Verrat“ erlebt wird; Erschöpfung und Unlust, daraus folgende familiäre Spannungen und Trennungen; Depressionen und körperliche Erkrankungen (psychosomatische Krankheiten und Infekte aufgrund verminderter Abwehrkräfte); Alpträume; Sucht (Nikotin, Kaffee und Alkohol, sowie Essstörungen); Schlafstörungen; Gereiztheit. Gerade aus Sicht der DolmetscherInnen verdient ein weiteres Symptom besondere Beachtung, nämlich die Erschütterung des Weltbilds durch die Zeugenschaft, also durch das Anhören der Erzählungen der KlientInnen, deren Menschenrechte verletzt wurden: Das Gefühl von Sicherheit, der Glaube an das Gute im Menschen, das Grundvertrauen in die Menschheit kann nachhaltig gestört werden; eine weitere Enttäuschung kann mit der Erkenntnis einhergehen, dass die NGOs trotz ihrer hehren Ziele nicht vor Grabenkämpfen und Konflikten gefeit sind (2009: 125ff.).
3.3.2.2 Ressourcen der MitarbeiterInnen
Um die traumatischen Inhalte, die in der Arbeit zur Sprache kommen, zu bewältigen, greifen MitarbeiterInnen von einschlägigen Einrichtungen zu unterschiedlichen Methoden, besser gesagt, sie entwickeln unterschiedliche Strategien, um Zugang zu ihren eigenen Ressourcen zu bekommen (Pross 2009: 136ff.). Es handelt sich dabei unter anderem um folgende:
Familie, Kinder, näheres Umfeld: Diese Ressource wurde von den Befragten am häufigsten genannt.1
Realistische Ziele: Es ist nicht hilfreich, mit der eigenen Arbeit allzu hohe und hehre Ziele zu verknüpfen, wie etwa „die Folter aus der Welt zu schaffen“.
Dokumentieren, Forschen, Publizieren, Lehren: Das Reflektieren des eigenen Tuns verschafft Abstand zur Arbeit und hilft, sich von der Materie zu distanzieren.2 Die heilsame Kraft der wissenschaftlichen Auseinandersetzung mit einem Gegenstand wurde bereits im Zusammenhang mit Freuds Ausführungen thematisiert (s. 2.6.1).
Ausgleich durch kulturelle Aktivitäten, wie Literatur, Kunst, Musik, Tanzen, Theater etc.
Austausch unter Kollegen: Diesbezüglich besteht bei DolmetscherInnen noch Aufholbedarf gegenüber den PsychotherapeutInnen, die bereits in ihrer Ausbildung und auch später in der Praxis ausreichend Gelegenheit bekommen, sich mit KollegInnen laufend über ihre Gefühle und Gedanken auszutauschen.
Politisches Engagement und Öffentlichkeitsarbeit, um das Gefühl der Ohnmacht zu überwinden.
Humor: Witze (sogar auch zynische Bemerkungen3) im Team können ein Ventil für die MitarbeiterInnen darstellen und die Atmosphäre im Arbeitsalltag maßgeblich positiv beeinflussen.
Sport, Natur: als Ausgleich
Auszeiten, Sabbatjahr, Ausstieg
Sinngebung, tradierte Lebensweisheiten: Das Gefühl, etwas Sinnvolles zu tun und durch die eigene Arbeit einen Beitrag zu leisten, kann dabei helfen, trotz aller Schwierigkeiten mehr Befriedigung aus der Arbeit zu beziehen.
3.3.2.3 Narzissmus als Antrieb?
Bei der Arbeit mit traumatisierten Menschen bewegt man sich „auf einem Minenfeld mit den Abgründen menschlichen Seins“ (Pross 2009: 23). Was treibt Menschen dazu, in solchen Arbeitsfeldern Fuß zu fassen?
Pross hat in seiner Untersuchung herausgefunden, dass es unter anderem auch narzisstische Motive sind, die den MitarbeiterInnen in Traumazentren als Antrieb dienen: Selbstüberhöhung und Selbstglorifizierung in der Märtyrerrolle und die daraus abgeleitete Überzeugung, etwas Besonderes, Grandioses zu leisten, sind Mechanismen, die eine kompensatorische Funktion für den Seelenhaushalt erfüllen können, also beispielsweise ein mangelndes Selbstwertgefühl ausgleichen (vgl. Pross 2009: 118ff.).
Diese Mechanismen sind bereits in der Beziehung zwischen Helfer und Patient angelegt: Ein solches Verhältnis ist von vornherein asymmetrisch, zusätzlich neigen Flüchtlinge dazu, die TherapeutInnen zu idealisieren und ihnen magische Fähigkeiten zur Problemlösung zuzuschreiben – aus dem nur allzu verständlichen Wunsch heraus, jemanden zu haben, der einem wirklich helfen kann und will. Problematisch wird es dann, wenn HelferInnen diese Zuschreibungen und Erwartungshaltungen bereitwillig annehmen und sich als RetterInnen oder auch MärtyrerInnen aufspielen.
Interessant ist, dass Pross einen Vergleich zwischen HelferInnen in Westeuropa und in Schwellenländern zieht und zu dem Schluss kommt, dass der Narzissmus „in unserer behüteten, privilegierten Welt“ (2009: 122) in solchen beruflichen Kontexten signifikant stärker ausgeprägt ist als in den Schwellenländern, in denen Gewalt und Zerstörung zum Alltag gehören, sodass alle Menschen in ihrem unmittelbaren Umfeld davon betroffen sind und mit Überlebenden zu tun haben: „Hilfe für diese ist eine Selbstverständlichkeit, nicht so etwas Außergewöhnliches, Besonderes, und es wird deshalb nicht so viel Aufhebens darum gemacht“ (2009: 122).
Für DolmetscherInnen gilt die Rolle der „HelferInnen“ nur bedingt: Die Aufgabe der DolmetscherInnen – die Gewährleistung der sprachlichen Verständigung – ist so klar umrissen, dass eigene aktive Hilfsangebote von vornherein eine unzulässige Grenzüberschreitung darstellen, wiewohl die Entscheidung an sich, in einem Traumatherapiezentrum als DolmetscherIn zu arbeiten, durch den Wunsch „zu helfen“ motiviert sein kann. DolmetscherInnen sind also durch die Natur ihrer beruflichen Tätigkeit in ihrer Handlungsfähigkeit eingeschränkt, zugleich tragen sie weniger Verantwortung für die reale Lebenssituation der KlientInnen, was durchaus als entlastend erlebt werden kann (dieser grundsätzliche Unterschied zwischen der Arbeit der TherapeutInnen und der DolmetscherInnen wurde bereits unter 3.3.2 thematisiert).
Auch im Hinblick auf das Ansehen innerhalb der eigenen Berufsgruppe unterscheidet sich die Situation der DolmetscherInnen von der der TherapeutInnen: Geht man davon aus, dass es in einzelnen Berufsgruppen so etwas wie eine „Reputationspyramide“ geben könnte, in der bestimmte Tätigkeitsfelder als besonders angesehen gelten, so wären die TraumatherapeutInnen an der Spitze dieser Pyramide angesiedelt: Das Arbeiten mit traumatisierten Überlebenden erfordert hohe Qualifikationen und viel Erfahrung, und TraumatherapeutInnen können sich der Wertschätzung innerhalb ihrer Kollegenschaft sicher sein. Im Unterschied dazu ist das Arbeiten mit Flüchtlingen und AsylwerberInnen für DolmetscherInnen definitiv nicht an der Spitze einer solchen imaginierten Pyramide zu verorten, sondern eher am unteren Ende: Die Arbeit im Asylbereich ist für DolmetscherInnen deutlich schlechter entlohnt als die Arbeit im Konferenzbereich, und in puncto Terminologie und Dolmetschkompetenz sind die Anforderungen an die DolmetscherInnen bei internationalen Konferenzen wesentlich höher. Sehr verkürzt gesagt, ist davon auszugehen, dass ein ausgebildeter und praktizierender Konferenzdolmetscher rein arbeitstechnisch mit den Anforderungen der Gesprächssituation in der Psychotherapie spielend fertig werden könnte, während umgekehrt der durchschnittliche (Laien-)dolmetscher aus dem Asylbereich nicht ohne weiteres einen Platz in der Dolmetschkabine einnehmen kann.
Somit lassen sich die Überlegungen und Erkenntnisse von Pross im Hinblick auf narzisstische Motive bei der Arbeit mit Traumaopfern nicht von der Berufsgruppe der TherapeutInnen kurzerhand auf die Berufsgruppe der DolmetscherInnen übertragen. Dennoch sind DolmetscherInnen als Teammitglieder ähnlichen Dynamiken wie TherapeutInnen ausgesetzt, und es lohnt sich auch für DolmetscherInnen, sich mit dem Stellenwert von Traumabehandlungszentren in der Gesellschaft auseinanderzusetzen. Darauf soll im nächsten Abschnitt näher eingegangen werden.
3.4 Trauma und Gesellschaft: Abwehrreaktionen
Die oben beschriebenen Größenphantasien der HelferInnen sind in einen breiteren gesellschaftlichen Kontext eingebettet: MitarbeiterInnen von Traumazentren machen etwas Außergewöhnliches, das andere, „normale“ Menschen nicht machen können und auch nicht machen wollen:
Das lobende und bewundernde Auf-die-Schulter-Klopfen der Mitmenschen, dass man was ganz ‚Tolles‘ mache, ist im Grunde genommen eine Abwehr, die deren eigenem Schutz dient. Sie möchten mit diesen angstbesetzten Abgründen möglichst wenig zu tun haben und sind froh, dass es Leute gibt, die diese unangenehme Arbeit machen, die sonst keiner machen will. Die Gesellschaft delegiert gewissermaßen die Aufräumarbeit aus den Trümmern, die sie selbst mit Kriegen, Armut und Flüchtlingselend angerichtet hat, an die Traumahelfer, welche die seelischen und körperlichen Folgeschäden beheben sollen. Die Helfer werden im allgemeinen schlechter bezahlt und erfahren weniger Wertschätzung als andere Berufe. Dafür bekommen sie hin und wieder einen Menschenrechtspreis, oder ein Unternehmen überreicht ihnen bei einer Gala einen Scheck. (Pross 2009: 120)
Die Aussage, wonach die Helfer „weniger Wertschätzung als andere Berufe“ erfahren, bezieht sich auf die gesamtgesellschaftliche Realität, genauer gesagt auf den Umstand, dass Wertschätzung vordergründig durch Bezahlung ausgedrückt wird, denn TraumatherapeutInnen genießen unabhängig von der Bezahlung sehr wohl viel Anerkennung im Umkreis ihrer KollegInnen aus anderen Sparten, wie bereits im vorigen Abschnitt festgestellt wurde. Zentral an diesem Zitat ist jedoch der Begriff Abwehr: Mit Inhalten, die Grauen erregend und bedrohlich sind, möchte man sich normalerweise nicht auseinandersetzen (müssen), und schon gar nicht mit jenen Menschen, die als Erzählende direkte Betroffene, Zeugen und Boten dieser Inhalte sind.
Ottomeyer widmet sich ausführlich der Abwehr des Traumas und der Verfolgung der Opfer durch die Gesellschaft und bemängelt, dass manche Gutachter und Asylbeamte „Meister der Verleugnung und der Entwertung der Opfer“ seien (2011: 82), und betont, dass die Abwehr des Schreckens dazu führt, dass Opfer als unglaubwürdig dargestellt und in die Isolation getrieben würden: „Wenn aber die Opfer unseren Wohnstuben und unserem Nahraum zu nahe kommen, droht der Einbruch des mit verschiedenen Techniken auf Distanz gehaltenen Wahnsinns in die geschützte Welt“ (2011: 89).
Zu diesen „verschiedenen Techniken“ gehöre unter anderem auch der Neid auf die Opfer, der sich in einer „tief sitzenden Konkurrenzangst im Ringen um soziale Zuwendung und Aufmerksamkeit“ äußert, und zwar im Kontext gesellschaftlicher Zustände, in denen die Ressourcen zunehmend knapp werden und (mehr oder weniger berechtigte) Abstiegsängste sich breit machen. Als medial transportierte Beispiele in der jüngsten Vergangenheit Österreichs, bei denen die anfängliche Empathie mit den Opfern rasch in Neid und Missgunst kippte, nennt Ottomeyer die beiden prominenten Jugendlichen Arigona Zogaj und Natascha Kampusch (vgl. Ottomeyer 2011: 91f.).
Der Autor macht auch auf einen weiteren gesellschaftlich relevanten Aspekt aufmerksam: „Zu viel Mitgefühl mit den Opfern stört einfach den Konsum und die oberflächliche Lebensfreude, an welche wir uns im (mittlerweile bedrohten) hedonistischen Kapitalismus der letzten Jahrzehnte gewöhnt haben und gewöhnen sollten“ (S. 97). Im Zeitalter des postmodernen Kapitalismus sind es allenfalls einzelne Schrecksekunden, die zum Innehalten zwingen, ansonsten wähnt man sich aber in den westeuropäischen Gesellschaften auf der sicheren Seite und möchte mit dem Elend der Opfer lieber nicht behelligt werden. Die Helfer der Opfer (PsychotherapeutInnen, SozialarbeiterInnen, VertreterInnen von Kirchen und NGOs) müssen damit rechnen, als „Gutmenschen“ diffamiert zu werden (2011: 98f.). Unter der Überschrift „Ein Europa der Menschenjagden?“ (2011: 119) führt Ottomeyer drastische Beispiele der europäischen Abschottungspolitik an, die den Verlust von Menschenleben in Kauf nimmt und schließt mit einer Aussage, die umgelegt auf die derzeitige politische Lage aktuell anmutet: „Anderen Menschen Angst machen hilft manchen Leuten dabei, die Angst, die sie haben, nicht spüren zu müssen“ (2011: 134).
3.5 Abschließende Bemerkungen
Wie bereits erwähnt, ist das Dolmetschen kein klassischer „Helferberuf“ und somit zählen die DolmetscherInnen im Kontext der Psychotherapie nicht zu den klassischen „HelferInnen“, weil sie keine eigenen Interventionen setzen und nicht für die Erreichung von Therapiezielen zuständig sind; als SprachmittlerInnen ermöglichen und befördern sie jedoch die Arbeit der HelferInnen mit den KlientInnen und sind damit Teil der ablaufenden Prozesse. Daher sind sie von den Dynamiken in diesem Mikrokosmos zumindest am Rande betroffen, so auch vom Umgang der Gesellschaft mit Asylsuchenden und Opfern von Menschenrechtsverletzungen. Die psychotherapeutische Arbeit mit traumatisierten Menschen stellt auch an die DolmetscherInnen spezifische Anforderungen, sowohl im individuellen Zugang zu den einzelnen KlientInnen, als auch im Hinblick auf die Reflexion des Phänomens „Trauma“ in einem gesamtgesellschaftlichen Kontext.