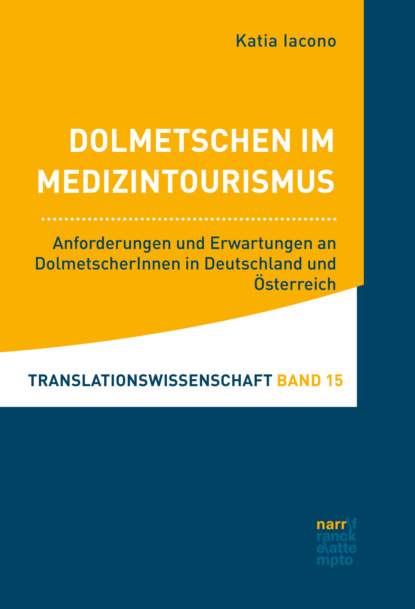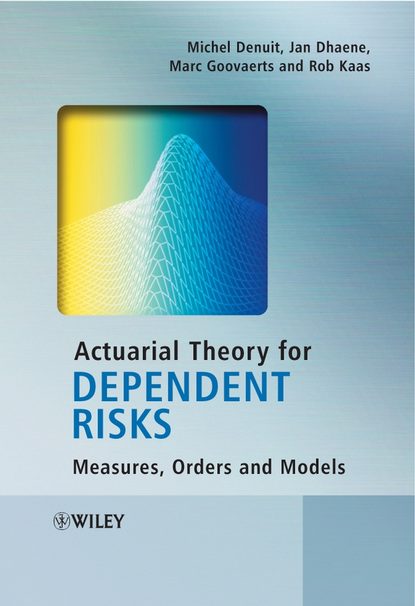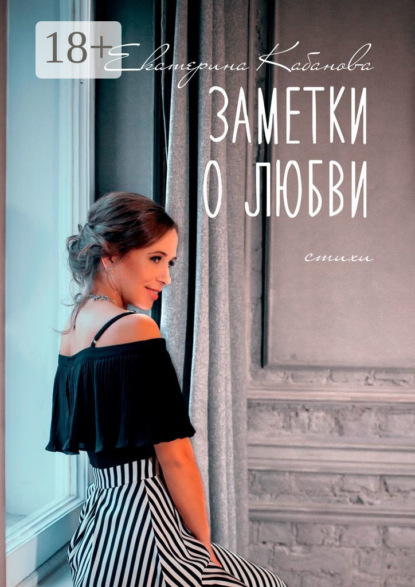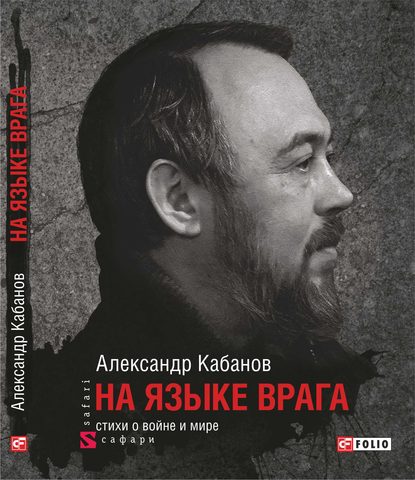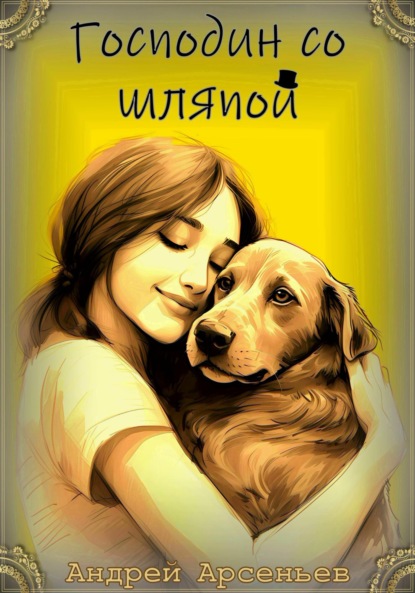Dolmetschen in der Psychotherapie
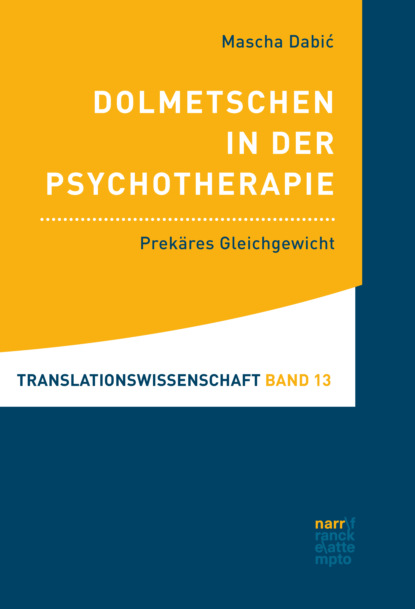
- -
- 100%
- +
Was den dritten Aspekt bei Alexieva anbelangt, nämlich konfligierende Zielvorstellungen, so wurde bereits erwähnt, dass Irritationen und Konflikte durchaus Teil des psychotherapeutischen Settings sind. Unterschiedliche, geradezu entgegengesetzte Erwartungshaltungen (s. 4.2) an die DolmetscherInnen können ebenfalls für Konflikte sorgen.
Im Hinblick auf Alexievas Schema lässt sich festhalten, dass das psychotherapeutische Setting sich einer eindeutigen Kategorisierung entzieht. Die therapeutische Expertise, die sich zusammensetzt aus jahrelanger Ausbildung, intensiver Selbsterfahrung, eigener Praxis sowie laufender, qualifizierter, kollektiver Reflexion der eigenen Praxis im Rahmen von Supervisionen und Intervisionen, besteht gerade darin, für jede Klientin und jeden Klienten einen individuellen, eigens auf die jeweilige Lebenssituation und die jeweiligen psychischen Kapazitäten abgestimmten Zugang zu finden. Dieser Umstand erfordert von DolmetscherInnen ebenfalls Flexibilität, Einfühlungsvermögen und laufende Reflexionsfähigkeit.
Tribe & Morrissey weisen auf einen Zusammenhang zwischen Flüchtlingsstatus (also erzwungener Fluchterfahrung) und psychiatrischen Problemen hin (2003: 202). Kulturschock oder reaktivierte Inhalte und der Verlust von Identität und kulturellen Werten werden als Erklärungen für diese Korrelation herangezogen. Dank des Einsatzes von DolmetscherInnen ist es möglich, dass diese Menschen Zugang zu psychiatrischer und psychotherapeutischer Versorgung erhalten: „(…) interpreters may play an indispensable role in mental health assessments and in ensuring that access to mental health services is possible“ (2003: 204). Dabei ist zu bedenken, dass es fast überall in der Welt ein Stigma ist, psychische oder emotionale Probleme zu haben, dass aber die Idee eines Fachmanns oder einer Fachfrau, der/die für diesen Bereich zuständig ist, nicht überall verankert ist; stattdessen kann es ein älteres Familienmitglied, ein traditioneller Heiler, der Gemeinschaftsälteste oder ein Alternativmediziner sein, an den man sich in solchen Fällen wendet. Die Idee, dass man seine Gedanken und Gefühle einem Fremden anvertraut, ist Teil eines westlichen Konzepts von Psychotherapie und kann anderswo als befremdlich wahrgenommen werden und dazu führen, dass fremdsprachige PatientInnen es vorziehen, über körperliche Schmerzen und Symptome zu klagen, anstatt sich über ihre Ängste zu unterhalten (2003: 206). Vor diesem Hintergrund kann die Präsenz einer DolmetscherIn eine zusätzliche Aufwertung erfahren, denn die DolmetscherIn ist zumindest mit der Sprache der KlientIn vertraut und stellt somit einen Anknüpfungspunkt an Vertrautes dar.
Köllmann führt zwei wesentliche Punkte ins Treffen, in denen sich die Tätigkeit im psychotherapeutischen Setting von anderen Einsatzbereichen für DolmetscherInnen unterscheidet: Zum einen begleitet die DolmetscherIn in der Regel einen Therapieprozess über einen längeren Zeitraum hinweg, sodass eine vertrauensvolle Beziehung zwischen DolmetscherIn und PatientIn entsteht. Zum anderen sind die Themen, die in Therapiesitzungen zur Sprache kommen, häufig emotional sehr belastend, was in anderen Bereichen für gewöhnlich nicht der Fall ist, oder wovon zumindest nicht von vornherein auszugehen ist (2011: 55).
Bot beschreibt das Dilemma, mit dem eine ausgebildete und praktizierende Psychotherapeutin konfrontiert ist, wenn die gewohnte Dyade zu einer Triade erweitert werden muss:
As a psychotherapist I have been taught to word my interventions very carefully – the choice of words, tenses and mood each infuence the effect of the intervention. At the same time I have no idea what the interpreter is doing to my words – does he retain the therapeutic intention that I put in them or does he turn them into something completely different? Likewise, what happens to the words used by the patient? Pasychotherapists have also been taught of the importance of a therapeutic relationship. It has to be built up carefully between therapist and patient. At the same time I needed to deal with the situation that the interpreter could be ‚anyone‘ – so one session with a patient I would have one interpreter to assist us, whereas in the next session witht the same patient there would be another interpreter. How could I explain and justify this? (2005: 5)
Der Aufbau einer therapeutischen Beziehung – die Hauptaufgabe einer TherapeutIn – muss in diesem Fall also in enger Zusammenarbeit mit einer dritten Person erfolgen, von der nicht a priori davon ausgegangen werden kann, dass sie die Bereitschaft und/oder die Fähigkeit mitbringt, das Konzept einer therapeutischen Beziehung intellektuell und emotional nachzuvollziehen und in weiterer Folge aktiv mitzugestalten. Bot vergleicht die Arbeitsweise von DolmetscherInnen in der Psychotherapie mit anderen Kontexten: Polizeieinvernahmen, Gespräche mit Bewährungshelfern, Gespräche in der Notaufnahme, bei Gericht etc. Bei Konferenzen gäbe es allerdings wenig Interaktion zwischen DolmetscherIn, SprecherIn und dem Publikum. „Each of these situations is in some way similar and in other ways different from the situation that I studied“ (Bot 2005: 27).
Pinzker plädiert dafür, die triadische psychotherapeutische Gesprächssituation als ein eigenständiges Setting innerhalb der Psychotherapie zu betrachten und darauf zu verzichten, Vergleiche zur Dyade zu ziehen oder die Unsichtbarkeit der DolmetscherIn anzustreben. Maschinelle oder technische Modelle für die Rolle der DolmetscherIn sollten als Mythen entlarvt werden und einer offenen (auch ergebnisoffenen) personenbezogenen Grundhaltung gegenüber dem psychotherapeutischen Setting Platz machen (2015: 35ff.). Pinzker empfiehlt daher gerade NeueinsteigerInnen, „‚alten‘ Leitfäden“ kritisch zu begegnen, sich ganz bewusst auf die neue Konstellation Psychotherapeutin-Dolmetscherin-Klientin einzulassen und sich zunächst einzugestehen, dass man eben (noch) nicht weiß, „wie es geht“, in diesem Setting zu arbeiten:
Dies gilt es vielleicht zunächst einmal „nur auszuhalten“, ohne sofort nach „Leitfäden“ zu rufen oder sich an einen Dyade-Vergleich zu klammern. Es gibt keinen Vergleich. Es handelt sich um etwas Neues, sozusagen Beispielloses. Die Triade mit dem Einzelsetting ohne Dolmetscherin zu vergleichen oder aus ihm für die Arbeit in der Triade etwas „ableiten“ zu wollen, erscheint mir nicht zielführend, im Gegenteil, mit Blick auf das Datenmaterial, vielmehr hinderlich. (2015: 46)
Pinzkers Ansatz mag aus psychotherapeutischer Sicht geradezu radikal anmuten, es ist aber gerade eine solche Haltung, die sich als produktiv erweisen kann – offen für noch unbekannte Dynamiken, frei von Zwängen, sich an „alte Leitfäden“ zu halten, die den aus der triadischen Konstellation erwachsenden Komplikationen nicht ausreichend Rechnung tragen können.
Aus translationswissenschaftlicher Sicht ist die Präsenz der DolmetscherIn in einer triadischen Gesprächssituation so selbstverständlich, dass sie im Grunde keiner weiteren Erwähnung bedarf: Überall dort, wo eine DolmetscherIn anwesend ist und ihre Sprach- und Dolmetschkompetenz den GesprächspartnerInnen zur Verfügung stellt, findet eben ein dolmetschgestütztes Gespräch statt und ist somit für die Translationswissenschaft von Relevanz und von Interesse. Aus der Sicht der psychotherapeutischen Tradition und also der Psychotherapieforschung jedoch ist die Präsenz einer dritten Person geradezu ein revolutionärer Akt, in dem Sinn, dass eine solche Arbeitsweise Altbekanntes außer Kraft setzt und neue Denkweisen auf den Plan ruft. Diese Diskrepanz zwischen der Wahrnehmung des triadischen psychotherapeutischen Settings aus der Perspektive der Translationswissenschaft einerseits und der Psychotherapieforschung andererseits gilt es bei der Beschreibung und Bewertung der Möglichkeiten und Grenzen eines solchen Settings zu bedenken.
4.2.1 „Bühne“ und „Rolle“
Berufsgruppen agieren permanent in gesellschaftlichen und kulturellen Zusammenhängen – das trifft auch auf wenig professionalisierte und stark heterogene und fragmentierte Berufsgruppen zu.
Der kanadische Soziologe Erving Goffman vergleicht das soziale Leben mit einer komplexen Bühne, auf der ein Ensemble von DarstellerInnen vor einem Publikum auftritt und in bereits vorgegebene Rollen schlüpft, stets darauf bedacht, die Fassade aufrechtzuerhalten, die Rolle glaubhaft zu verkörpern und gegebenenfalls den vom Publikum an den Darsteller herangetragenen Idealisierungen und Mystifikationen Rechnung zu tragen (vgl. Goffman 1969/2003). Das glaubhafte Verkörpern der Rolle der DolmetscherIn ist in einer gegebenen Situation eng verknüpft mit der Dolmetschkompetenz, die zu dem jeweiligen Zeitpunkt und im jeweiligen Kontext abgerufen werden kann, allerdings ist der Faktor der Präsentation ein nicht zu vernachlässigender: Eine Verdolmetschung kann fehlerhaft und/oder unvollständig sein, und dennoch kann es der DolmetscherIn gelingen, durch ein selbstsicheres Auftreten und eine gelungene Präsentation einen positiven Eindruck beim Publikum zu hinterlassen, d.h. bei der Zuhörerschaft das Gefühl hinterlassen, man habe „alles verstanden“; umgekehrt kann eine vollständige, korrekte Verdolmetschung durch eine mangelhafte Präsentation unglaubwürdig klingen. Goffman beschreibt die Anforderungen an eine Rolle folgendermaßen:
Denn wenn die Tätigkeit des Einzelnen Bedeutung für andere gewinnen soll, muß er sie so gestalten, daß sie während der Interaktion das ausdrückt, was er mitteilen will. Es kann in der Tat vorkommen, daß von dem Darsteller Beweise seiner Fähigkeit nicht nur im gesamten Verlauf der Interaktion, sondern auch innerhalb eines Sekundenbruchteils verlangt werden. Wenn etwa der Schiedsrichter beim Baseballspiel den Eindruck erwecken will, er sei sicher in seinen Entscheidungen, so muß er auf den Augenblick der Reflexion verzichten, der ihm gerade die Sicherheit geben könnte. Er muß sofort eine Entscheidung fällen, damit das Publikum sicher sein kann, dass sein Urteil richtig ist. (Goffman 1969/2003: 24)
Diese Aussage trifft auf das Dolmetschen ebenfalls zu: Es gilt, „innerhalb eines Sekundenbruchteils“ das Original – also den Sprechakt – in sämtlichen Facetten (Inhalt, Bedeutung, Tonlage, Humor, Realien, Anspielungen etc.) zu verstehen und in der Zielsprache so vollständig und so korrekt wie möglich wiederzugeben. Geschwindigkeit ist im Unterschied zum schriftlichen Übersetzen von entscheidender Bedeutung, denn damit eine DolmetscherIn einen kompetenten Eindruck macht, muss sie in der Lage sein, nicht nur korrekt, sondern auch schnell zu arbeiten. Verlangsamungen, die sich durch Sprechpausen und Häsitationen manifestieren, führen dazu, dass insgesamt ein Eindruck entsteht, die DolmetscherIn sei inkompetent und/oder mit der gegebenen Situation überfordert. Bleiben wir bei der Rollenmetapher, so gilt es festzuhalten, dass die DolmetscherIn eben nicht die Möglichkeit hat, ihren Text vorzubereiten und den Vortrag zu üben. Stattdessen geht es in der Dolmetschsituation darum, sämtliche sprachliche und sonstige Wissensbestände „innerhalb eines Sekundenbruchteils“ abzurufen, um die Aufgabe des Verstehens und Verständlichmachens bestmöglich erfüllen zu können. Gefragt ist also eine solide Vorbereitung im Hintergrund im Sinne einer langfristig akkumulierten Kompetenz, sowie eine optimale (improvisierte) Performance der Rolle im Hier und Jetzt.
Goffman definiert mehrere Sonderrollen: „die des Denunzianten, des Claqueurs, des Kontrolleurs, des professionellen Einkäufers und des Vermittlers“ (ebda. S. 90). Goffmans Überlegungen zu der letztgenannten Rolle, der des Vermittlers, thematisieren ethische Dilemmata von DolmetscherInnen (in der Psychotherapie, aber auch in anderen Kontexten):
Der Vermittler erfährt die Geheimnisse beider Seiten und erweckt bei jeder Seite den berechtigten Eindruck, daß er ihre Geheimnisse bewahren werde; er ist aber bestrebt, bei jeder Seite den falschen Eindruck zu erwecken, als sei seine Loyalität ihr gegenüber größer als seine Loyalität gegenüber der anderen Seite (…) Die Tätigkeit des Vermittlers als Individuum ist bizarr, unhaltbar und würdelos, wie sie solchermaßen zwischen Loyalität zu dem einen und zu dem anderen Ensemble hin- und herschwankt. (ebda. S. 90)
Der Loyalitätskonflikt, der aus divergierenden, einander mitunter entgegengesetzten Nutzererwartungen resultiert, kann sich gerade im Kontext der Psychotherapie stark manifestieren, indem jeder der beiden GesprächspartnerInnen versucht, die DolmetscherIn an seine/ihre Seite zu ziehen: einerseits die Psychotherapeutin als die arbeitende Fachperson, die an die Berufsethik der DolmetscherIn appelliert, andererseits die KlientIn als eine GesprächsteilnehmerIn, die darauf angewiesen ist, sich mit Hilfe der DolmetscherIn in einer für sie prekären Situation Gehör zu verschaffen und Hilfe zu bekommen.
Kadrić macht das Bühnen-Konzept von Goffman fruchtbar für die Translationswissenschaft (vgl. Kadrić et al. 2005: 12ff.). Die Bühne setzt sich zusammen aus einer Vorderbühne, die den repräsentativen Bereich darstellt, der von der Öffentlichkeit, also vom Publikum wahrgenommen wird, und einer Hinterbühne, von welcher das Publikum ausgeschlossen ist und wo die Ensemblemitglieder weitgehend ungestört Vorbereitungen für ihren Auftritt auf der Vorderbühne treffen können. Das Handeln der Ensemblemitglieder untereinander, gegenüber dem Publikum und gegenüber der Sache basiert auf Loyalität, Kooperation, Vertrauen und Solidarität.
Die Institutionen dienen dazu, bestimmte Werte der Gesellschaft zu verwirklichen bzw. diese durch Vorgaben und Normen verbindlich zu machen. Die Bestrebungen des Berufsstandes, sein Image in der Öffentlichkeit möglichst positiv darzustellen, wurden bereits thematisiert.
Die Institutionen erwarten, dass ihre Mitglieder bestimmte Rollen, bestimmte Handlungsmuster übernehmen. So werden die Mitglieder zu ‚Darstellerinnen‘, die die institutionserwünschten Handlungsmuster durch die Aneignung von spezifischen Techniken beherrschen, die ihnen bei ihrer ‚Inszenierung‘ helfen. Es geht dabei darum, den Eindruck zu erwecken und zu festigen, dass man als Angehörige einer bestimmten Berufsgruppe alle Kriterien erfüllt, an denen man in der Arbeitswelt gemessen wird: Präzision, Kompetenz, Sachlichkeit, Zuverlässigkeit, Vertrauen. Als ‚Darstellerin‘ bemüht man sich, dieses bestimmte Bild in der Öffentlichkeit zu vermitteln: Man soll als Zugehörige der betreffenden Gruppe alle diese verschiedenen Kriterien erfüllen. (ebda. S. 16)
Die akademische Ausbildung bildet die Hinterbühne für die TranslatorInnen. In diesem Raum werden außer der konkreten Kompetenzvermittlung auch ethische Werte wie Loyalität, Kooperation und Solidarität vermittelt und verhandelt, es findet also eine fachliche Enkulturation oder Rollenarbeit auf der Hinterbühne statt, sodass der Entwicklung einer Translationskultur Vorschub geleistet wird.
4.2.1.1 Sonderposition der Psychotherapie: abseits der Bühne
Das psychotherapeutische Setting ist nachgerade das Gegenteil einer Bühne. Die psychotherapeutische Arbeit findet unter Ausschluss des Publikums statt, im Rahmen der größtmöglichen Verschwiegenheit und Diskretion. Die absolute, garantierte Exklusivität sowie ein radikal individueller Zugang zu jeder KlientIn – also der bewusste Verzicht auf standardisierte Verfahren und Vergleichbarkeit – bilden den besonderen Wert dieser kommunikativen Situation. Die oben erwähnte Bühnenmetapher lässt sich bis zu einem gewissen Grad auf den Berufsstand der PsychotherapeutInnen anwenden, in erster Linie insofern, als die Ausbildungsstrukturen und die rege Vernetzung in Form von regelmäßigen Inter- und Supervisionen der fachlichen Enkulturation und der Weiterentwicklung des Fachs dienen; auf der „Vorderbühne“ agieren PsychotherapeutInnen, indem sie anlassbezogen ihre gewonnenen Einblicke an ein Fachpublikum oder eine interessierte Öffentlichkeit weitergeben. In der konkreten, täglichen Arbeit geht es jedoch darum, einen Raum zu schaffen, in dem traumatisierte Menschen die Möglichkeit erhalten, sich ganz und gar mit dem eigenen, individuellen Erleben auseinanderzusetzen, auf eine Weise, die für sie persönlich passend erscheint; aus der Sicht der KlientInnen handelt es sich um eine Art „Rückzugsraum“ und weniger um eine öffentliche Einrichtung, die mit dem Ziel, etwas Bestimmtes zu erledigen, aufgesucht wird. In Anlehnung an die Theatermetapher könnte man sagen, das psychotherapeutische Setting konstituiert eine wöchentlich wiederkehrende kommunikative Situation, in der die KlientIn die Möglichkeit hat, sich auf einer freiwilligen Basis zu öffnen, Stück für Stück ihre „Maske“ oder ihren „Panzer“ abzulegen (bzw. mit der Unterstützung der PsychotherapeutIn einen Blick hinter die eigene, im normalen Leben notwendig gewordene „Maske“, den eigenen „Panzer“, die eigene „Kulisse“ zu werfen), sich gegebenenfalls mit traumatisierenden Erlebnissen zu konfrontieren, diese Inhalte zu integrieren und jedenfalls einen Weg zu finden, die Gegenwart zu bewältigen und Perspektiven für die Zukunft zu entwickeln.
Nur das Erstgespräch (also das Aufnahmegespräch) in einem Traumabehandlungszentrum folgt einem bestimmten Schema: Da werden routinemäßig die persönlichen Daten abgefragt, es wird festgehalten, durch welche Einrichtung die KlientIn zur Psychotherapie zugewiesen wurde, es wird geklärt, welche Symptomatik besteht und ob und welche Behandlung bereits in Anspruch genommen wurde. Nach Abwicklung des Erstgesprächs findet eine Zuweisung zu einer PsychotherapeutIn statt (meist nach einer Wartezeit, die einige Monate dauern kann), und ab diesem Zeitpunkt beginnt die eigentliche psychotherapeutische Arbeit – unter Ausschluss jeglicher Öffentlichkeit und mit dem einzigen Ziel, eine Annäherung an die persönliche Geschichte der KlientIn zu ermöglichen. Das heißt, ein Gespräch ist nicht dann zu Ende, wenn die notwendigen Informationen ausgetauscht wurden und das weitere Vorgehen geklärt ist, wie dies bei Beratungsgesprächen (z. B. Sozial- und Rechtsberatung) der Fall ist, sondern es ist so, dass eine KlientIn, die einen Psychotherapieplatz zuerkannt bekommen hat, jede Woche eine Stunde Gesprächszeit zur Verfügung gestellt bekommt, die sie auf ihre ganz individuelle Art und Weise nützen kann.
Therapien können sich über Jahre erstrecken. Damit die Erreichung der explizit oder implizit definierten Therapieziele (siehe 3.3.1) gelingen kann, ist es notwendig, dass eine Beziehung zwischen der PsychotherapeutIn und der KlientIn entstehen kann. Am Aufbau dieser Beziehung ist die DolmetscherIn maßgeblich beteiligt – sei es durch aktive Teilnahme, sei es durch bewusste Zurückhaltung – und ist außerdem im Idealfall ein integrierter, kontinuierlicher Bestandteil dieser Beziehung.
In der Landschaft des Community Interpreting (Behörden, medizinische und soziale Einrichtungen, Gerichte etc.) nimmt die psychotherapeutische Behandlung eine Sonderrolle ein, insofern als es nicht darum geht, ein bestimmtes „Ziel“ zu erreichen, im Sinne einer Bestätigung oder Erlangung einer konkreten Berechtigung, sondern das eigentliche Ziel der Psychotherapie ist die psychotherapeutische Arbeit selbst: eine auf freiwilliger Basis erfolgende Auseinandersetzung mit den eigenen Erinnerungen und Emotionen. Zwar können psychotherapeutische Gutachten im Asylverfahren ein gewisses Gewicht erlangen, aber im Prinzip dient eine Psychotherapie keinem bestimmten Zweck, der sich im Asylverfahren in einem bürokratischen Sinne „verwerten“ ließe. Für die DolmetscherInnen geht diese Erkenntnis mit der Anforderung einher, bereit zu sein, sich auf die spezifische, psychotherapeutische Kommunikation einzulassen, Teil des Beziehungsgeflechts zu sein, Übertragungen und Gegenübertragungen in der Triade ausgesetzt zu sein und diese zu reflektieren (sei es mit Hilfe der jeweiligen PsychotherapeutIn, sei es im Rahmen der Supervision) und aktiv auf das eigene psychische Wohlbefinden zu achten.
4.2.2 Überlegungen zur Ethik
Kadrić (2016) thematisiert Haltungen und Werte im Zusammenhang mit dem Dolmetschen und hebt die Wahrung der Menschenwürde hervor, als einen Wert, dem DolmetscherInnen, indem sie einen „Dienst am Menschen“ verrichten, verpflichtet sind. In Situationen, in denen sich moralische Dilemmata manifestieren, müssen DolmetscherInnen den Menschen, mit dem und für den sie sprechen, berücksichtigen. Menschenwürde als ein zentraler Begriff bedeutet auch eine didaktische Herausforderung, und zwar im Sinne einer emanzipatorischen Didaktik, die das (Dialog)Dolmetschen folgendermaßen definiert:
(…) ein Tätigkeitsfeld, in dem emanzipatorisches Handeln besonders effektiv ausprobiert werden kann – neben der Textarbeit und Entdeckung sprachlicher und kultureller Differenzen können soziale Konventionssysteme, Machtdifferenzen und beeinflussende Konzepte analysiert werden, der Umgang mit ihnen reflektiert und Alternativen ausprobiert werden. Und überall dort, wo es um tief menschliche Themen geht, ist die Wahrung der Würde zentral. Es geht beim Lernen weniger um Wissen, nicht einmal um exakt definierbare Verhaltensregeln, sondern um eine Haltung, die hinter der Berufsausübung stehen soll. Die Haltung selbst ist freilich ein Gebot, das sich aus moralischen und rechtlichen Prinzipien ableiten lässt. (Kadrić 2016: 111)
Im Kontext der Psychotherapie ist der Begriff der Würde des Menschen von zentraler Bedeutung.
Berufskodizes resultieren aus dem Bestreben und dem Wunsch sicherzustellen, dass die Verbandsmitglieder sich an bestimmte Normen halten und ihren Beruf mit einer verantwortungsbewussten Einstellung ausführen (siehe die Auseinandersetzung mit dem Verhaltenskodex des Internationalen Konferenzdolmetscherverbandes AIIC; Kadrić et al 2005: 17ff.). Von hohen Standards innerhalb einer Berufsgruppe profitieren alle Beteiligten, bzw. gilt im Umkehrschluss, dass eine Missachtung solcher Standards einen Imageschaden des Berufsstands zu Folge haben kann.
Soweit die Theorie. In der Praxis sind DolmetscherInnen häufig auf sich allein gestellt und müssen die Erfahrung machen, dass die formulierten Normen sich mit den realen Situationen, denen sie ausgesetzt sind, in die sie oft „hineingeworfen“ sind, nicht decken und sich daraus keine Handlungsanweisungen ableiten lassen.
Ozolins weist darauf hin, dass in Situationen, in denen nichtprofessionelle DolmetscherInnen zum Einsatz kommen, sich die Frage nach der ethischen Verantwortung stellt: Ist eine LaiendolmetscherIn verpflichtet, sich an den Berufskodizes zu orientieren und professionelle Verantwortung zu übernehmen? Es ist möglich, dass eine LaiendolmetscherIn sich ihrer ethischen Verantwortung gar nicht bewusst ist. In einem solchen Fall ist die Person, die den Arbeitsauftrag an die LaiendolmetscherIn vergeben hat, die eigentliche Trägerin der ethischen Verantwortung, auch wenn er/sie wenig Vorstellung von den Implikationen dieser Entscheidung hat, weil er/sie über mangelhaftes Wissen über die Anforderungen an das Dolmetschen verfügt (2015: 319).
Bahadır diskutiert berufsethische Aspekte im Spannungsfeld zwischen Verantwortung und Freiheit und plädiert dafür, situativ notwendige Grenzüberschreitungen (z. B. aus der Rolle fallen, mehrere Rollen auf einmal spielen wollen oder müssen) als „Kratzer auf der Oberfläche der professionellen Identität und Handlungsweise des Dolmetschers“ (2007: 214) zu betrachten und diese Kratzer nicht etwa zu ignorieren oder wegzupolieren, sondern sich im Gegenteil aktiv damit auseinanderzusetzen:
Eben diese Kratzer gilt es zu vertiefen (…) Kratzer bedeuten, dass man Schmerz verspürt und dadurch sich selbst intensiver wahrnimmt. Sein Tun wahrnehmen, in jeder Situation von neuem und als neu, bedeutet wiederum, dass Leitsätze, aufgestellt durch die institutionalisierte Form einer Tätigkeit (z. B. durch Berufsverbände) nicht mehr als immer und überall leitend, sondern als ‚Leitungsangebot‘ angesehen werden können. (Bahadır: 2007: 214).
Die Dolmetschtätigkeit bringt oft „eine besondere Art des Völlig-auf-sich-selbst-gestellt-Seins, eine Art Einsamkeit und In-eine-Situation-Geworfensein mit sich“ (2007: 216). Somit sollte die Fähigkeit, sich mit sich selbst auseinander zu setzen, als hilfreich angesehen werden. Bahadır ortet jedoch stattdessen eher ein Bedürfnis nach Eskapismus und Reduktionismus im Hinblick auf Selbstreflexion. Die Fähigkeit, Ereignisse während des Dolmetschens schnell und effektiv zu verarbeiten, würde somit als professionell distanziert bewertet.