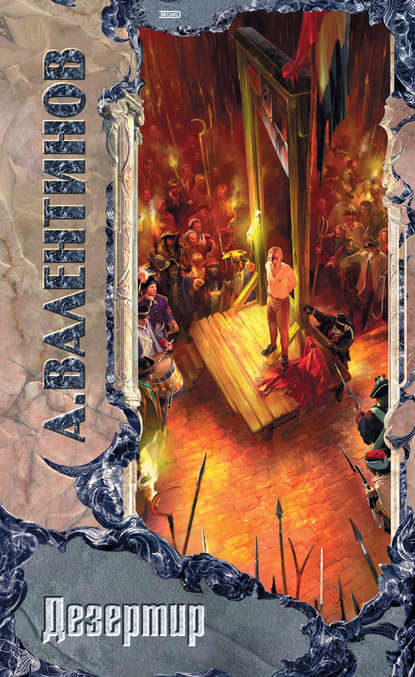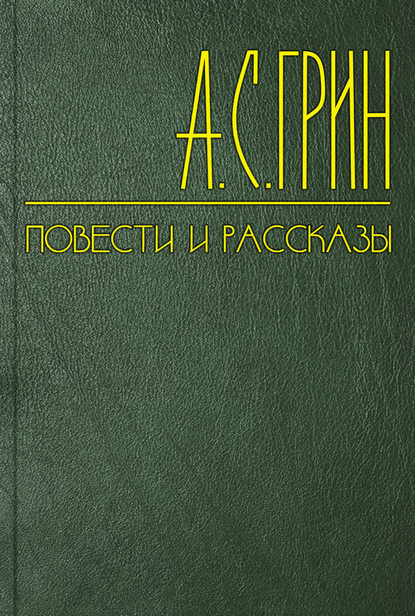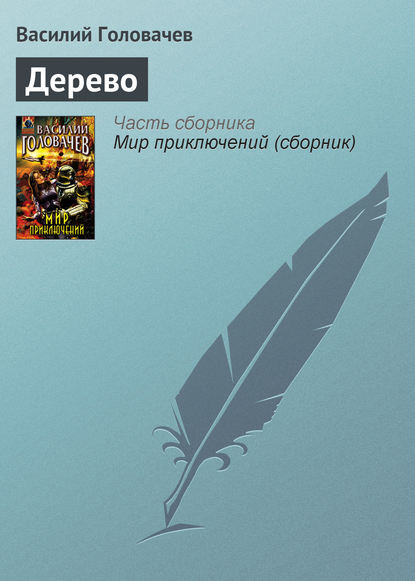- -
- 100%
- +
Auch bei den BEE GEES war es der Misserfolg des Vorgängeralbums, der die Veröffentlichung einer weiteren Platte verhinderte. »Life in a Tin Can« von 1973 brachte lediglich eine Single hervor, die gerade mal Platz 94 in den US-Charts erreichte. Robert Stigwood, Chef von RSO Records und gleichzeitig Manager der Band, lehnte den Nachfolger mit dem wunderschönen Titel »A Kick in the Head Is Worth Eight in the Pants« ab, nachdem die Vorabsingle »Wouldn’t I Be Someone« floppte. Einige der aufgenommen Songs schafften es dann immerhin auf spätere Single-B-Seiten.
Ganze zehn Jahre wiederum versuchte die Sängerin JOJO ihr drittes Album zu veröffentlichen. Mit 13 Jahren war sie die jüngste Solokünstlerin mit einer No. 1 Single in den US-Charts, doch nach ihrem zweiten Album im Alter von 16 Jahren wurde es still um sie. Drei verschiedene Fassungen spielte sie von ihrem dritten Album »All I Want Is Everything« ein, doch ihr Label Da Family Entertainment weigerte sich immer wieder, es zu veröffentlichen und verschob den Release-Termin so oft, dass JoJo letztendlich klagte, um aus dem Vertrag entlassen zu werden. Aber auch bei ihrem nächsten Label Blackground Records erschien das Album – nun unter dem Titel »Jumping Trains« – nicht. Vielmehr noch, das Label reagierte irgendwann gar nicht mehr auf die Anfragen der Sängerin, die daraufhin wieder Klage einreichte. Label und Künstlerin einigten sich außergerichtlich und JoJo wurde abermals aus ihrem Vertrag entlassen. Durch all die Rechtsstreite mit ihren Labels konnte sie erst zehn Jahre nach ihrem zweiten Album ihr drittes Werk veröffentlichen.
Letztendlich trifft die Frage nach dem Hit meist größere Stars. Eben dort, wo große Marketingbudgets und Kosten wieder eingespielt werden müssen. Da ist es mitunter billiger, bereits fertig aufgenommene Werke komplett zu verwerfen, statt Mitarbeiter*innen der Plattenfirma mit Promotion, Tourplanung, Videodrehs und weiteren kostspieligen Aktionen zu beschäftigen.
Mitunter ist es aber auch der massive künstlerische Output, der dem Label ein Dorn im Auge ist. Schließlich ist es finanziell nicht zuträglich, wenn der Fan eine*r Künstler*in sich zwischen zwei Alben entscheiden muss, die zeitnah erschienen. PRINCE konnte davon nicht nur Lieder singen, sondern ganze Alben (nicht) veröffentlichen. Dazu aber an anderer Stelle mehr. Auch FRANK ZAPPA musste viel Material für sich behalten. Als er dem Rolling Stone 1968 von seiner 3-LP-Box »No Commercial Potential« erzählte, hätte man seine Ausführung zur Box für einen Witz halten können. Allerdings erschienen einige der beschriebenen Songs später tatsächlich: zum einen auf dem Mothers-of-Invention-Album »Cruising with Ruben & the Jets« und zum anderen als Doppel-LP unter dem Titel »Uncle Meat«, die gleichzeitig Soundtrack zu einem gleichnamigen Film war, der allerdings erst 1987 in unvollendeter Form veröffentlicht wurde. Zappa äußerte sich laut seinem Biografen Barry Miles zu »Ruben & the Jets« sowie »Uncle Meat« wie folgt:
»Es ist alles ein einziges Album. Das komplette Material aller Alben hat einen inneren Zusammenhang, und wenn ich sämtliche Masterbänder hätte und sie mit einer Rasierklinge auseinanderschneiden und neu montieren würde, dann würde das wieder ein komplettes Stück hörenswerter Musik ergeben. […] Das Material hat definitiv einen Zusammenhang.«
1976 unterschrieb Zappa zudem einen Vertrag mit Mercury-Phonogram für eine 4-LP-Box namens »Läther«. Doch er hatte noch eine vertragliche Verpflichtung mit Warner Bros. einzulösen. In einem Rutsch lieferte er vier LPs an das von ihm verhasste Label. Doch keine der Platten wurde von Warner bezahlt und lediglich das Album »Zappa in New York« wurde zur Veröffentlichung angekündigt. Also stellte Zappa dann für Mercury seine legendäre 4-LP-Box »Läther« zusammen. Wohlgemerkt zu großen Stücken aus dem Material, das er zuvor Warner Bros. zur Erfüllung seines Vertrags lieferte. 300 Testpressungen ließ das Label herstellen, bis Warner Bros. dem Ganzen einen Riegel vorschob, da sie schließlich die Rechte besaßen und Teile der Box identisch mit dem angekündigten Album »Zappa in New York« waren. Da Zappa weder bezahlt worden war, noch eines seiner vier zuletzt abgelieferten Alben bis dato veröffentlicht wurde, ging er davon aus, dass Warner auf seine Option verzichtete und die Rechte an dem Material damit wieder an ihn zurückfallen würden. Letztendlich verhinderte dieser Irrtum aber ein ambitioniertes Werk. Ob die 1996 postum veröffentlichte Version von »Läther« der Vision Zappas entspricht, wird bis heute hart debattiert. So fehlt bei der CD u. a. der Song »Baby Snakes« und die Reihenfolge der Stücke soll ebenfalls von Zappas geplanter Abfolge abweichen. Andererseits stimmt das Tracklisting mit dem der Testpressung von Mercury überein.
Letztendlich reden wir bei aller Kunst hier von einem Geschäft. Auch in der Musikbranche geht es um Geld und Gewinnmaximierung. Daher ist der Zukauf von Firmen auch hier keinesfalls unüblich. Ein Label gehört plötzlich einer anderen Firma, und die hat womöglich ganz andere Prioritäten als die vorherigen Besitzer*innen. Oder: Ein Weltstar beschließt kurzfristig ein neues Werk zu veröffentlichen. Ein solches Unterfangen bindet womöglich die keineswegs unendlichen finanziellen wie personellen Ressourcen eines Labels. Auch bei einem Major wird da mitunter wirtschaftlich konservativ investiert und der garantierte Verkaufshit eines Stars eine*r Newcomer*in vorgezogen.
Manchmal verlieren auch die zuständigen A&Rs den Job. Das heißt noch lange nicht, dass die Bands oder Sänger*innen, die mit ihrer Hilfe gesignt wurden, ihre Verträge verlieren. Oft heißt es aber, dass sich die Ansprechtpartner*innen ändern. Aber dass die neuen Zuständigen die gleiche Leidenschaft für die Künstler*innen aufbringen wie ihre Vorgänger*innen ist nicht immer der Fall.
Genauso bestimmen Trends das Verhalten von Labels. Boy Bands sind ein großer Erfolg? Signt jede Boy Band, die ihr bekommen könnt. Wenn dann der Hype abflaut, sitzt die Band womöglich dort mit ihrem Vertrag und hat noch nicht mal eine einzige Single veröffentlicht. Da Boy Bands nun aber out sind, wird es auch nicht mehr dazu kommen. So gibt es Gerüchte, dass Labels potentielle »Konkurrenzprodukte« lediglich unter Vertrag genommen haben, um sie vom Markt fernzuhalten. Schließlich könnte ein weiteres Produkt für die gleiche Zielgruppe den Erfolg ihres Zugpferdes schmälern. Ein einziger Justin Bieber verkauft eben mehr Platten als fünf Justin Bieber.
Letztlich ist die Musikindustrie, wie der Name bereits sagt, vor allem eins: eine Industrie. Sie gehorcht den Gesetzen des Marktes und so werden auch bei Labels immer wieder Kosten reduziert, um die Firma rentabel zu halten. Das kann, wie bereits erwähnt, Ansprechpartner*innen oder die Künstler*innen selbst treffen. Wieso sollte wirtschaftlich an jemandem festgehalten werden, der die größten Hits vor zig Jahren lieferte oder womöglich gar ein One-Hit-Wonder ist? Auch in dieser Branche wird mit dem Rotstift gearbeitet. Kunst hin oder her.
Insbesondere weibliche Künstlerinnen sind häufig von diesen Regeln des Marktes betroffen, denn sie müssen hinter ihren männlichen Labelkollegen zurückstecken, wenn sie aufgrund der sexistischen Strukturen des Musikgeschäfts weniger der Verwertungslogik entsprechen. Als klassisches Beispiel wäre die Hip-Hop-Künstlerin THE LADY OF RAGE alias Robin Allen zu nennen. Sie war lange die einzige Frau unter den Männern bei Suge Knights Death Row Label. Rage war nicht nur auf einigen Songs des Dr. Dre Klassikers »The Chronic« zu hören, sondern rappte die ersten Zeilen auf Snoop Doggy Doggs »Doggystyle«. Eigentlich wäre ihr Debütalbum »Eargasm« das nächste geplante Release geworden, doch Death Row setzte auf die Zugkraft von Snoop Dogg und veröffentlichte neben zwei Soundtracks erst mal ein Album von Snoops alter Gruppe Tha Dogg Pound. Immer wieder wurde Rages Album verschoben, da die männlichen Rapper Vorrang hatten. Als Dre Death Row im Streit verließ, war »Eargasm« ebenfalls gestorben, das Album war Dres Vision für Rage, die er immer wieder ins Studio holte, um sie auf diversen Beats rappen zu lassen. Rage hatte auf die Veröffentlichungen wenig Einfluss. Tatsächlich war sie sogar dagegen, dass ihr Hit »Afro Puffs« erschien, da sie wenig begeistert vom G-Funk-Sound war. Sie verortete sich stilistisch eher am Eastcoast-Sound. Als 1997 endlich ihr Debütalbum »Necessary Roughness« erschien, war der Hype um Death Row abgeflacht. Zugpferde wie Dre und Snoop Dogg hatten das Label verlassen und Rage konnte wegen der Streitereien zwischen East- und Westcoast nicht die Produzenten bekommen, die sie gerne gehabt hätte.
Doch manchmal sieht ein Label in Künstler*innen etwas, was noch nicht vollends erblüht ist. Der sprichwörtliche Rohdiamant, der nur noch geschliffen werden muss. So arbeitete Lady Gaga vor ihrem Erfolg mit verschiedenen Produzenten und Labels, bis sie letztendlich zu der Kunstfigur wurde, die wir kennen. Auch Carole King schrieb zunächst Songs für andere Künstler*innen, bevor sie eine eigene Karriere startete. Ähnlich erging es Katy Perry …
(A) KATY PERRY UND FINGERPRINTS: DER STEINIGE AUFSTIEG EINES SUPERSTARS
Dass KATY PERRY mal bei der Vereidigung eines Präsidenten ihren eigenen Song singen würde, hätte sie 2006 bestimmt nie gedacht. Zum dritten Mal wurde sie von einem Label fallengelassen, trug die abgelegten Kleider ihrer Freundinnen auf und betete bei jedem ausgestellten Scheck, dass er gedeckt ist. Vor ihrem großen Durchbruch mit »I Kissed a Girl« und dem dazugehörigen Album »One of the Boys« im Jahr 2008 lag ein steiniger Weg. Bereits sieben Jahre zuvor veröffentlichte Perry mit gerade mal 17 Jahren ihr Debütalbum beim Label Red Hill Records, damals allerdings noch unter ihrem tatsächlichen Namen Katy Hudson. Und auch ihre Musik war extrem anders. Die Tochter eines Pastors spielte ereignislosen christlichen Pop-Rock. Zu ihren damaligen Vorbildern gehörte die Sängerin Amy Grant, eine der ersten Künstler*innen der Contemporary Christian Music, die den Sprung in den Mainstream geschafft hatte. Hudson alias Perry gelang dieser Sprung allerdings nicht. Gerade mal 200 Einheiten ihres Debüts wurden verkauft und machen die CD zu einem gesuchten Sammlerstück. Doch wie wurde aus der erfolglosen Katy Hudson der Megastar Katy Perry? Wie wurde aus dem Mädchen, das einen christlichen Gospel-Rock-Song namens »Faith Won’t Fail« schrieb, die Frau, die darüber sang, andere Mädchen zu küssen?
Zwei nie erschienene Alben, die sie zwischen 2003 und 2007 aufnahm, sind der fehlende Part in dieser Geschichte. Kurz nach ihrer ersten CD beschloss Katy Hudsen, alles auf eine Karte zu setzen und nach Los Angeles zu ziehen, um dort ein Popstar zu werden. Um nicht mehr mit der Schauspielerin Kate Hudson verwechselt zu werden, wählte sie den Geburtsnamen ihrer Mutter als Künstlernamen und wurde zu Katy Perry.
Glen Ballard sollte ihr bei ihrem Plan helfen. Perry sah den Produzenten in einer Doku über »Jagged Little Pill« von Alanis Morissette und war beeindruckt. Tatsächlich konnte sie bei Ballard vorstellig werden und die beiden kamen ins Geschäft. Er half ihr nicht nur, neue Songs zu schreiben, sondern auch ein neues Image zu kreieren. Die beiden weckten damit das Interesse von Island Def Jam, die wiederum das Produzententeam THE MATRIX mit ins Boot holten, die dem Pop-Rock von Perry erstmals einige zeitgemäßere elektronische Elemente hinzufügten. Jedoch hatte Def Jam vorerst kein Interesse, Perry als Solokünstlerin aufzubauen. Viel mehr war Perry jetzt Sängerin einer Band und das fertige Album wäre unter dem Namen The Matrix erschienen.
Ohne Solovertrag arbeitete Perry dennoch weiter an einem eigenen Album und es wirkte so, als würde die Platte 2005 erscheinen. In einem Artikel im Blender-Magazin von 2004 wurde Perry als Next Big Thing vorgestellt und machte im Interview dazu klar, dass sie nichts mehr mit der Kate Hudson von früher zu tun hatte: »Mein Album wird rockiger sein, vermutlich denken meine Eltern, dass ich dafür in die Hölle komme.«
So ganz hatte sich Perry aber noch nicht von ihren christlichen Wurzeln gelöst. Denn mit im Team war mittlerweile der Gitarrist der christlichen Rockband Relient K. Auch Songtitel wie »It’s Okay to Believe« klingen noch recht religiös. Für die christliche Metal-Band P.O.D. steuerte sie zudem Backing-Vocals zu »Goodbye for Now« bei und war auch im dazugehörigen Musikclip zu sehen. Nachdem Def Jam zwei Musikvideos (»Diamonds« und »Long Shot«) produzierte, löste es den Vertrag mit Perry auf. Das Label hatte einfach keine Idee, wie es Perry vermarkten sollte. Dabei stand bereits ein Veröffentlichungsdatum für das vermutlich »(A) Katy Perry« benannte Majordebüt fest, das bereits zu 80 Prozent fertig war.
Perry wurde von ihrem Label fallengelassen und war pleite. Die ganze Zeit über war das alles eine Hängepartie für den angehenden Weltstar. Um an Geld zu kommen, gab sie ihre eigenen Songs nun an andere Künstler*innen. Aus ihrem für ihr eigenes Album aufgenommenen »Hook Up« wurde somit Kelly Clarksons Top-20-Hit »I Do Not Hook Up«, und auch »Long Shot« war ursprünglich ein Song von Katy Perry.
Mit dem nächsten Labeldeal gelang abermals kein Durchbruch. Columbia Records brachte zwar den Song »Simple« auf dem Soundtrack zu dem durchaus erfolgreichen Film »Eine für Vier« (2005) unter, ließ der Künstlerin aber ansonsten wenig freie Hand. Auch hier erschien »(A) Katy Perry«, das im Sommer 2006 veröffentlicht werden sollte, nicht. Immerhin schafften es die Stücke »Box« und »Fingerprints« auf eine Promo-Compilation des Labels, die neue Künstler*innen vorstellte. »Fingerprints« war dann auch der neue Titel für das geplante Album, dessen Veröffentlichung für den Frühling 2007 vorgesehen war. Letztendlich verlor aber auch Columbia das Interesse an Perry. Zum Glück hatte sie mit Angelica Cob-Baehler, zuvor Chefin der Presseabteilung bei Columbia, eine Verbündete gefunden. Cob-Baehler, die nun bei Capitol arbeitete, setzte sich für Perry ein und überzeugte ihren Chef Jason Flom, sie unter Vertrag zu nehmen. Außerdem kauften Capitol gleich noch die Masterbänder von Columbia. Innerhalb von sieben Jahren hatte Perry also ihren vierten Plattenvertrag. Bei Capitol arbeitete sie nun mit Lukasz Gottwald alias Dr. Luke sowie dem Hit-Komponisten Max Martin zusammen, die mit ihr die späteren Hit-Singles »I Kissed a Girl« sowie »Hot n Cold« schrieben. Genau das, was dem fast fertigen Album noch fehlte. Nach all den Jahren harter Arbeit erschien mit »One of the Boys« endlich das Debüt Perrys und feierte riesige Erfolge.
(A) KATY PERRY (2006)
01. Box
02. Diamonds
03. Hook Up
04. LA Don’t Take It Away
05. Long Shot
06. Oh Love Let Me Sleep
07. It’s Okay to Believe
08. Sherlock Holmes
09. Simple
10. Takes One to Know One
11. Wish You the Worst
12. The Better Half of Me
13. Weigh Me Down
Die Authentizität des Tracklistings, das im Netz zirkuliert, ist nicht gesichert.
FINGERPRINTS (2007)
Es ist nur bekannt, dass die offiziell veröffentlichten Songs »Box« und »Fingertips« höchstwahrscheinlich auf dem Album gewesen wären. Vermutlich zusätzlich noch das Stück »Thinking of You«, für das bereits 2007 ein Musikvideo von Walter May gedreht wurde. Im Vergleich zur später erschienenen Version auf »One of the Boys« unterscheidet sich das Arrangement des Stückes deutlich. Auch der Song »Self Inflicted« war damals auf der Webseite von Perry vorab zu hören.
»(A) Katy Perry« und auch »Fingerprints« bleiben indes unveröffentlicht. Vielleicht müssen beide Platten auch als Zwischenschritt zu ihrem Debütalbum »One of the Boys« gesehen werden. Perry selbst sieht es so und sagt, dass sie über 70 Songs seit ihrem 18. Lebensjahr für »One of the Boys« schrieb. Da aber zwei Labels ein (fast) fertiges Album nicht veröffentlichten, greift hier eher, dass die Labels wohl keinen Hit hörten, die Veröffentlichungen daher zurückstellten und Verträge aufkündigten. Wer die bekannten Aufnahmen zu »(A) Katy Perry« und »Fingerprints« zu Ohren bekommt, stellt fest, dass die älteren Aufnahmen auch weit rockiger klingen als das spätere Material Perrys. Tatsächlich hält sich das Hit-Potential in Grenzen. Vermutete Überschneidungen zwischen »(A) Katy Perry« und »Fingerprints« zu »One of the Boys« sind ebenfalls eher marginal, weswegen jedes Album als eigenständiges Werk gesehen werden kann. Zwar erschienen einige ältere Songs als Bonus-Tracks auf einigen Editionen von »One of the Boys«, aber ansonsten besteht die Platte weitestgehend aus Stücken, die vermutlich auf keinem der beiden vorherigen Alben gelandet wären.
50 CENTS POWER OF THE DOLLAR: NEUN SCHÜSSE VOM BORDSTEIN BIS ZUR SKYLINE
Als 50 CENT die Weltbühne betrat, bediente er das Image des Gangsta- Rappers. Dass er tatsächlich eine Historie als Drogendealer hatte und nur wenige Jahre zuvor von neun Kugeln niedergestreckt wurde, half der Street Credibility. Nicht ohne Grund trat Curtis Jackson, so der bürgerliche Name von 50 Cent, mit schusssicherer Weste auf.
Am 24. Mai 2000 saß Jackson auf der Rückbank des Autos eines Freundes vor dem Haus seiner Großmutter, bei der er damals lebte. Plötzlich fuhr ein Wagen heran und hielt. Jemand stieg aus, trat an das Auto von Jacksons Freund und feuerte ab. Eine Kugel traf 50 Cent mitten ins Gesicht und schlug ihm einen Weisheitszahn aus. Ein weiterer Schuss ging quer durch die Hand. Die meisten Kugeln trafen die Beine und zerschmetterten die Knochen. Auch Jacksons Freund, Curtis Brown, wurde getroffen. Die beiden hatten Glück im Unglück. Jacksons Großmutter hörte die Schüsse und rief sofort einen Krankenwagen.
Jackson musste sich einer mehrstündigen Operation unterziehen. Er hatte Schmerzen, seine Hüfte war gebrochen und wegen des Schusses ins Gesicht hatte er Klammern im Mund. Dennoch ließ er sich direkt am Tag nach der OP Papiere an sein Bett bringen. Er musste sie unbedingt unterschreiben. Es war ein mit 250.000 Dollar dotierter Verlagsdeal für sein Major-Debütalbum »Power of the Dollar«– die Hälfte für seine Unterschrift und die andere Hälfte nach Erscheinen seiner ersten Platte.
Bis zu diesem Zeitpunkt war es gar nicht schlecht für ihn gelaufen. Drei Tage nach dem Überfall hätte er ein Musikvideo zu seiner neuen Single »Thug Love« drehen sollen. Einem Song, den er zusammen mit DESTINY’S CHILD aufgenommen hatte. Doch daraus wurde nichts mehr. Sein Label ließ ihn nach dem Anschlag fallen und »Power of the Dollar« kam niemals in die Plattenläden.
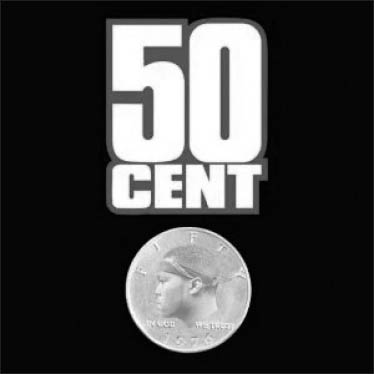
POWER OF THE DOLLAR (2000)
01. Intro
02. The Hit
03. The Good Die Young
04. Corner Bodega
05. Your Life’s on the Line
06. That Ain’t Gangsta
07. As the World Turns (ft. Bun B. of UGK)
08. Ghetto Qu’ran
09. Da Repercussions
10. Money by Any Means (ft. Noreaga)
11. Material Girl 2000
12. Thug Love (ft. Destiny’s Child)
13. Slow Doe
14. Gun Runner
15. You Ain’t No Gangsta
16. Power of the Dollar
17. I’m a Hustler (ft. Jay-Z & Jadakiss)
18. How to Rob (ft. The Madd Rapper)
Bereits 1996, vier Jahre zuvor, entdeckte Jam Master Jay von Run-DMC Jackson und nahm ihn unter seine Fittiche. Zusammen schrieben die beiden Songs und produzierten ein ganzes Album. Für Jay, der das Potential Jacksons erkannte, waren diese Aufnahmen lediglich eine Übung: noch nicht gut genug, um kommerziell auf dem Markt zu erscheinen, einfach Material, das Jackson voranbringen und als Songwriter reifen lassen sollte. Jackson selbst sah das anders und war enttäuscht von seinem Mentor. Er war bereit für den Erfolg. Also trennte er sich von Jay und wechselte Anfang 1999 zu dem erfolgreichen Produzenten-Team Trackmasters, die schon für Jay-Z, R. Kelly und Will Smith Hits produziert hatten. Ganze 36 Stücke nahmen Samuel »Tone« Barnes und Jean-Claude »Poke« Olivier mit Jackson auf. 18 davon sollten letztendlich auf seinem Major-Debüt »Power of the Dollar« bei Columbia Records erscheinen.
Und es lief wirklich nicht schlecht für ihn. Die ersten Singles kamen gut an und Jackson konnte sich von seinem bisherigen Leben als Crack-Dealer verabschieden. Seitdem er Notorius BIG das erste Mal rappen hörte, träumte er davon, sein Geld mit der Musik zu verdienen und das harte Leben als Kleinkrimineller hinter sich zu lassen. In seiner Autobiografie »Dealer, Rapper, Millionär« bekommen die Leser*innen einen Eindruck davon, was es heißt, wenn die einzigen Möglichkeiten der Armut zu entkommen Kriminalität oder eben Rap sind. Als junger Vater wollte Jackson der Kriminalität entfliehen, doch nur wenige Monate später lag er im Krankenbett und wusste nicht, wie es weitergehen sollte. Sein Label stellte sich tot und war nicht mehr für ihn zu erreichen.
Doch es gab keinen Plan B für ihn. Entweder die Musik oder wieder Crack in der Hood verticken. Er hatte nie einen richtigen Job und auch Arbeitspapiere besaß er nicht. Es war klar, dass die Musik seine einzige Chance war, all dem zu entkommen.
Obwohl 50 Cent den Vorschuss von Columbia bekam, sollte »Power of the Dollar« nicht erscheinen. Das Label bekam kalte Füße und wollte keine schlechte Presse.
Da signt ein Major einen Gangsta-Rapper und lässt ihn dann fallen, weil der tatsächlich angeschossen wird? Vermutlich ist der Grund sogar noch zynischer. Schließlich wurde Jackson ernsthaft verwundet und musste sich über Monate von den körperlichen Folgen erholen. Die ersten Wochen nach dem Krankenhausaufenthalt nutzte er eine Gehhilfe und wegen des Kugelfragments in seiner Zunge behielt er einen kleinen Sprachfehler. Ein Rapper mit Gehhilfe? War dies der Grund, warum Columbia die Reißleine zog? Rückblickend war es für 50 Cent ironischerweise gut, dass sein Vertrag aufgelöst wurde. Denn sein früheres Label Columbia hatte für relativ wenig Geld eine Option auf acht Alben erworben, aber die Richtung, die das Label mit ihm einschlug, hatte wenig mit dem zu tun, was 50 Cent selbst vorschwebte.
Ohne Deal kümmerte sich Jackson also selbst um seine Karriere. Nachdem er es wortwörtlich wieder auf die Beine schaffte, veröffentlichte er 2002 das Mixtape »Guess Who’s Back?«, auf dem auch Songs von »Power of the Dollar« zu hören waren. Nur eine Woche nach der Veröffentlichung schwärmte Eminem in einem Radiointerview von 50 Cent. Für einen siebenstelligen Dollar-Betrag nahmen Dr. Dre und er Jackson dann für ihre eigenen Labels, »Shady Records« und »Aftermath Records«, unter Vertrag. Sein 2003 tatsächlich erschienenes Major-Debüt »Get Rich or Die Tryin’« verkaufte sich weltweit über 15 Millionen Mal. In den USA war es das meistverkaufte Album des Jahres. Auf dem Cover ist Jackson mit entblößtem Oberkörper zu sehen – vor ihm eine durchschossene Glasscheibe.
VERTRÄGE UND RECHTSSTREITS
Guter rechtlicher Beistand ist für die Karriere als Popstar durchaus empfehlenswert. Künstler*innenverträge werden vermutlich genauso oft gelesen wie die Nutzungsbedingungen des neuesten Social-Media- Hypes. Dabei können rechtliche Differenzen Alben zurückhalten wie auch provozieren. Oftmals pochen Labels eher darauf, dass sie noch weitere Alben von ihren Künstler*innen bekommen müssten, da die abgeschlossenen Verträge mehrere Alben umfassen. Um früher aus solchen Verträgen zu kommen, behalfen sich einige damit, ein Best-of oder ein Livealbum anstelle von neuem Material abzuliefern. Manchmal wird aber auch einfach auf bisher unveröffentlichtes Material aus vorherigen Sessions zurückgegriffen. So entstand 1973 z. B. »Dylan« von BOB DYLAN. Columbia nahm einfach einige nicht für Platten genutzte Studio-Aufnahmen, ausschließlich Cover-Songs und Traditionals, aus den Sessions zu »Self Portrait« und »New Morning«, und brachte die Platte ohne Beteiligung von Dylan selbst auf den Markt. Dieser war kurz zuvor zu Asylum gewechselt und kündigte seine erste Tour seit 1966 an. Manche sagen, dass Columbia Dylan mit der von ihnen zusammengestellten Platte eins auswischen wollte. Immerhin stand das knapp zwei Monate vor seinem eigentlichen neuen Album »Planet Waves« erschienene Cover-Album in direkter Konkurrenz zum Asylum-Werk. Andere vermuten, dass Columbia einfach nur noch einmal Geld mit dem Künstler scheffeln wollte und den Wirbel um die anstehende Tour und das neue Studioalbum für sich nutzte.