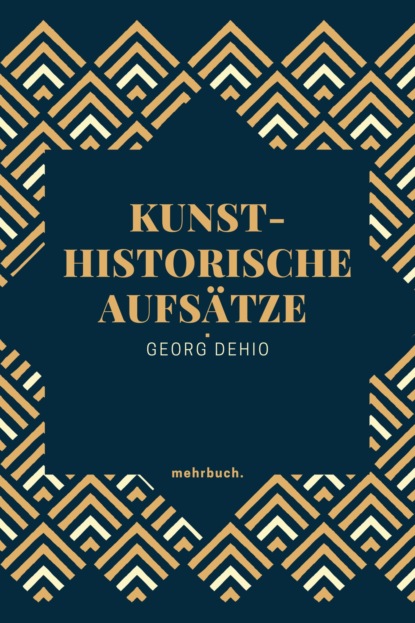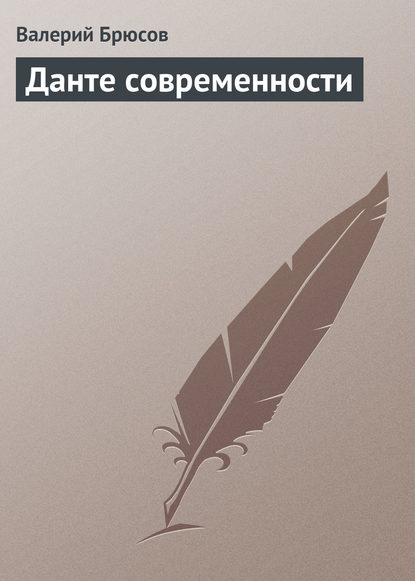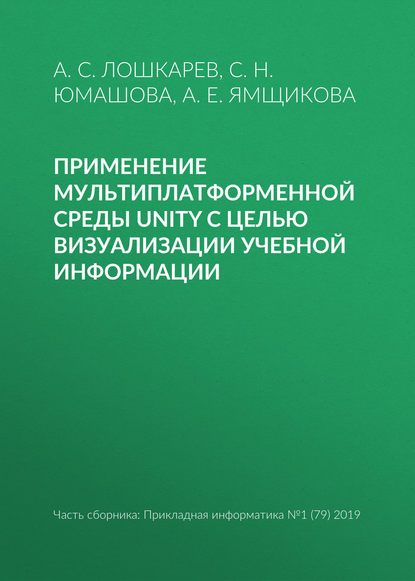- -
- 100%
- +

Georg Dehio
Kunsthistorische Aufsätze
Inhaltsverzeichnis
Vorwort
DIE KUNST DES MITTELALTERS
ÜBER DIE GRENZE DER RENAISSANCE GEGEN DIE GOTIK
DEUTSCHE KUNSTGESCHICHTE UND DEUTSCHE GESCHICHTE
HISTORISCHE BETRACHTUNG ÜBER DIE KUNST IM ELSASS
ZU DEN SKULPTUREN DES BAMBERGER DOMES
Nachwort 1892
DIE KUNST UNTERITALIENS IN DER ZEIT KAISER FRIEDRICHS II.
AnhangBurg Egisheim im Elsass (1908)
AUS DEM ÜBERGANG DES MITTELALTERS ZUR NEUZEIT
Konrad Witz
Der Ulmer Apostelmeister
DER MEISTER DES GEMMINGENDENKMALS IM MAINZER DOM
DIE KRISIS DER DEUTSCHEN KUNST IM XVI. JAHRHUNDERT
DIE BAUPROJEKTE VON NIKOLAUS V. UND L. B. ALBERTI
ZU DEN KOPIEN NACH LIONARDOS ABENDMAHL
ZUR GESCHICHTE DER BUCHSTABENREFORM IN DER RENAISSANCE
DIE RIVALITÄT ZWISCHEN RAPHAEL UND MICHELANGELO
ALT-ITALIENISCHE GEMÄLDE ALS QUELLE ZUM FAUST
DAS VERHÄLTNIS DER GESCHICHTLICHEN ZU DEN KUNSTGESCHICHTLICHEN STUDIEN
Nachwort 1914
WAS WIRD AUS DEM HEIDELBERGER SCHLOSS WERDEN?
Nachwort 1914
DENKMALSCHUTZ UND DENKMALPFLEGE IM NEUNZEHNTEN JAHRHUNDERT
DENKMALPFLEGE UND MUSEEN
ZUM GEDÄCHTNIS
Am Grab Heinrichs Freiherrn v. Geymüller
Viktor Hehn
DAS STRASSBURGER MÜNSTER
Impressum
Gustav von Bezold und Friedrich von Bezold
in alter Freundschaft
Die auf Anregung der Verlagsbuchhandlung hier vereinigten Aufsätze und Reden sind zum Teil vor langer Zeit und meistens auf bestimmte Anlässe hin konzipiert worden. Es schien deshalb nicht ratsam, viel an ihnen zu ändern.
Zum ersten Stück bemerke ich, dass es als Beitrag für die »Kultur der Gegenwart« schon 1904 niedergeschrieben war; der betreffende Band wurde aber zurückgestellt und das ganze Sammelwerk hat inzwischen einen anderen Charakter angenommen, insofern ursprünglich den einzelnen Teilen ein viel engerer Rahmen zugemessen war.
Ausgeschieden habe ich aus der vorliegenden Sammlung, was mir nur für einen engeren Kreis von Fachleuten Interesse zu haben schien: so fast alle meine architekturgeschichtlichen Arbeiten (erschienen im Jahrbuch der Kunstsammlungen des preußischen Staates, im Repertorium für Kunstwissenschaft und in der Zeitschrift für Architekturgeschichte), aber auch die Untersuchungen über die Glasgemälde des Straßburger Münsters (Zeitschrift für Geschichte des Oberrheins n. F. XXII 1907), die kritischen Beiträge zur Künstlergeschichte des 15. Jahrhunderts (Repertorium für Kunstwissenschaft XXXIII 1910), sowie die Aufsätze vermischten Inhalts, die ich in den 80er und 90er Jahren des vorigen Jahrhunderts hier und dort, hauptsächlich in der Beilage zur Allgemeinen Zeitung und in den Preußischen Jahrbüchern, veröffentlichte.
Meine größeren Arbeiten haben mich lange Zeit bei der Architekturgeschichte festgehalten; aus den vorliegenden kleinen Schriften wird man erkennen, dass mein Interessenkreis doch eine größere Spannweite hatte, wenn es hier auch, wie immer, heißen musste: ars longa, vita brevis.
Straßburg im März 1914
Der Verfasser
Inhalt
DIE KUNST DES MITTELALTERS
(1904)
Das Mittelalter beginnt kunstgeschichtlich dort, wo die griechisch-römische Kunst, auf ihrem eigenen Boden abgestorben, im Schoße fremden Volkstums in neue, abartende Entwicklungen eintritt. In diesem allgemeinsten Sinn hat die abendländische Kunst denselben Ausgangspunkt wie die byzantinisch-orientalische. Verschieden ist aber hier und dort nicht nur das aufnehmende Medium, sondern auch formal die Art der Verbindung. Im Osten trifft die griechisch-römische Kunst mit einer anderen, die ihre eigenen, sehr alten und sehr bestimmt gerichteten Überlieferungen hat, zusammen. Die jungen Völker des Westens dagegen, Kelten und Romanen, haben ihr nichts Eigenes und Fertiges entgegenzustellen. Ihre Götter wohnten nicht in Tempeln, ihre Könige nicht in Palästen. Sie waren ohne Kunst. Von einer Vermischung zweier Systeme, wie sie im Osten sich vollzog, ist bei ihnen nicht die Rede.
Gewiss, alles, was nachher die mittleren und neueren Zeiten künstlerisch geleistet haben, bliebe unverständlich ohne die Annahme, dass irgendwo in einem sehr verborgenen Winkel der germanischen Volksseele auch ein Keim zu künstlerischer Anlage bereitlag. Nur bleibt er für uns unsichtbar. Er besteht lediglich als potentielle Energie und musste lange schlummern, bis er in aktuelle sich umwandeln konnte. Phantasiebegabung zwar war das Letzte, was der germanischen Volksseele gefehlt hätte. Die ihr natürlichste Form, sich auszudrücken, war aber die Dichtung; übergreifend selbst auf Gebiete, die ihrem Wesen nach dem Verstand gehören, wie Recht und Staat; nicht vorhanden war jene feinere sinnliche Reizbarkeit, die zur bildenden Kunst führt. Es will etwas sagen, dass der dreihundertjährige Zeitraum römischer Herrschaft in Germanien für die Erziehung der Unterworfenen nach der künstlerischen Seite völlig unfruchtbar blieb: über ein bescheidenes Begehren nach Schmückung ihres Leibes, ihrer Behausungen, Geräte und Waffen kamen sie nicht hinaus, und die Formen, die sie in Gebrauch hatten, waren von früh auf aus dem Kunstkreis der Mittelmeervölker geborgt. Alles Suchen nach einem ureigenen germanischen Formenschatz ist umsonst; was man zuweilen dafür gehalten hat, besonders im Bereich der Nordgermanen, ist doch nichts anderes als barbarisiertes Lehngut, wenn auch mit bestimmt gerichtetem eigenen Willen in der Art der Auswahl und Abwandlung der Originale. Das Wesentliche ist das Absehen von der Naturwirklichkeit, eine absolute Musik der Linie. Auch die als Eroberer in die römischen Grenzen eindringenden Stämme sind zur Kunst in kein aktiveres Verhältnis gekommen; sie waren weitaus nicht die Zerstörer, die »Vandalen«, zu denen die spätere Legende sie gestempelt hat; sie gründeten ein Geschlecht von Herren, nicht von Handwerkern; sie nahmen die Kunst hin als einen untrennbaren Bestandteil der vorgefundenen Kultur, aber kraft eigenen Geschmacks ihr Vorschriften zu machen, lag ihnen fern. Genug, auch nach der germanischen Eroberung wandelte sich die Kunst der lateinischen Länder genau so ab, wie sie es ohne sie getan hätte.
Erst die um Jahrhunderte jüngere zweite Aussaat im Norden, die von der christlichen Kirche unternommene, ging auf. Erst jetzt kam die Zeit, wo der nordische Mensch auf die an ihn herangebrachten Kunsteindrücke seelisch antwortete, wo er sie nach seinem Sinn sich deutete, nach seinem Sinne umgewandelt etwas Ähnliches und doch schon anderes hervorzubringen sich gereizt fühlte. Zum ersten Mal in greifbarer Gestalt tritt uns dies neue Verhalten im Reich Karls des Großen entgegen: hier ist schon Mittelalter.
Zweierlei Veränderungen hatten sich inzwischen vollzogen: die eine in der inneren Disposition des empfangenden Teils, der Forschung verschlossen, aber notwendig vorauszusetzen; die andere im überlieferten Stoff selbst. Es handelte sich nicht mehr um die echte Antike, sondern um die schon innerlichst verwandelte, durch das Eindringen des wiedererwachten alten Orients einer ersten Zerlegung und neuen Zielsetzung unterworfenen Spätantike. Einen zweiten Zersetzungsprozess leitete jetzt der nordische Geist ein. War dies Geschäft vollbracht, so konnte der Aufbau eines neuen Kunstkörpers folgen. Für das Verständnis des Vorganges wesentlich ist, dass in der antiken Überlieferung immer noch ein Rest von Leben geblieben war. Die Kunst des karolingischen Zeitalters ist nicht Wiederbelebung, nicht Renaissance, wofür man sie öfters ausgegeben hat. Es ist nur in sehr untergeordnetem Sinn wahr, dass sie nach rückwärts schaute; in ihr wirkte noch ohne Unterbrechung der von der Antike kommende Stoß fort, mit dem sich dann die neuen, bald als die stärkeren sich erweisenden Kräfte verbanden.
Vermittlerin war, wie schon gesagt, die christliche Kirche. Von ihr wurde die Rezeption verlangt, zugleich deren Maß vorgeschrieben. Nur so viel, wie die Kirche von der antiken Kunstwelt unter ihr rettendes Dach aufgenommen hatte, gewann Einfluss auf die werdende mittelalterliche Kunst; was außerhalb dieses Überlieferungsrahmens stand, war allerdings tot. Die römischen Baudenkmäler, die in nicht geringer Zahl in den deutschen Rheinlanden, in größerer in verschiedenen Teilen Galliens – von Italien nicht zu reden – sich erhalten hatten, sind kein Faktor in der neuen Bewegung; nach wie vor sah der Barbar sie mit blöden, verständnislosen Augen an; erst auf einer viel weiter vorgerückten Stufe der mittelalterlichen Entwicklung haben sie an einigen Orten etwas Renaissanceähnliches hervorgerufen. In Betracht kommt für die Grundlegung nun: was brachte die christliche Kirche an Kunstformen mit? Ein genaues Inventar davon vermögen wir nach jetzigem Stand der Kenntnis nicht aufzustellen. Sicher war der lateinische Okzident nicht die einzige Quelle; jene große Transformation, in der die Antike im Orient begriffen war, hatte frühzeitig, vor Karl dem Großen, ihre Wirkungen bis in die keltisch-germanische Welt, soweit sie christlich wurde, hineinerstreckt. So ist denn nicht Weniges von dem, was uns als neu und unantik entgegentritt, gar nicht germanische, sondern orientalische, dem Westen importierte Prägung. Die Barbaren des Westens fühlten sich denen des Ostens in vielen Punkten näher als beide der klassischen Antike.
So sehr die germanischen Völker zunächst als der bloß empfangende, der anzutreibende und zu belehrende Teil erschienen, lag doch bei ihnen die positive Kraft der Neubildung. Die irischen Kelten, früher als die Germanen mit einer eigentümlich gefärbten Kunst auftretend, erreichten sehr bald die Grenze ihrer Leistungsfähigkeit. In Frankreich zeigte sich anfänglich der Süden und der Westen dem halb germanisierten Norden überlegen, dann aber trat dieser dauernd an die Spitze. Aber auch nicht das rein romanische Blut ergab einen Vorzug. Die spezifisch mittelalterliche Kunst hatte ihren Herd in Deutschland, Nordfrankreich, Burgund; in Italien beteiligte sich an ihrer Hervorbringung nur der nördlich des Apennin gelegene Teil der Halbinsel, Rom schon nicht mehr; Spanien hat eine originale Kunst überhaupt nicht besessen.
National im eigentlichen Sinne ist indessen die Kunst des Mittelalters niemals geworden. Nicht der Genius eines einzelnen Volkes, wie im Altertum der hellenische, war Führer. Der Einheitspunkt lag in einer Institution, die mit dem Begriff der Nationalität nichts zu tun hatte, in der katholischen Kirche. Das auf Überlieferung beruhende Bedürfnis der Kirche hatte die Kunst ins Leben gerufen; kirchlich blieb sie, solange sie mittelalterlich blieb; das Emporkommen einer autonomen weltlichen Kunst ist eines der ersten Zeichen des nahenden Verfalls der mittelalterlichen Weltanschauung. Der Kirche verdankt die Kunst, dass sie nicht in Anarchie verfiel; sie verdankt ihr ebenso die Stetigkeit ihrer Fortentwicklung, denn es war der größte Segen für sie, dass sie immer wieder an denselben Aufgaben sich zu üben und zu vollkommneren Lösungen sich emporzuheben hatte. Ebenso klar ersichtlich ist freilich, dass die Verbindung mit der Kirche eine Schranke bedeutete. Die Kirche hat ihre Oberhoheit zwar ohne Engherzigkeit geübt; so umfassend, wie ihr Wirkungskreis genommen wurde, durfte als kirchliche Kunst vieles auftreten, was unmittelbar mit der Religion nichts zu tun hatte; gleichwohl blieb es bestehen, dass ein anderes Daseinsrecht, als das ihr die Zwecke der Kirche gaben, für die Kunst nicht in Betracht kam. Daher die Ungleichheit des Verhaltens in den verschiedenen Gattungen. Unvergleichlich kräftiger und ergebnisreicher betätigte sich der schöpferische Trieb in den tektonischen, als in den imitativen Künsten. Jene, die stofflich indifferent sind, gestatteten ein freies Ausleben der Phantasie. Auf diesen lastete die Autorität. Das Bild, das der Maler und Plastiker hinstellte, war wieder nur aus dem Bild, dem überlieferten, nicht aus der Natur geschöpft. Die mittelalterliche Kunst ist der neuzeitlichen ebenso überlegen in ihrer gewaltigen stilisierenden Potenz, wie unterwertig durch ihre Naturfernheit. Einen Augenblick, auf ihrer Höhe im 13. Jahrhundert, schien es, als wollte sie auch nach dieser Seite zur Freiheit durchdringen; dann aber sank sie in Konventionalismus zurück. Wer sie aufsuchen und schildern will, nicht in ihrer Beschränktheit, sondern ihrer schöpferischen Ursprünglichkeit, dort wo sie wirksam blieb auf die nachfolgenden Zeiten bis herab auf die unsrige, der hat in erster Linie die Baukunst und die mit dieser unter gleichem Gesetz lebenden Kleinkünste ins Auge zu fassen.
Die Bauweise der germanischen Urzeit war reiner Holzbau; ihr setzte sich der Kirchenbau als reiner Steinbau entgegen. Ein stärkerer Gegensatz kann in der Welt architektonischer Möglichkeiten nicht gedacht werden. Eine Vermischung trat nicht ein; höchstens dass einige wenige aus der Behandlung des Holzes sich ergebende Schmuckformen in den Steinbau sich einschlichen, wozu wir aber z. B. das im romanischen Stil zu großer Verbreitung gelangte Motiv des Würfelkapitells nicht rechnen möchten; auch nicht die oft besprochenen Giebelchen als Ersatz für Bögen an der Torhalle des Klosters Lorsch in einem sonst ganz antikisierenden Formenensemble, da diese längst schon an altchristlichen Sarkophagen die gleiche Verwendung gefunden hatten. Der nationale Holzbau wurde infolgedessen auf einer inferioren Stufe zurückgehalten: die Entwicklung der Baukunst als Kunst vollzog sich allein im Steinbau. Für den autoritativen Charakter der Überlieferung ist das bezeichnend. Denn mit den konstruktiven Kenntnissen der Kirchenmänner, die jetzt als Bauleiter und Lehrer auftraten, war es schwach genug bestellt, und sie hatten große Mühe, sich ihre Handwerker heranzuziehen. Immerhin, auch in der rohesten Form hatte der Steinbau einen unersetzlichen Vorrang in Bezug auf Sicherheit und monumentale Würde. Der Fortschritt im Technischen nahm denn auch einen äußerst langsamen Gang; erst mit dem Eintritt ins 12. Jahrhundert beschleunigte er sich; das dreizehnte sah in der Baukunst, wie auf allen anderen Gebieten des mittelalterlichen Kultursystems die Höhe. Immer wird auch die Frühzeit für den Historiker kulturpsychologisch ein großes Interesse bewahren. Wir wollen als ihre Grenzen in abgerundeter Rechnung die Jahre 800 und 1000 annehmen. Sie als bloße Übergangszeit einzuschätzen, halten wir für falsch: denn gerade in ihr werden eine Anzahl der wichtigsten Grundlinien für die Zukunft gezogen. Gegenüber der Spätantike, so gesunken diese auch war, erscheint sie rau und barbarisch; aber der müde Quietismus, der jene gekennzeichnet hatte, ist überwunden; eine Wandlung mit klarer und energischer Zielstrebigkeit ist im Gang.
Wie überall in einer gesund sich entwickelnden Baukunst gingen die praktischen sachlichen Forderungen auf dem Weg voran. Die Kirche hatte ein Recht, sich als die Achse in der vom großen Kaiser neugeschaffenen Welt zu fühlen, und es gehörte zu den Mitteln ihrer Herrschaft, dass dieses dem Volk sichtbar werden sollte, wo immer sie sich feierlich zur Darstellung brachte, in den Formen des Gottesdienstes, in der Gestalt des Gotteshauses. Vor allem war der Abstand zwischen Geistlichkeit und Volk in der liturgischen Ordnung schärfer herauszukehren, nicht mehr bloß durch Schranken und Vorhänge, sondern durch eine neue Gliederung des Gebäudes selbst; die Zahl der Altäre mehrte sich; Reliquienkult und Wallfahrten wurden ein großes Wesen; vor allem die tonangebend an der Spitze der Baukunst stehenden Klöster hatten ihre besonderen Bedürfnisse. Die heilige Grundgestalt des Gotteshauses, die Basilika, wollte niemand antasten, aber man machte ihren Grundriss reicher, zusammengesetzter. Die folgenden neuen Motive sind die wichtigsten:
Erstens: Das Halbrund des Altarhauses von einem niedrigen konzentrischen Seitenschiff umzogen, beide Raumteile durch offene Bogenstellungen in Kommunikation; aus der Außenwand kleine halbrunde Kapellen, radiant zum Kreiszentrum des inneren Chors hervortretend. Diese Form – an welche älteren Vorformen etwa anknüpfend, ist hier nicht zu erörtern – entstand spätestens im 9. Jahrhundert in der großen Wallfahrtsbasilika zu Tours über dem Grab des hl. Martin, des größten Heiligen der Franken. Sie wurde die klassische Chorform des romanischen Stils im westlichen, südwestlichen und zentralen Gallien; einzelne große Kloster- und Pilgerkirchen des Nordens eigneten sie sich frühzeitig an, Burgund vom Ende des 11. Jahrhunderts ab; die Normandie kannte sie nicht, auch sonst kein außerfranzösisches Land mit Ausnahme von Spanien; im gotischen Stil später erlangte sie die größte Bedeutung.
Zweitens: Die Grundform des lateinischen Kreuzes, d. h. Anlage eines Querschiffs, an das sich östlich ein rechteckiger Chor, räumlich als Fortsetzung des Mittelschiffs gedacht, anschließt; damit verbindet sich als Wesentliches die Festsetzung einer konstanten Maßrelation zwischen den einzelnen Bauteilen in der Weise, dass die Breite des Mittelschiffs der Breite des Querschiffs gleichgesetzt und das dadurch im Kreuzesmittel entstehende Quadrat in der Ausmessung des Chors und der Kreuzflügel wiederholt, häufig auch in der Abmessung des Langhauses zugrunde gelegt wird, das dann als Summe mehrerer Quadrate erscheint. Die Bedeutung dieser Neuerung gegenüber der unentwickelten und schlaffen, nur selten überhaupt mit einem Querschiff begabten Konfiguration der altchristlichen Basilika leuchtet ohne weiteres ein. Sie ist typisch für das Ostfrankenreich. Im berühmten Bauriss für Sankt Gallen vom Jahr 820 zum ersten Mal sicher bezeugt, doch gewiss um einiges früher schon entstanden. Für den deutsch-romanischen Stil blieb sie während seiner ganzen Dauer ebenso bezeichnend, wie die vorher betrachtete Form für den französisch-romanischen.
Drittens: Der Grundriss des Ordens von Cluny: er erweitert den zuletzt beschriebenen; der Hauptchor erhält Nebenchöre, jeder mit einer apsidialen Nische geschlossen; ebensolche an der Ostwand der Kreuzflügel, so dass ihre Zahl auf fünf steigt. Unter dem Einfluss von Cluny dringt dieser Chortypus über Burgund hinaus in andere Länder vor; in geschlossenen Gruppen erscheint er in Deutschland (»Hirsauer Schule«) und der Normandie.
Viertens: Die Krypta; aus unentwickelten Vorformen des altchristlichen Brauchs entsteht im 9. und 10. Jahrhundert die bekannte Form einer halb unterirdischen Gewölbehalle, der bevorzugte Ort der Reliquienverehrung. Besonders den kreuzförmigen Anlagen, deren Chor sie zu einer wirkungsvollen Bühne für den Altardienst emporhebt, fügt sie sich glücklich ein und ist deshalb in Deutschland, aber auch nur hier, ein unentbehrlicher Bestandteil einer romanischen Kirchenanlage geworden. Der burgundisch-kluniazensische Schulkreis (mit Einschluss der Hirsauer) lehnte sie ab; auch im Westfrankenreich war sie wenigstens kein regelmäßiges Erfordernis.
Fünftens: Die Anlage eines zweiten Chors am westlichen Ende des Gebäudes unter Verdrängung des traditionellen Eingangs; meist mit eigener Krypta und nicht selten auch mit eigenem Querschiff. Dieser Typus entfernt sich vom ursprünglichen Gedanken der Basilika am weitesten. Nicht allein, aber am häufigsten kommt er wieder in deutschen Kloster- und Domkirchen vor. Vom 12. Jahrhundert ab ist er im Rückgang.
Sechstens: Im inneren Aufbau vollziehen sich unter Beibehaltung der in der Idee der Basilika liegenden allgemeinen Grundsätze folgende Veränderungen: an Stelle der leichten Backsteinkonstruktion tritt massiges Bruchsteinmauerwerk; die Arkadenöffnungen werden weiter, die Stützen niedriger und stärker; die Säule wird häufig durch vierseitige Pfeiler ersetzt oder Säulen und Pfeiler werden in einem bestimmten rhythmischen Wechsel kombiniert; Zahl und Größe der Fenster, die einen Glasverschluss nur selten empfangen, muss mit Rücksicht auf das nordische Klima erheblich beschränkt werden; die Seitenschiffe erhalten häufig ein zweites Geschoss, die Emporen, eine Einrichtung, die nach dem Jahr 1000 etwa in vielen Schulen, z. B. fast in allen deutschen, jedoch wieder aufgegeben wird.
Siebtens: Die Türme, die dem frühchristlichen Kirchenbau überhaupt gefehlt hatten und, als sie nach und nach in Aufnahme kamen, als gesonderte Gebäude neben den Kirchen standen, werden angegliedert, bald als Zentraltürme über dem Durchkreuzungspunkt des Querschiffs, bald als Fassadentürme, bald in Kombination beider Motive.
Die in diesen sieben Punkten enthaltenen Gedanken hat die karolingische Epoche als reichen Rohstoff gleichsam aus den Steinbrüchen gehoben; sie auszuarbeiten, zu verfeinern, zu beleben, blieb die noch immer große Aufgabe der folgenden Jahrhunderte. Ungeachtet der äußeren Anknüpfung an die altchristlichen Formen wird der ästhetische Grundcharakter des romanischen Stils mit einer schon früh sich zeigenden Entschiedenheit ein wesentlich anderer: er ist gruppierender Massenbau von starker rhythmischer Bewegung. Damit ist der Außenbau, der im Altchristlichen fast rein nichts gewesen war, wieder in seine Rechte eingesetzt, ja in der Blütezeit des Romanismus gehört ihm fast die größere Liebe. Die Mannigfaltigkeit der Gestaltung ist zuerst in der Differenzierung der Schulen, dann aber auch innerhalb der Schulen bei den einzelnen Bauindividuen, eine so große, wie sie seither kein anderer Stil mehr gekannt. Ein zweiter durchgehender Charakterzug ist die monumentale Würde und sichere Kraft, selbstbewusst ohne Ruhmredigkeit, ernst und gemessen auch in der Pracht, mit einem unzerstörbaren Etwas von Vornehmheit selbst an technisch roh geratenen oder zu kleinsten Abmessungen hinabsteigenden Bauten. Keine moderne Nachahmung hat diese Stimmungswerte je erreichen können.
Am langsamsten gewannen die Zierformen ihre eigene Sprache in der Zeit der Reife mit jener immer wieder anzustaunenden Fülle des ornamentalen Wortschatzes. Das 9., 10. und 11. Jahrhundert waren noch sparsam im plastischen Detail. Man würde sich jedoch irren, wollte man meinen, ihre Innenräume wären nicht anders als so kahl und roh, wie sie heute erscheinen, beabsichtigt gewesen. Die durchaus als notwendig empfundene Ergänzung brachte die Malerei. Was der Baumeister nur halb getan hatte, sollte der Maler weiterführen: die Flächen teilen, Zwischenglieder herstellen, durch ornamentale Symbole die Leistung der Bauglieder interpretieren, kurz, die ruhenden Massen mit rhythmischem Leben erfüllen. Der Weg der weiteren Entwicklung ist nun der, dass nach und nach der Steinmetz den Maler ablöst. Was in der Frühzeit durch wage- und senkrecht gemalte Bänder ausgedrückt worden war, für das treten Gesimse, Pilaster, Halbsäulen, kurz plastische Glieder; was den Kapitellen, Friesen, Türbogenfeldern der Pinsel als Zierrat gegeben hatte, wird in Meißelarbeit umgesetzt; Historienmalerei, figürliche Plastik und ornamentale Kunst grenzen ihre Gebiete bestimmter ab, jedes auf dem seinigen freier werdend, aber in der Wirkung sich unterstützend. Die Existenz urgermanischer Formen ist unerwiesen und unglaubhaft; die wahre Leistung des Mittelalters liegt in der Umdeutung und Neubelebung dessen, was ihr die Antike, und zwar aus der doppelten Quelle des Hellenismus und des Orients überliefert hatte. Selbstverständlich konnte das ohne starke eigene Phantasietätigkeit nicht zustande kommen. Nur zum kleinsten Teil gingen die Motive direkt von der Baukunst auf die Baukunst über; weitaus zum größeren hatten sie gleichsam eine Seelenwanderung durch den Körper anderer Kunstgattungen durchzumachen. In der Frühzeit nahmen die Kleinkünste sie in Pflege, in Metallarbeiten, in Elfenbeinschnitzereien, in Fadenmalerei und Miniaturmalerei waren die meisten Formen, deren sich die entfaltete Baukunst bediente, schon von langer Hand vorbereitet. Weiterhin hat sie die Dekorationsmalerei für den monumentalen Stil appretiert. Und erst zum Schluss kehrten sie, nun aber völlig verwandelt, zu dem der Baukunst eigensten Stoff, dem Stein, zurück. Um das Ergebnis zu verstehen, muss man diese lange Folge technischer Transformationen im Auge behalten. Es kam einer Neuschöpfung gleich. Nur jugendliche Völker haben das Glück, das zu können. Schon die Gotik war auf ornamentalem Gebiet weit unproduktiver. Bildhauer von heute können romanisches Ornament nicht einmal kopieren, es gerät ihnen unbegreiflich fade.